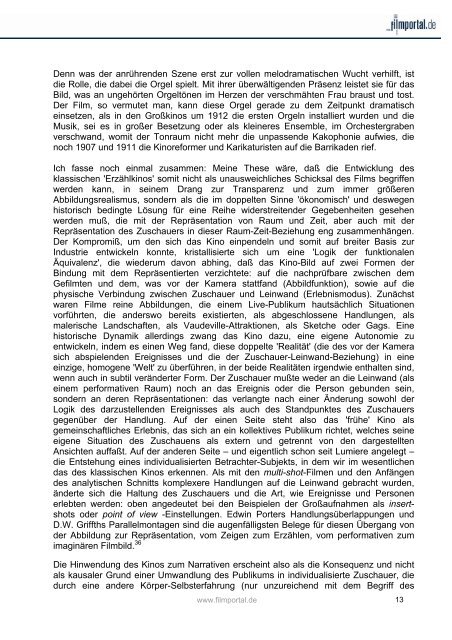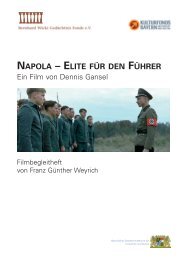Wie der frühe Film zum Erzählkino wurde - Filmportal.de
Wie der frühe Film zum Erzählkino wurde - Filmportal.de
Wie der frühe Film zum Erzählkino wurde - Filmportal.de
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Denn was <strong><strong>de</strong>r</strong> anrühren<strong>de</strong>n Szene erst zur vollen melodramatischen Wucht verhilft, ist<br />
die Rolle, die dabei die Orgel spielt. Mit ihrer überwältigen<strong>de</strong>n Präsenz leistet sie für das<br />
Bild, was an ungehörten Orgeltönen im Herzen <strong><strong>de</strong>r</strong> verschmähten Frau braust und tost.<br />
Der <strong>Film</strong>, so vermutet man, kann diese Orgel gera<strong>de</strong> zu <strong>de</strong>m Zeitpunkt dramatisch<br />
einsetzen, als in <strong>de</strong>n Großkinos um 1912 die ersten Orgeln installiert <strong>wur<strong>de</strong></strong>n und die<br />
Musik, sei es in großer Besetzung o<strong><strong>de</strong>r</strong> als kleineres Ensemble, im Orchestergraben<br />
verschwand, womit <strong><strong>de</strong>r</strong> Tonraum nicht mehr die unpassen<strong>de</strong> Kakophonie aufwies, die<br />
noch 1907 und 1911 die Kinoreformer und Karikaturisten auf die Barrika<strong>de</strong>n rief.<br />
Ich fasse noch einmal zusammen: Meine These wäre, daß die Entwicklung <strong>de</strong>s<br />
klassischen '<strong>Erzählkino</strong>s' somit nicht als unausweichliches Schicksal <strong>de</strong>s <strong>Film</strong>s begriffen<br />
wer<strong>de</strong>n kann, in seinem Drang zur Transparenz und <strong>zum</strong> immer größeren<br />
Abbildungsrealismus, son<strong><strong>de</strong>r</strong>n als die im doppelten Sinne 'ökonomisch' und <strong>de</strong>swegen<br />
historisch bedingte Lösung für eine Reihe wi<strong><strong>de</strong>r</strong>streiten<strong><strong>de</strong>r</strong> Gegebenheiten gesehen<br />
wer<strong>de</strong>n muß, die mit <strong><strong>de</strong>r</strong> Repräsentation von Raum und Zeit, aber auch mit <strong><strong>de</strong>r</strong><br />
Repräsentation <strong>de</strong>s Zuschauers in dieser Raum-Zeit-Beziehung eng zusammenhängen.<br />
Der Kompromiß, um <strong>de</strong>n sich das Kino einpen<strong>de</strong>ln und somit auf breiter Basis zur<br />
Industrie entwickeln konnte, kristallisierte sich um eine 'Logik <strong><strong>de</strong>r</strong> funktionalen<br />
Äquivalenz', die wie<strong><strong>de</strong>r</strong>um davon abhing, daß das Kino-Bild auf zwei Formen <strong><strong>de</strong>r</strong><br />
Bindung mit <strong>de</strong>m Repräsentierten verzichtete: auf die nachprüfbare zwischen <strong>de</strong>m<br />
Gefilmten und <strong>de</strong>m, was vor <strong><strong>de</strong>r</strong> Kamera stattfand (Abbildfunktion), sowie auf die<br />
physische Verbindung zwischen Zuschauer und Leinwand (Erlebnismodus). Zunächst<br />
waren <strong>Film</strong>e reine Abbildungen, die einem Live-Publikum hautsächlich Situationen<br />
vorführten, die an<strong><strong>de</strong>r</strong>swo bereits existierten, als abgeschlossene Handlungen, als<br />
malerische Landschaften, als Vau<strong>de</strong>ville-Attraktionen, als Sketche o<strong><strong>de</strong>r</strong> Gags. Eine<br />
historische Dynamik allerdings zwang das Kino dazu, eine eigene Autonomie zu<br />
entwickeln, in<strong>de</strong>m es einen Weg fand, diese doppelte 'Realität' (die <strong>de</strong>s vor <strong><strong>de</strong>r</strong> Kamera<br />
sich abspielen<strong>de</strong>n Ereignisses und die <strong><strong>de</strong>r</strong> Zuschauer-Leinwand-Beziehung) in eine<br />
einzige, homogene 'Welt' zu überführen, in <strong><strong>de</strong>r</strong> bei<strong>de</strong> Realitäten irgendwie enthalten sind,<br />
wenn auch in subtil verän<strong><strong>de</strong>r</strong>ter Form. Der Zuschauer mußte we<strong><strong>de</strong>r</strong> an die Leinwand (als<br />
einem performativen Raum) noch an das Ereignis o<strong><strong>de</strong>r</strong> die Person gebun<strong>de</strong>n sein,<br />
son<strong><strong>de</strong>r</strong>n an <strong><strong>de</strong>r</strong>en Repräsentationen: das verlangte nach einer Än<strong><strong>de</strong>r</strong>ung sowohl <strong><strong>de</strong>r</strong><br />
Logik <strong>de</strong>s darzustellen<strong>de</strong>n Ereignisses als auch <strong>de</strong>s Standpunktes <strong>de</strong>s Zuschauers<br />
gegenüber <strong><strong>de</strong>r</strong> Handlung. Auf <strong><strong>de</strong>r</strong> einen Seite steht also das '<strong>frühe</strong>' Kino als<br />
gemeinschaftliches Erlebnis, das sich an ein kollektives Publikum richtet, welches seine<br />
eigene Situation <strong>de</strong>s Zuschauens als extern und getrennt von <strong>de</strong>n dargestellten<br />
Ansichten auffaßt. Auf <strong><strong>de</strong>r</strong> an<strong><strong>de</strong>r</strong>en Seite – und eigentlich schon seit Lumiere angelegt –<br />
die Entstehung eines individualisierten Betrachter-Subjekts, in <strong>de</strong>m wir im wesentlichen<br />
das <strong>de</strong>s klassischen Kinos erkennen. Als mit <strong>de</strong>n multi-shot-<strong>Film</strong>en und <strong>de</strong>n Anfängen<br />
<strong>de</strong>s analytischen Schnitts komplexere Handlungen auf die Leinwand gebracht <strong>wur<strong>de</strong></strong>n,<br />
än<strong><strong>de</strong>r</strong>te sich die Haltung <strong>de</strong>s Zuschauers und die Art, wie Ereignisse und Personen<br />
erlebten wer<strong>de</strong>n: oben ange<strong>de</strong>utet bei <strong>de</strong>n Beispielen <strong><strong>de</strong>r</strong> Großaufnahmen als insertshots<br />
o<strong><strong>de</strong>r</strong> point of view -Einstellungen. Edwin Porters Handlungsüberlappungen und<br />
D.W. Griffths Parallelmontagen sind die augenfälligsten Belege für diesen Übergang von<br />
<strong><strong>de</strong>r</strong> Abbildung zur Repräsentation, vom Zeigen <strong>zum</strong> Erzählen, vom performativen <strong>zum</strong><br />
imaginären <strong>Film</strong>bild. 36<br />
Die Hinwendung <strong>de</strong>s Kinos <strong>zum</strong> Narrativen erscheint also als die Konsequenz und nicht<br />
als kausaler Grund einer Umwandlung <strong>de</strong>s Publikums in individualisierte Zuschauer, die<br />
durch eine an<strong><strong>de</strong>r</strong>e Körper-Selbsterfahrung (nur unzureichend mit <strong>de</strong>m Begriff <strong>de</strong>s<br />
www.filmportal.<strong>de</strong> 13