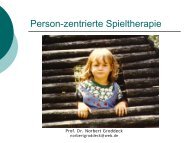Downloade hier - Norbert Groddeck
Downloade hier - Norbert Groddeck
Downloade hier - Norbert Groddeck
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
„Die Kunsttherapie integriert theoretische Erkenntnisse unterschiedlicher<br />
psychotherapeutischer Richtungen mit künstlerischen Ausdrucks- und<br />
kunsttherapeutischen Interventionsmöglichkeiten“ (Stewart 2009). Sie verbindet somit<br />
Kunst und Psychotherapie miteinander, und jede von ihnen wächst idealerweise durch<br />
ihre Vereinigung mit der anderen.<br />
Die Kunst beschreibt <strong>hier</strong>bei die Schöpfung ästhetisch stimulierender Darstellungen der<br />
Wirklichkeit. Die Psychotherapie hingegen hat die Behandlung psychisch anfälliger<br />
Individuen zum Gegenstand (vgl. Birtchnell 1984, S. 63). Die Kunsttherapie als<br />
Berufsfeld ist noch wenig institutionalisiert. In der Literatur wird sie als eine junge<br />
Disziplin verstanden und von unterschiedlichen Richtungen zum Beispiel medizinisch,<br />
psychoanalytisch oder psychiatrisch geprägt (vgl. <strong>Groddeck</strong> 1997, S. 270).<br />
Dort, wo die Verbalisierungsfähigkeit vom komplexen seelischen Geschehen an<br />
Grenzen stößt, bewährt sich die Kunsttherapie als diagnostisches, aber vor allem als<br />
therapeutisches “Medium”. Sie eröffnet die Möglichkeit, durch das gemalte Bild<br />
beziehungsweise das Objekt einen tiefen symbolischen Ausdruck für das noch<br />
unbewusste seelische Geschehen zu finden. Es gelingt folglich, innere Konflikte in eine<br />
sichtbare Form zu projizieren (vgl. Aissen-Crewett 2002, S. 13).<br />
„Kunsttherapie sprachfrei zu charakterisieren, ist Einbildung. Zwar beginnt ihre<br />
Funktion dort, wo Sprache nicht mehr ausreicht, aber indem Kunst Sprachloses zur<br />
Sprache bringt, ist sie erst recht Sprache“ (Rech 1989, S. 7). Die im therapeutischen<br />
Kontext entstehenden Bilder/Objekte lassen sich somit als “Brücke” zum inneren<br />
Erleben der Klienten 2 beschreiben. Mithilfe der Möglichkeit eines neuen<br />
Gestaltungsweges gelingt es der Kunsttherapie, die verbale Abwehr und<br />
Defensivmechanismen des Klienten zu umgehen. Es obliegt diesem, nun andere Seiten<br />
seines Seins zu entdecken und im künstlerischen Prozess psychische Konflikte zu verund<br />
bearbeiten. Der Klient erhält das Gefühl, aktiv an der Behandlung und seiner<br />
eigenen Wiederherstellung teil zu haben (vgl. Aissen-Crewett 2002, S. 13).<br />
2 Textbegleitend verwende ich stets maskuline Formen für Bezeichnungen wie zum Bespiel des Klienten,<br />
Patienten oder Therapeuten. Ich schließe darin jedoch immer beide Geschlechter mit ein.<br />
12