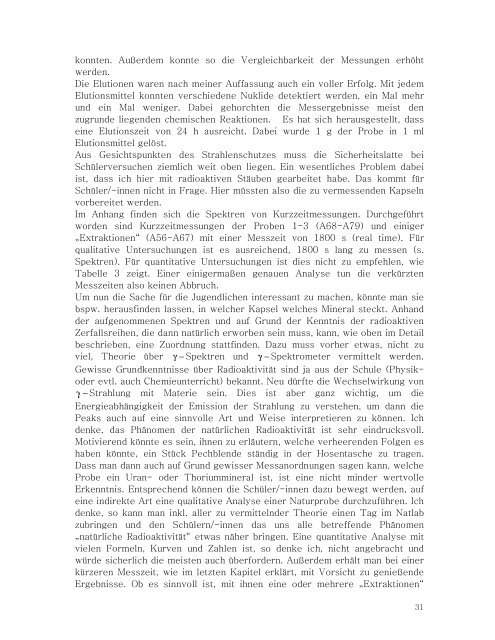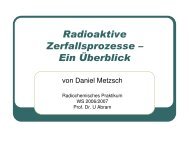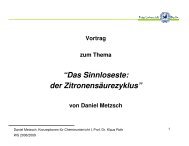BACHELORARBEIT - Metzsch, Daniel
BACHELORARBEIT - Metzsch, Daniel
BACHELORARBEIT - Metzsch, Daniel
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
konnten. Außerdem konnte so die Vergleichbarkeit der Messungen erhöht<br />
werden.<br />
Die Elutionen waren nach meiner Auffassung auch ein voller Erfolg. Mit jedem<br />
Elutionsmittel konnten verschiedene Nuklide detektiert werden, ein Mal mehr<br />
und ein Mal weniger. Dabei gehorchten die Messergebnisse meist den<br />
zugrunde liegenden chemischen Reaktionen. Es hat sich herausgestellt, dass<br />
eine Elutionszeit von 24 h ausreicht. Dabei wurde 1 g der Probe in 1 ml<br />
Elutionsmittel gelöst.<br />
Aus Gesichtspunkten des Strahlenschutzes muss die Sicherheitslatte bei<br />
Schülerversuchen ziemlich weit oben liegen. Ein wesentliches Problem dabei<br />
ist, dass ich hier mit radioaktiven Stäuben gearbeitet habe. Das kommt für<br />
Schüler/-innen nicht in Frage. Hier müssten also die zu vermessenden Kapseln<br />
vorbereitet werden.<br />
Im Anhang finden sich die Spektren von Kurzzeitmessungen. Durchgeführt<br />
worden sind Kurzzeitmessungen der Proben 1-3 (A68-A79) und einiger<br />
„Extraktionen“ (A56-A67) mit einer Messzeit von 1800 s (real time). Für<br />
qualitative Untersuchungen ist es ausreichend, 1800 s lang zu messen (s.<br />
Spektren). Für quantitative Untersuchungen ist dies nicht zu empfehlen, wie<br />
Tabelle 3 zeigt. Einer einigermaßen genauen Analyse tun die verkürzten<br />
Messzeiten also keinen Abbruch.<br />
Um nun die Sache für die Jugendlichen interessant zu machen, könnte man sie<br />
bspw. herausfinden lassen, in welcher Kapsel welches Mineral steckt. Anhand<br />
der aufgenommenen Spektren und auf Grund der Kenntnis der radioaktiven<br />
Zerfallsreihen, die dann natürlich erworben sein muss, kann, wie oben im Detail<br />
beschrieben, eine Zuordnung stattfinden. Dazu muss vorher etwas, nicht zu<br />
viel, Theorie über γ − Spektren und γ − Spektrometer vermittelt werden.<br />
Gewisse Grundkenntnisse über Radioaktivität sind ja aus der Schule (Physikoder<br />
evtl. auch Chemieunterricht) bekannt. Neu dürfte die Wechselwirkung von<br />
γ − Strahlung mit Materie sein. Dies ist aber ganz wichtig, um die<br />
Energieabhängigkeit der Emission der Strahlung zu verstehen, um dann die<br />
Peaks auch auf eine sinnvolle Art und Weise interpretieren zu können. Ich<br />
denke, das Phänomen der natürlichen Radioaktivität ist sehr eindrucksvoll.<br />
Motivierend könnte es sein, ihnen zu erläutern, welche verheerenden Folgen es<br />
haben könnte, ein Stück Pechblende ständig in der Hosentasche zu tragen.<br />
Dass man dann auch auf Grund gewisser Messanordnungen sagen kann, welche<br />
Probe ein Uran- oder Thoriummineral ist, ist eine nicht minder wertvolle<br />
Erkenntnis. Entsprechend können die Schüler/-innen dazu bewegt werden, auf<br />
eine indirekte Art eine qualitative Analyse einer Naturprobe durchzuführen. Ich<br />
denke, so kann man inkl. aller zu vermittelnder Theorie einen Tag im Natlab<br />
zubringen und den Schülern/-innen das uns alle betreffende Phänomen<br />
„natürliche Radioaktivität“ etwas näher bringen. Eine quantitative Analyse mit<br />
vielen Formeln, Kurven und Zahlen ist, so denke ich, nicht angebracht und<br />
würde sicherlich die meisten auch überfordern. Außerdem erhält man bei einer<br />
kürzeren Messzeit, wie im letzten Kapitel erklärt, mit Vorsicht zu genießende<br />
Ergebnisse. Ob es sinnvoll ist, mit ihnen eine oder mehrere „Extraktionen“<br />
31