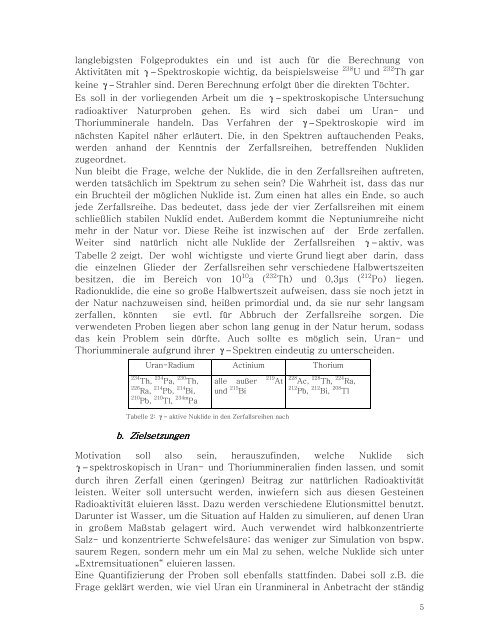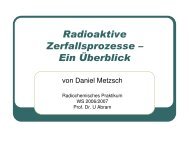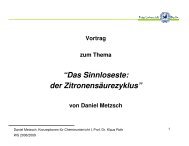BACHELORARBEIT - Metzsch, Daniel
BACHELORARBEIT - Metzsch, Daniel
BACHELORARBEIT - Metzsch, Daniel
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
langlebigsten Folgeproduktes ein und ist auch für die Berechnung von<br />
Aktivitäten mit γ − Spektroskopie wichtig, da beispielsweise 238 U und 232 Th gar<br />
keine γ − Strahler sind. Deren Berechnung erfolgt über die direkten Töchter.<br />
Es soll in der vorliegenden Arbeit um die γ − spektroskopische Untersuchung<br />
radioaktiver Naturproben gehen. Es wird sich dabei um Uran- und<br />
Thoriumminerale handeln. Das Verfahren der γ − Spektroskopie wird im<br />
nächsten Kapitel näher erläutert. Die, in den Spektren auftauchenden Peaks,<br />
werden anhand der Kenntnis der Zerfallsreihen, betreffenden Nukliden<br />
zugeordnet.<br />
Nun bleibt die Frage, welche der Nuklide, die in den Zerfallsreihen auftreten,<br />
werden tatsächlich im Spektrum zu sehen sein? Die Wahrheit ist, dass das nur<br />
ein Bruchteil der möglichen Nuklide ist. Zum einen hat alles ein Ende, so auch<br />
jede Zerfallsreihe. Das bedeutet, dass jede der vier Zerfallsreihen mit einem<br />
schließlich stabilen Nuklid endet. Außerdem kommt die Neptuniumreihe nicht<br />
mehr in der Natur vor. Diese Reihe ist inzwischen auf der Erde zerfallen.<br />
Weiter sind natürlich nicht alle Nuklide der Zerfallsreihen γ − aktiv, was<br />
Tabelle 2 zeigt. Der wohl wichtigste und vierte Grund liegt aber darin, dass<br />
die einzelnen Glieder der Zerfallsreihen sehr verschiedene Halbwertszeiten<br />
besitzen, die im Bereich von 10 10 a ( 232 Th) und 0,3μs ( 212 Po) liegen.<br />
Radionuklide, die eine so große Halbwertszeit aufweisen, dass sie noch jetzt in<br />
der Natur nachzuweisen sind, heißen primordial und, da sie nur sehr langsam<br />
zerfallen, könnten sie evtl. für Abbruch der Zerfallsreihe sorgen. Die<br />
verwendeten Proben liegen aber schon lang genug in der Natur herum, sodass<br />
das kein Problem sein dürfte. Auch sollte es möglich sein, Uran- und<br />
Thoriumminerale aufgrund ihrer γ − Spektren eindeutig zu unterscheiden.<br />
Uran-Radium Actinium Thorium<br />
234 Th, 234 Pa, 230 Th,<br />
226 Ra, 214 Pb, 214 Bi,<br />
210 Pb, 210 Tl, 234m Pa<br />
alle außer<br />
und 215 Bi<br />
219 At<br />
228 Ac, 228 Th, 224 Ra,<br />
212 Pb, 212 Bi, 208 Tl<br />
Tabelle 2:<br />
γ − aktive Nuklide in den Zerfallsreihen nach<br />
b. Zielsetzungen<br />
en<br />
Motivation soll also sein, herauszufinden, welche Nuklide sich<br />
γ − spektroskopisch in Uran- und Thoriummineralien finden lassen, und somit<br />
durch ihren Zerfall einen (geringen) Beitrag zur natürlichen Radioaktivität<br />
leisten. Weiter soll untersucht werden, inwiefern sich aus diesen Gesteinen<br />
Radioaktivität eluieren lässt. Dazu werden verschiedene Elutionsmittel benutzt.<br />
Darunter ist Wasser, um die Situation auf Halden zu simulieren, auf denen Uran<br />
in großem Maßstab gelagert wird. Auch verwendet wird halbkonzentrierte<br />
Salz- und konzentrierte Schwefelsäure; das weniger zur Simulation von bspw.<br />
saurem Regen, sondern mehr um ein Mal zu sehen, welche Nuklide sich unter<br />
„Extremsituationen“ eluieren lassen.<br />
Eine Quantifizierung der Proben soll ebenfalls stattfinden. Dabei soll z.B. die<br />
Frage geklärt werden, wie viel Uran ein Uranmineral in Anbetracht der ständig<br />
5