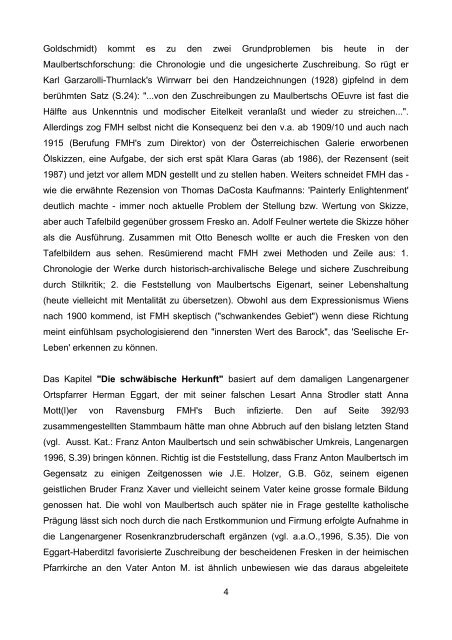Franz Martin Haberditzl: Franz Anton Maulbertsch 1724-1796 ...
Franz Martin Haberditzl: Franz Anton Maulbertsch 1724-1796 ...
Franz Martin Haberditzl: Franz Anton Maulbertsch 1724-1796 ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Goldschmidt) kommt es zu den zwei Grundproblemen bis heute in der<br />
<strong>Maulbertsch</strong>forschung: die Chronologie und die ungesicherte Zuschreibung. So rügt er<br />
Karl Garzarolli-Thurnlack's Wirrwarr bei den Handzeichnungen (1928) gipfelnd in dem<br />
berühmten Satz (S.24): "...von den Zuschreibungen zu <strong>Maulbertsch</strong>s OEuvre ist fast die<br />
Hälfte aus Unkenntnis und modischer Eitelkeit veranlaßt und wieder zu streichen...".<br />
Allerdings zog FMH selbst nicht die Konsequenz bei den v.a. ab 1909/10 und auch nach<br />
1915 (Berufung FMH's zum Direktor) von der Österreichischen Galerie erworbenen<br />
Ölskizzen, eine Aufgabe, der sich erst spät Klara Garas (ab 1986), der Rezensent (seit<br />
1987) und jetzt vor allem MDN gestellt und zu stellen haben. Weiters schneidet FMH das -<br />
wie die erwähnte Rezension von Thomas DaCosta Kaufmanns: 'Painterly Enlightenment'<br />
deutlich machte - immer noch aktuelle Problem der Stellung bzw. Wertung von Skizze,<br />
aber auch Tafelbild gegenüber grossem Fresko an. Adolf Feulner wertete die Skizze höher<br />
als die Ausführung. Zusammen mit Otto Benesch wollte er auch die Fresken von den<br />
Tafelbildern aus sehen. Resümierend macht FMH zwei Methoden und Zeile aus: 1.<br />
Chronologie der Werke durch historisch-archivalische Belege und sichere Zuschreibung<br />
durch Stilkritik; 2. die Feststellung von <strong>Maulbertsch</strong>s Eigenart, seiner Lebenshaltung<br />
(heute vielleicht mit Mentalität zu übersetzen). Obwohl aus dem Expressionismus Wiens<br />
nach 1900 kommend, ist FMH skeptisch ("schwankendes Gebiet") wenn diese Richtung<br />
meint einfühlsam psychologisierend den "innersten Wert des Barock", das 'Seelische Er-<br />
Leben' erkennen zu können.<br />
Das Kapitel "Die schwäbische Herkunft" basiert auf dem damaligen Langenargener<br />
Ortspfarrer Herman Eggart, der mit seiner falschen Lesart Anna Strodler statt Anna<br />
Mott(l)er von Ravensburg FMH's Buch infizierte. Den auf Seite 392/93<br />
zusammengestellten Stammbaum hätte man ohne Abbruch auf den bislang letzten Stand<br />
(vgl. Ausst. Kat.: <strong>Franz</strong> <strong>Anton</strong> <strong>Maulbertsch</strong> und sein schwäbischer Umkreis, Langenargen<br />
1996, S.39) bringen können. Richtig ist die Feststellung, dass <strong>Franz</strong> <strong>Anton</strong> <strong>Maulbertsch</strong> im<br />
Gegensatz zu einigen Zeitgenossen wie J.E. Holzer, G.B. Göz, seinem eigenen<br />
geistlichen Bruder <strong>Franz</strong> Xaver und vielleicht seinem Vater keine grosse formale Bildung<br />
genossen hat. Die wohl von <strong>Maulbertsch</strong> auch später nie in Frage gestellte katholische<br />
Prägung lässt sich noch durch die nach Erstkommunion und Firmung erfolgte Aufnahme in<br />
die Langenargener Rosenkranzbruderschaft ergänzen (vgl. a.a.O.,1996, S.35). Die von<br />
Eggart-<strong>Haberditzl</strong> favorisierte Zuschreibung der bescheidenen Fresken in der heimischen<br />
Pfarrkirche an den Vater <strong>Anton</strong> M. ist ähnlich unbewiesen wie das daraus abgeleitete<br />
4