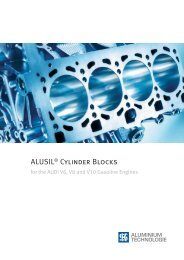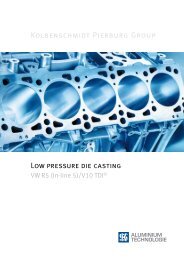Profil 5/2003 f.r Internet - KSPG AG
Profil 5/2003 f.r Internet - KSPG AG
Profil 5/2003 f.r Internet - KSPG AG
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Das <strong>Profil</strong> 5/<strong>2003</strong> Dokumentation<br />
Seite 17<br />
Schiffsartillerie stellte ganz besondere Anforderungen an die Konstrukteure<br />
Auch Marine bestellte<br />
bei Heinrich Ehrhardt<br />
Düsseldorf. Rheinmetall Defence und Naval Systems – dieses Junktim verband<br />
man bis vor kurzer Zeit mit dem Geschäftsfeld STN Atlas Elektronik GmbH<br />
der Rheinmetall DeTec <strong>AG</strong>. Und in der Tat nahm deren Geschäftsbereich Naval<br />
Systems, der – wie berichtet – rückwirkend zum 1. Januar <strong>2003</strong> von der BAe Systems<br />
Deutschland GmbH übernommen wurde („Das <strong>Profil</strong>“ 4/<strong>2003</strong>), einen großen<br />
Teil der marinetechnischen Kompetenz der Rheinmetall-Defence-Gruppe<br />
ein. Auch die Ursprünge der früheren STN Atlas Elektronik GmbH – die Bremer<br />
Atlas-Werke waren 1902 durch den Norddeutschen Lloyd als Schiffsbauzulieferfirma<br />
gegründet worden – liegen im maritimen Bereich. Weniger bekannt dagegen<br />
ist, dass auch der Heerestechnik-Spezialist Rheinmetall selbst eine starke<br />
Tradition im Bereich der Marinebewaffnung aufweisen kann, die allerdings<br />
vor allem in der Zeit vor 1945 begründet ist. Schon die 1889 durch Heinrich Ehrhardt<br />
gegründete Rheinische Metallwaaren- und Maschinenfabrik <strong>AG</strong> hatte einen<br />
exzellenten Ruf in der Bewaffnung und Ausrüstung der Marine. Praktisch<br />
vom Beginn der Geschützfertigung an wurden auch Marinewaffen in Düsseldorf<br />
hergestellt, wie zahlreiche Quellen aus dem Rheinmetall-Archiv belegen.<br />
I<br />
In den Jahren vor dem Ersten<br />
Weltkrieg beeindruckte das kaiserliche<br />
Deutschland durch ein<br />
umfangreiches Flottenbauprogramm.<br />
Gemäß der Forderung<br />
Kaiser Wilhelms II., „der Dreizack<br />
muß in unserer Faust sein“<br />
(gemeint war das Symbol der britischen<br />
Seemacht), setzte das junge Deutsche<br />
Reich seit der Wende zum 20. Jahrhundert<br />
alles daran, seine Position als Seestreitmacht<br />
nachhaltig zu verbessern.<br />
Mit dem Stapellauf des britischen<br />
Kriegsschiffes „Dreadnought“ im Jahre<br />
1906, der ersten bedeutsamen marinetechnischen<br />
Innovation der Briten seit<br />
über 25 Jahren, setzte ein Wettrüsten<br />
zur See ein, das in wenigen Jahren britische<br />
und deutsche Schlachtschiffe in<br />
immer größerer Zahl, mit immer höherer<br />
Fahrgeschwindigkeit, mit immer<br />
stärkerer Panzerung und mit immer<br />
mehr Geschützen von immer größer<br />
werdendem Kaliber hervorbrachte.<br />
DesKaisers „liebstes Kind“ bedurfte<br />
natürlich einer angemessenen Bewaffnung,<br />
und so war dem Bestreben<br />
Deutschlands, eine starke Seemacht<br />
zu schaffen, „auch eine junge Waffenfabrik<br />
an den Ufern des Rheinstroms<br />
mit der Tat gefolgt.“ Damit kündigte<br />
mitten in der zweiten Marokko-Krise<br />
Rheinmetall-Aufsichtsrat Generalleutnant<br />
Ernst von Reichenau in einem Artikel<br />
(„Alle Mann an Deck!“) in der Berliner<br />
„Illustrierten Zeitung“ vom 26.<br />
Oktober 1911 an, künftig werde sich<br />
das Unternehmen mit seinen derzeit<br />
5000 Mitarbeitern auch der „Konstruktion<br />
und Herstellung von Marinegeschützen“<br />
einschließlich der dazugehörigen<br />
Munition widmen.<br />
Die gesamte Schiffsartillerie stellte<br />
an ihre Konstrukteure schon immer<br />
ganz besondere Anforderungen, weil<br />
hier von keinem festen Punkt, sondern<br />
von einem schlingernden, ständig<br />
bewegten Untergrund aus gefeuert<br />
und getroffen werden sollte. Rheinmetall<br />
entwickelte dafür frühzeitig besondere<br />
Einrichtungen, die das Richten<br />
der Geschütze und gezieltes Dauerfeuer<br />
auch bei starkem Seegang ermöglichten.<br />
Dazu gehörten Geschütze<br />
für die Abwehr von Torpedobooten,<br />
demontierbare<br />
Geschütze für<br />
Bord- und Landgebrauchzugleich<br />
(mithin<br />
ein früher Vorläufer<br />
des aktuellen<br />
„Monarc“-<br />
Projekts), Geschütze<br />
für den<br />
Landungsgebrauch<br />
und<br />
Mörser für die<br />
ambulante Küstenverteidigung<br />
sowie U-Boot-<br />
Geschütze der<br />
Kaliber 8,8 und<br />
10,5 cm.<br />
Welche Bedeutung die Marine als eigenständiger<br />
Kunde innerhalb der deutschen<br />
Militärverwaltung hatte, unterstreicht<br />
die Existenz eines eigenen Marine-Vertreters<br />
in Berlin. Wie aus den Unterlagen<br />
des damaligen Rheinmetall-<br />
Aufsichtsrats hervorgeht, hatte dieser<br />
zumindest bis Ende des Ersten Weltkriegs<br />
den Auftrag, die Marineprodukte<br />
des Unternehmens nicht nur den deutschen,<br />
sondern auch den ausländischen<br />
Marine-Behörden (über deren<br />
diplomatische Vertretungen) vorzustellen.<br />
Mangels einer geeigneten Persönlichkeit<br />
übernahm diese Aufgabe 1915<br />
der Heeresvertreter Rheinmetalls mit;<br />
aber die Rheinmetall-Vorstände Gustav<br />
3,7-cm-Flak von Rheinmetall-Borsig auf einer dreiachsigen<br />
Sockellafette für U-Boote und andere Einheiten der Kriegsmarine.<br />
Nach dem Aufbau der Bundeswehr 1955 und der deutschen Wiederbewaffnung<br />
im Rahmen der Nato lieferte der Heerestechnikspezialist Rheinmetall auch an<br />
die Bundesmarine: Eine der gefragtesten Geschütztypen neben den 105- und<br />
120-mm-Waffenanlagen für den Kampfpanzer Leopard war seit den sechziger<br />
Jahren die 20-mm-Kanone Rh 202; die Marineversion wird jetzt nach und nach<br />
durch das Marineleichtgeschütz MLG 27 der Mauser-Werke Oberndorf ersetzt.<br />
Müller und Hermann Beitter waren sich<br />
damals sicher, „nach dem Feldzug wird<br />
die Tätigkeit für einen Herrn zu umfangreich<br />
werden“. Die Geschichte verlief indes<br />
anders: Laut Versailler Vertrag war<br />
eine Produktion für eine eventuelle<br />
neue Kriegsmarine nicht mehr gestattet.<br />
Um dennoch konstruktiv an einer<br />
künftigen Wiederbewaffnung der deutschen<br />
Reichsmarine mitarbeiten zu<br />
können und sich deswegen den wachsamen<br />
Augen der alliierten Kontrollkommission<br />
zu entziehen – vor allem<br />
den französischen und belgischen<br />
Truppen, die 1923 das Ruhrgebiet, das<br />
Rheinland und Düsseldorf besetzt hatten<br />
–, verlegte Rheinmetall die entsprechenden<br />
Arbeiten 1924 bis 1925 nach<br />
Unterlüß. Nachdem schließlich die Erlaubnis<br />
für die Fertigung von Geschützen<br />
bis zu einem Kaliber von 17 cm für<br />
Heer und Marine erteilt worden war und<br />
im Rahmens des Versailler Vertrages ab<br />
Mitte der zwanziger Jahre erstmals auch<br />
wieder Kreuzer für die Reichsmarine gebaut<br />
wurden, erhielt das mittlerweile<br />
mehrheitlich in Staatsbesitz übergegangene<br />
Unternehmen im Februar 1925<br />
den Auftrag zur Panzerung und Bewaffnung<br />
dieser Schiffe mit 15-cm-Drillingstürmen<br />
und 8,8-cm-Flakgruppen.<br />
Als erster Kreuzer wurde die „Emden“<br />
mit 15-cm-Geschützen bestückt, allerdings<br />
noch mit einer Pivot-Lafettierung,<br />
da die Turmentwicklung noch nicht abgeschlossen<br />
war. Ein weiterer Erfolg war<br />
Rheinmetall beschieden, als 1925 die<br />
eigene Dependance in Sömmerda als<br />
einziger deutscher Hersteller von Zündern<br />
und Zündungen für Heeres- und<br />
Marinetechnik zugelassen wurde.<br />
Eines der berühmtesten Schiffe, das<br />
während der Weimarer Republik mit<br />
Rheinmetall-Geschützen ausgestattet<br />
wurde, war der leichte Kreuzer „Königsberg“.<br />
1927 in der Reichsmarinewerft<br />
Wilhelmshaven vom Stapel gelaufen,<br />
wurde er bis zu seiner Indienststellung<br />
am 17. April 1929 als Schulkreuzer mit<br />
neun 15-cm-Schiffskanonen, acht 3,7cm-Flaks<br />
und sechs 8,8-cm-Flaks bewaffnet.<br />
Verantwortlich für dieses<br />
Großprojekt, der ersten großen artilleristischen<br />
Arbeit des Werkes Düsseldorf<br />
nach dem 1. Weltkrieg, war Oberingenieur<br />
Hermann Westphälinger, der<br />
von Entwicklungschef Prof. Carl Waninger<br />
folgendes Dankschreiben erhielt:<br />
„Mit dem gut verlaufenen Anschiessen<br />
der Türme auf der ‚Königsberg‘ hat unsere<br />
Firma insofern einen bedeutenden<br />
Erfolg errungen, als sie den Beweis<br />
auch auf dem neuen Gebiet der Marinegeschütze<br />
erbracht hat.“<br />
Das Schicksal der „Königsberg“ ist<br />
bekannt: Nach mehreren Einsätzen<br />
u.a. im Spanischen Bürgerkrieg 1936 –<br />
in dieser Zeit tat der junge Marinerichter<br />
Otto Kranzbühler, der viele Jahre<br />
später Aufsichtsratsvorsitzender von<br />
Rheinmetall werden sollte, Dienst auf<br />
der „Königsberg“ – oder beim Polenfeldzug<br />
1939 sank der Kreuzer am 10.<br />
April 1940 während der Operation<br />
„Weserübung“ (der Besetzung Norwegens)<br />
nach der Beschießung durch<br />
norwegische Küstenbatterien und britische<br />
Sturzkampfbomber vor Bergen.<br />
N<br />
Nach dem Aufbau der Bundeswehr<br />
1955 und der<br />
deutschen Wiederbewaffnung<br />
im Rahmen der Nato<br />
wurde die neugegründete<br />
Rheinmetall GmbH vor allen Dingen<br />
für die Heerestechnik tätig. Marineaufträge<br />
gehörten nicht mehr zum<br />
Standardprogramm des Düsseldorfer<br />
Wehrtechnikunternehmens. Zum<br />
Teil konnte die (damalige) Bundesmarine<br />
jedoch von Aufträgen, die<br />
das Heer erteilt hatte, profitieren,<br />
beispielsweise beim Einsatz sogenannter<br />
Schlingerstände. Dabei<br />
handelte es sich um Simulationsanlagen,<br />
mit deren Hilfe sowohl das<br />
Schießen vom fahrenden Panzer als<br />
auch vom schlingernden Schiff<br />
nachgeahmt und geübt werden<br />
konnte.<br />
Ganz ohne Rheinmetall-Produkte<br />
kam aber auch die Marine nicht aus:<br />
Eine der gefragtesten Geschütztypen<br />
neben den 105-mm- und 120mm-Waffenanlagen<br />
für die Kampf-<br />
Mit dem Stapellauf des britischen Kriegsschiffes „Dreadnought“ 1906 setzte ein<br />
Wettrüsten zur See ein, das in wenigen Jahren britische und deutsche Schlachtschiffe<br />
in immer größerer Zahl, höherer Fahrgeschwindigkeit, stärkerer Panzerung<br />
und mit immer mehr Geschützen von immer größerem Kaliber hervorbrachte.<br />
Auch die anderen Kreuzer der „K-<br />
Klasse“ – neben der „Königsberg“ die<br />
Kreuzer „Köln“ und „Karlsruhe“ – sowie<br />
die späteren Kreuzer „Leipzig“<br />
und „Nürnberg“ waren im Mittelkaliberbereich<br />
vom 15-cm-Drillingsgeschütz<br />
abwärts mit allen nötigen Kanonen<br />
und den dazugehörigen Einrichtungen<br />
ausgestattet. Dazu gehörten<br />
auch die damals bekannten Feuerleiteinrichtungen<br />
der Firma Zeiss in Jena,<br />
die bei dieser Gelegenheit erstmals<br />
in der Praxis eingesetzt wurden.<br />
Der Großkaliberbereich blieb dagegen<br />
die Domäne des großen Essener<br />
Konkurrenten Krupp. Die größten deutschen<br />
Kriegsschiffe, die „Bismarck“<br />
und die „Tirpitz“, beide 1939 vom Stapel<br />
gelaufen, waren ebenfalls mit<br />
Krupp-Großkaliber- und Rheinmetall-<br />
Borsig-Mittelkalibergeschützen bewaffnet,<br />
mit deren Hilfe sich die „Bismarck“<br />
in ihrem berühmt gewordenen Abwehrkampf<br />
1944 – wenn auch schließlich<br />
vergeblich – verteidigte.<br />
Die Rheinmetall-Marinetechnik kam<br />
allerdings nicht nur der Deutschen<br />
Reichsmarine zugute, für deren leichte<br />
und mittlere Artillerie die Rheinmetall-<br />
Borsig <strong>AG</strong> vor und während des Zweiten<br />
Weltkrieges Alleinlieferant geworden<br />
war. Auch zahlreiche ausländische<br />
Kunden profitierten von dem<br />
mittlerweile gewachsenen Know-how,<br />
panzerfamilie Leopard war seit den<br />
sechziger Jahren die 20-mm-Kanone<br />
Rh 202. Diese fand nicht nur in der<br />
Heeresbewaffnung ihren Platz, sondern<br />
wurde auch als Schiffskanone<br />
produziert und eingesetzt.<br />
Das aktuelle Engagement auf dem<br />
Gebiet der Marinebewaffnung beruht<br />
vor allem auf der Tradition der<br />
Mauser-Werke in Oberndorf. Neben<br />
der Pistolen- und Gewehrherstel-<br />
lung produzierte Mauser bereits<br />
während der beiden Weltkriege<br />
auch Schiffsgeschütze im Mittelkaliberbereich<br />
– zum Teil im Auftrag von<br />
Rheinmetall-Borsig. Anfang der<br />
siebziger Jahre gelang den Mauser-<br />
Werken der Einstieg in das 27mm-<br />
Kaliber,und zwar konkret durch die<br />
Entwicklung einer automatischen<br />
Revolverkanone für das Tornado-<br />
Kampfflugzeug.<br />
das das Unternehmen in der Panzerung<br />
und im Mittelkaliberbereich sowie<br />
bei der Munition besaß. Bereits<br />
1932 schlossen Rheinmetall, Krupp<br />
und die schwedische Rüstungsfirma<br />
Bofors ein „Gentlemen’s Agreement“<br />
über eine Verständigung bei Auslandswaffengeschäften,<br />
und zwar sowohl<br />
für Heeres- als auch für Marinewaffen.<br />
Selbst während des Zweiten<br />
Weltkrieges existierte ein umfangreiches<br />
Auslandsgeschäft mit befreundeten<br />
oder neutralen Staaten, das in vielen<br />
Fällen über eine eigene Schweizer<br />
Firma in Solothurn abgewickelt wurde:<br />
Noch vor der deutschen Besetzung<br />
1940 bemühte sich die Gesellschaft<br />
um Aufträge aus den Niederlanden,<br />
die Panzerschiffe für ihre Kolonien und<br />
eine neuartige U-Boots-Bewaffnung<br />
benötigten. Wenn auch die Firma<br />
Krupp bei den Panzerschiffen Rheinmetall-Borsig<br />
den Auftrag wegnehmen<br />
konnte - bei der U-Boot-Bewaffnung<br />
kam letztere schließlich zum Zuge. Außerdem<br />
wurden 1941 Doppelflaks für<br />
Kreuzer der sowjetischen Kriegsmarine,<br />
Flakgeräte an die spanische und<br />
die argentinische Marine sowie Munition<br />
an die Kaiserlich Japanische Marine<br />
geliefert. Der Plan einer regelrechten<br />
Kooperation zwischen Rheinmetall-Borsig<br />
und der Spanischen Kriegsmarine<br />
scheiterte jedoch 1943.<br />
Dr. Christian Leitzbach<br />
Einige Jahre später folgten die automatischen<br />
Maschinenkanonen in den<br />
Kalibern 25 mm und 30 mm; die MK<br />
30-1 wird auch heute noch auf den<br />
Schnellbooten der italienischen Zollpolizei<br />
„Guardia di Finanza“ und bei<br />
der französischen Marine eingesetzt.<br />
Neueste Mauser-Entwicklung dieser<br />
Art ist das Marineleichtgeschütz MLG<br />
27 - basierend auf der international<br />
eingeführten 27-mm-Flugzeugbord-<br />
Präsenz in der Marinebewaffnung<br />
kanone – einschließlich der dazugehörigen<br />
27-mm-FAPDS-Munition, das<br />
bei der Deutschen Marine nach und<br />
nach die Rheinmetall-Kanone 20mm-Rh-202<br />
und die 40mm-Kanone<br />
Bofors 40L70 ersetzen wird. (Wie sich<br />
die Marinetechnik von Rheinmetall-<br />
Defence heute in den internationalen<br />
Märkten darstellt, darüber berichtet<br />
„Das <strong>Profil</strong>“ in einer der nächsten<br />
Ausgaben.) lb








![PDF [1.0 MB] - KSPG AG](https://img.yumpu.com/5513074/1/171x260/pdf-10-mb-kspg-ag.jpg?quality=85)