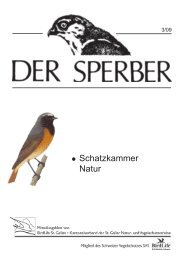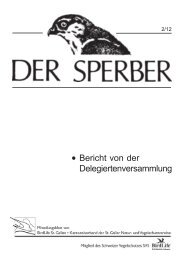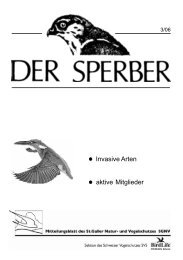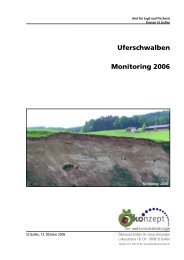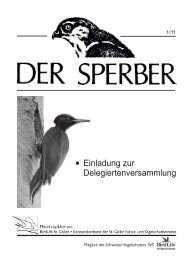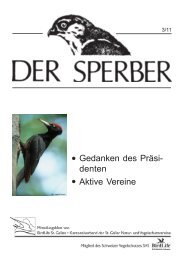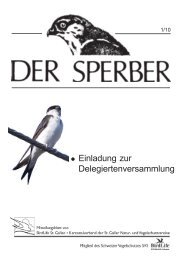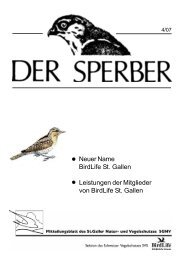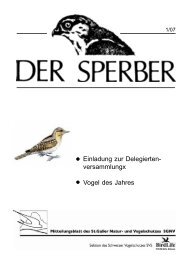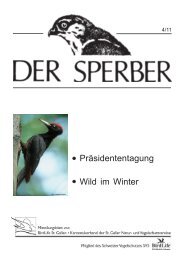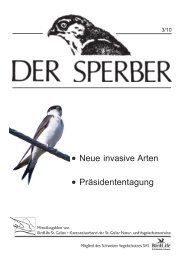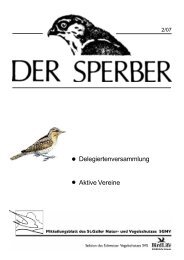Sperber 2/08 - BirdLife St.Gallen
Sperber 2/08 - BirdLife St.Gallen
Sperber 2/08 - BirdLife St.Gallen
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Auerhuhnschutz<br />
Wildschweinen kümmern darf, sondern<br />
auch die ethische Pflicht zur Erhaltung<br />
der nicht mehr jagdbaren Raufusshühner<br />
mit vollem Engagement wahrnehmen<br />
soll. Eine ausgestorbene Auerhuhnpopulation<br />
kann kaum mehr wieder hergestellt<br />
werden.<br />
Wissen als Voraussetzung für Effizienz<br />
Dr. Kurt Bollmann stellte das neu gestartete<br />
Projekt zur Untersuchung der Regionalpopulation<br />
Toggenburg vor. Die Wissenschaft<br />
arbeitet heute mit der genetischen<br />
Analyse von Kotproben. Für das<br />
Schwägalpgebiet besteht eine Kotsammlung<br />
seit dem Jahr 2000, welche<br />
auf verschiedene Fragen der Bestandesentwicklung,<br />
der Lebenserwartung, des<br />
Bruterfolges usw. eine Antwort geben<br />
kann. Gut fundierte Kenntnisse sind<br />
wichtig, um beim Auerhuhnschutz keine<br />
Blindschüsse abzugeben, welche zwar<br />
den Zaunkönig aber nicht das Auerhuhn<br />
fördern. Nur gezielte Massnahmen am<br />
richtigen Ort im richtigen Massstab sind<br />
Erfolg versprechend. Wir sind auf das<br />
Resultat gespannt.<br />
Auerhuhnim Winter<br />
Anschliessend referierte Forstingenieur<br />
Beat Fritsche über die Entwicklung der<br />
16<br />
Wälder auf der Schwägalp im 20. Jahrhundert<br />
und ihre Bedeutung für den Lebensraum<br />
des Auerhuhns.<br />
Als Ursache für die starke Abnahme der<br />
Auerhuhnbestände im letzten Jahrhundert<br />
wird hauptsächlich die Veränderung<br />
des Waldes als Lebensraum genannt.<br />
Beat Fritsche hat in seiner Diplomarbeit<br />
den relativ eng umgrenzten Lebensraum<br />
der Wälder im weiteren Bereich der<br />
Schwägalp anhand von Luftbildern von<br />
1932/35, 1960 und 1999 nach verschiedenen<br />
massgebenden Faktoren, welche<br />
gesamthaft die Habitateignung kennzeichnen,<br />
untersucht, um die wesentlichen<br />
Veränderungen nachzuweisen. Die<br />
statistische Auswertung der sehr detaillierten<br />
Erhebungen ergab aber, dass sich<br />
die geeignete Habitatfläche über den<br />
gesamten Untersuchungszeitraum nur<br />
schwach verringert hat. Diese leichte<br />
Abnahme kann kaum den sehr starken<br />
Rückgang des Auerhuhnbestandes erklären.<br />
Er vermutet, dass eine Kombination<br />
der drei Faktoren Habitatverlust,<br />
<strong>St</strong>örungen und Prädation für den Rückgang<br />
der Auerhuhnpopulation verantwortlich<br />
ist. Im genannten Gebiet werden<br />
heute grosse Anstrengungen unternommen,<br />
um die Lebensräume aufzuwerten.<br />
Für das Kreisalpengebiet besteht seit<br />
2004 ein Sonderwaldreservat. Auch der<br />
Kanton Appenzell Ausserrhoden hat ein<br />
Artenförderungsprojekt Auer- und Birkhuhn<br />
im angrenzenden Gebiet erarbeitet<br />
und mit dessen Umsetzung begonnen.<br />
In beiden Gebieten wird mit entsprechenden<br />
Schutzverordnungen versucht,<br />
die <strong>St</strong>örungen durch Besucherlenkungen<br />
zu minimieren. Leider konnte bis jetzt<br />
das Problem der stark erhöhten Bestän-<br />
2 Der <strong>Sperber</strong> 2/<strong>08</strong>