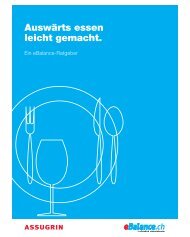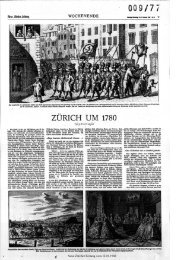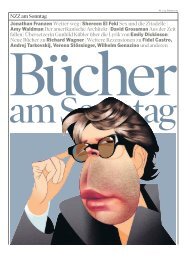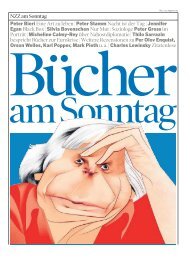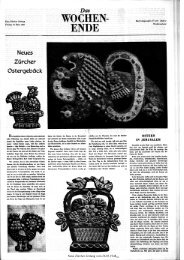Charles Dickens Essay von Andreas Isenschmid - Neue Zürcher ...
Charles Dickens Essay von Andreas Isenschmid - Neue Zürcher ...
Charles Dickens Essay von Andreas Isenschmid - Neue Zürcher ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Sachbuch<br />
Aufklärung Gedankenfreiheit und Mündigkeit sind nicht<br />
allein europäische, sondern universelle Werte<br />
Locke, Voltaire,<br />
Kant und andere<br />
Provokateure<br />
Manfred Geier: Aufklärung – Das<br />
europäische Projekt. Rowohlt,<br />
Reinbek 2012. 352 Seiten, Fr. 35.50.<br />
Von Katja Gentinetta<br />
Der Sprach- und Literaturwissenschafter<br />
Manfred Geier legt eine umfangreiche<br />
und wohldokumentierte Geschichte<br />
der Aufklärung vor. Mit der Charakterisierung<br />
der Aufklärung als «europäisches<br />
Projekt» fragt er gleich zu Beginn:<br />
Ist die Aufklärung abgeschlossen? Und:<br />
ist sie universell? Der Ausflug in die Geschichte<br />
lohnt sich.<br />
Anhand der zentralen Figuren John<br />
Locke und dem Third Earl of Shaftesbury<br />
(Anthony Ashley Cooper war ein Philosoph<br />
des frühen 18. Jahrhunderts),<br />
Voltaire und Jean-Jacques Rousseau,<br />
Moses Mendelssohn, Olympe de<br />
Gouges, Wilhelm <strong>von</strong> Humboldt und natürlich<br />
Immanuel Kant, zeichnet der<br />
Autor die philosophische Dynamik des<br />
18. Jahrhunderts nach und füllt die Aufklärung<br />
mit Leben.<br />
Die Geschichte beginnt in England,<br />
und sie beginnt mit einem Abenteuer:<br />
mit Lockes umfangreichen Schriften,<br />
die er bei seiner Rückkehr aus dem holländischen<br />
Exil nach England verpackt<br />
und verschifft hatte – ohne freilich eine<br />
Kopie derselben zu haben. Die Texte<br />
kamen heil an, und mit seinem Plädoyer<br />
für «life, liberty and estate» – der These,<br />
dass sich die Menschen «zum gegenseitigen<br />
Schutz ihres Lebens, ihrer Freiheiten<br />
und ihres Vermögens» zusammengeschlossen<br />
hätten – wird Locke zum<br />
Philosophen der «Glorious Revolution»,<br />
jenes friedlichen Übergangs zur<br />
konstitutionellen Monarchie.<br />
Unter Einsatz des Lebens<br />
Überhaupt ruft das Buch <strong>von</strong> Manfred<br />
Geier in Erinnerung, dass die Gedanken<br />
der Aufklärung nicht einfach in häuslicher<br />
Abgeschiedenheit entwickelt wurden,<br />
um dann ihren natürlichen und ungehinderten<br />
Weg an die Öffentlichkeit<br />
zu finden. Im Gegenteil: Unter teilweisem<br />
Einsatz ihres Lebens entschlossen<br />
sich die Aufklärer, ihre provozierenden<br />
Erkenntnisse zu publizieren. So flüchtet<br />
Locke 1683 ins holländische Exil, um<br />
seine «Discourses Concerning Government»<br />
fertig zu stellen. Voltaires «Lettres<br />
philosophiques», ein Loblied auf die<br />
politische, wirtschaftliche und geistige<br />
18 ❘ NZZ am Sonntag ❘ 29. Januar 2012<br />
Freiheit Englands, werden 1734 in Frankreich<br />
verurteilt, und gegen ihn ergeht<br />
ein Haftbefehl. Diderots «Pensées philosophiques»<br />
werden verbrannt, er<br />
selbst 1749 ins Gefängnis <strong>von</strong> Vincennes<br />
gesteckt. Weil er seine Autorschaft gesteht,<br />
und weil die Verleger der Enzyklopädie<br />
intervenieren, werden ihm<br />
schliesslich Schriftverkehr und Besuche<br />
doch erlaubt.<br />
Die «Encyclopédie» wird später nicht<br />
nur in Frankreich verboten, sondern<br />
auch vom Papst auf den Index gesetzt;<br />
katholischen Besitzern droht die Exkommunikation.<br />
Die Einschätzung dieses<br />
28 Bände umfassenden, in 25 Jahren<br />
<strong>von</strong> mehreren hundert Autoren verfassten<br />
Werks durch die Obrigkeit hätte unmissverständlicher<br />
nicht sein können:<br />
«Die Vorteile eines solchen Werks für<br />
Künste und Wissenschaften können den<br />
irreparablen Schaden für Glauben und<br />
Sittlichkeit niemals aufwiegen.»<br />
Gleichberechtigung für alle<br />
Welche Rolle der Glaube und die Religionszugehörigkeit<br />
– immerhin 150 Jahre<br />
nach der Reformation – noch spielten,<br />
beschreibt Manfred Geier anhand des<br />
Schicksals <strong>von</strong> Moses Mendelssohn.<br />
Dieser Unternehmer und Philosoph, der<br />
in Berlin vom «sans papier» zum angesehenen<br />
Bürger aufstieg, musste sich,<br />
aufgefordert vom <strong>Zürcher</strong> Theologen<br />
Johann Caspar Lavater, öffentlich zu seinem<br />
Judentum bekennen, ohne freilich<br />
das Christentum angreifen zu dürfen.<br />
Lavaters Fehdehandschuh war nichts<br />
weniger als die Rückkehr hinter die <strong>von</strong><br />
John Locke postulierte Gewissensfreiheit<br />
in Glaubensangelegenheiten. Für<br />
diesen war zwar eine Moral ohne Gott<br />
nicht vorstellbar, wohl aber eine ohne<br />
kirchliche Unterweisung, womit er die<br />
Autorität der Institution Kirche untergrub.<br />
Dass die Gedankenfreiheit auch für<br />
Frauen galt, war beileibe keine Selbstverständlichkeit.<br />
So liessen die Enzyklopädisten<br />
keine Frauen als Autoren zu,<br />
und für Rousseau war, wie für Sophie in<br />
seinem Roman «Emile», jede Frau «dazu<br />
geschaffen, zu gefallen und sich zu unterwerfen».<br />
Geier illustriert diese ungleiche<br />
Aufklärung mit einem «Requiem<br />
auf eine mutige Frau», nämlich<br />
Olympe de Gouges, die 1793 in Paris<br />
guillotiniert wurde. Nur Kant hegte<br />
diesbezüglich keine Zweifel: Selbst<br />
wenn er die Frauen dem «schönen Ge-<br />
«Die Freiheit für das<br />
Volk»: Besucher<br />
vor dem bekannten<br />
Gemälde <strong>von</strong> Eugène<br />
Delacroix (1830) im<br />
Louvre in Paris.<br />
schlecht» zuordnete und die Männer<br />
dem «erhabenen»: Er ging <strong>von</strong> der<br />
Gleichberechtigung der Geschlechter<br />
aus. Den Schritt in die Mündigkeit sah er<br />
genauso für das «ganze schöne Geschlecht».<br />
Dem grossen Aufklärer Kant nähert<br />
sich Geier aus der Gegenwart, genauer,<br />
dem 11. September 2001 und der folgenden<br />
Auseinandersetzung, die sich um<br />
die Frage drehte, ob die europäische<br />
Aufklärung gescheitert sei. Jenseits des<br />
Atlantiks beschuldigte Robert Kagan die<br />
Europäer des falschen Glaubens an ein<br />
posthistorisches Paradies. Unter Bezugnahme<br />
auf Kants kurze Abhandlung<br />
«Vom ewigen Frieden» hielten Derrida,<br />
Habermas und Sloterdijk dagegen.<br />
Ralph Dahrendorf und Timothy Garton<br />
Ash versuchten zu vermitteln, indem sie<br />
Kant <strong>von</strong> Rousseau abgrenzten. Ein<br />
wahrer Philosophenstreit, der noch weitere<br />
Kreise zog – und mit dem Geier zuletzt<br />
illustriert, wie alltagsnah und notwendig<br />
Philosophie sein kann.<br />
Die Antwort auf die eingangs gestellten<br />
Fragen liefert das Buch explizit und<br />
implizit: Die historische Aufklärung war<br />
eine europäische; das Streben nach<br />
Mündigkeit aber ist universell und immerwährend.<br />
Gerade heute wieder erstreckt<br />
sich der Ruf der Aufklärung über<br />
den Globus. Und er verlangt, wie damals,<br />
Klarheit und vor allem Mut. ●<br />
Katja Gentinetta ist Lehrbeauftragte<br />
der Hochschule St. Gallen und<br />
Gesprächsleiterin «Sternstunde<br />
Philosophie» am Schweizer Fernsehen.<br />
BERTHOLD STEINHILBER / LAIF