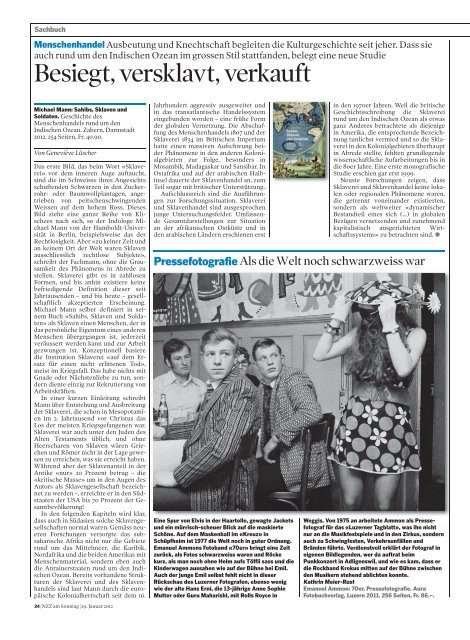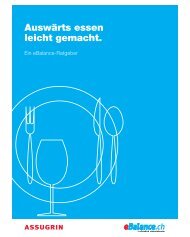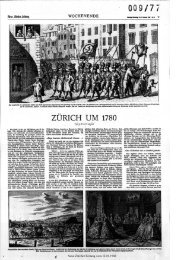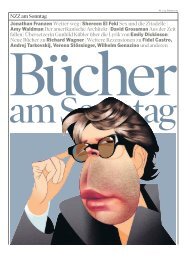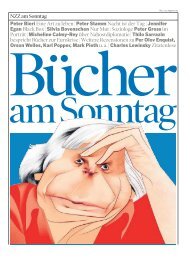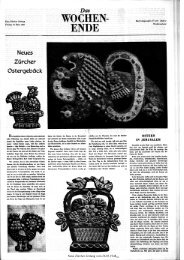Charles Dickens Essay von Andreas Isenschmid - Neue Zürcher ...
Charles Dickens Essay von Andreas Isenschmid - Neue Zürcher ...
Charles Dickens Essay von Andreas Isenschmid - Neue Zürcher ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Sachbuch<br />
Menschenhandel Ausbeutung und Knechtschaft begleiten die Kulturgeschichte seit jeher. Dass sie<br />
auch rund um den Indischen Ozean im grossen Stil stattfanden, belegt eine neue Studie<br />
Besiegt, versklavt, verkauft<br />
Michael Mann: Sahibs, Sklaven und<br />
Soldaten. Geschichte des<br />
Menschenhandels rund um den<br />
Indischen Ozean. Zabern, Darmstadt<br />
2012. 254 Seiten, Fr. 40.90.<br />
Von Geneviève Lüscher<br />
Das erste Bild, das beim Wort «Sklaverei»<br />
vor dem inneren Auge auftaucht,<br />
sind die im Schweisse ihres Angesichts<br />
schuftenden Schwarzen in den Zuckerrohr-<br />
oder Baumwollplantagen, angetrieben<br />
<strong>von</strong> peitschenschwingenden<br />
Weissen auf dem hohem Ross. Dieses<br />
Bild ziehe eine ganze Reihe <strong>von</strong> Klischees<br />
nach sich, so der Indologe Michael<br />
Mann <strong>von</strong> der Humboldt-Universität<br />
in Berlin, beispielsweise das der<br />
Rechtlosigkeit. Aber «zu keiner Zeit und<br />
an keinem Ort der Welt waren Sklaven<br />
ausschliesslich rechtlose Subjekte»,<br />
schreibt der Fachmann, ohne die Grausamkeit<br />
des Phänomens in Abrede zu<br />
stellen. Sklaverei gibt es in zahllosen<br />
Formen, und bis anhin existiere keine<br />
befriedigende Definition dieser seit<br />
Jahrtausenden – und bis heute – gesellschaftlich<br />
akzeptierten Erscheinung.<br />
Michael Mann selber definiert in seinem<br />
Buch «Sahibs, Sklaven und Soldaten»<br />
als Sklaven einen Menschen, der in<br />
das persönliche Eigentum eines anderen<br />
Menschen übergegangen ist, jederzeit<br />
veräussert werden kann und zur Arbeit<br />
gezwungen ist. Konzeptionell basiere<br />
die Institution Sklaverei «auf dem Ersatz<br />
für einen nicht erlittenen Tod»,<br />
meist im Kriegsfall. Das habe nichts mit<br />
Gnade oder Nächstenliebe zu tun, sondern<br />
diente einzig zur Rekrutierung <strong>von</strong><br />
Arbeitskräften.<br />
In einer kurzen Einleitung schreibt<br />
Mann über Entstehung und Ausbreitung<br />
der Sklaverei, die schon in Mesopotamien<br />
im 2. Jahrtausend vor Christus das<br />
Los der meisten Kriegsgefangenen war.<br />
Sklaverei war auch unter den Juden des<br />
Alten Testaments üblich, und ohne<br />
Heerscharen <strong>von</strong> Sklaven wären Griechen<br />
und Römer nicht in der Lage gewesen<br />
zu erreichen, was sie erreicht haben.<br />
Während aber der Sklavenanteil in der<br />
Antike «nur» 20 Prozent betrug – die<br />
«kritische Masse» um in den Augen des<br />
Autors als Sklavengesellschaft bezeichnet<br />
zu werden –, erreichte er in den Südstaaten<br />
der USA bis 70 Prozent der Gesamtbevölkerung!<br />
In den folgenden Kapiteln wird klar,<br />
dass auch in Südasien solche Sklavengesellschaften<br />
normal waren. Gemäss neueren<br />
Forschungen versorgte das sub-<br />
saharische Afrika nicht nur die Gebiete<br />
rund um das Mittelmeer, die Karibik,<br />
Nordafrika und die beiden Amerikas mit<br />
Menschenmaterial, sondern eben auch<br />
die Anrainerstaaten rund um den Indischen<br />
Ozean. Bereits vorhandene Strukturen<br />
der Sklaverei und des Sklavenhandels<br />
sind laut Mann durch die europäische<br />
Kolonialherrschaft seit dem 16.<br />
24 ❘ NZZ am Sonntag ❘ 29. Januar 2012<br />
Jahrhundert aggressiv ausgeweitet und<br />
in das transatlantische Handelssystem<br />
eingebunden worden – eine frühe Form<br />
der globalen Vernetzung. Die Abschaffung<br />
des Menschenhandels 1807 und der<br />
Sklaverei 1834 im Britischen Imperium<br />
hatte einen massiven Aufschwung beider<br />
Phänomene in den anderen Kolonialgebieten<br />
zur Folge, besonders in<br />
Mosambik, Madagaskar und Sansibar. In<br />
Ostafrika und auf der arabischen Halbinsel<br />
dauerte der Sklavenhandel an, zum<br />
Teil sogar mit britischer Unterstützung.<br />
Aufschlussreich sind die Ausführungen<br />
zur Forschungssituation. Sklaverei<br />
und Sklavenhandel sind ausgesprochen<br />
junge Untersuchungsfelder. Umfassende<br />
Gesamtdarstellungen zur Situation<br />
an der afrikanischen Ostküste und in<br />
den arabischen Ländern erschienen erst<br />
in den 1970er Jahren. Weil die britische<br />
Geschichtsschreibung die Sklaverei<br />
rund um den Indischen Ozean als etwas<br />
ganz Anderes betrachtete als diejenige<br />
in Amerika, die entsprechende Bezeichnung<br />
tunlichst vermied und so die Sklaverei<br />
in den Kolonialgebieten überhaupt<br />
in Abrede stellte, fehlten grundlegende<br />
wissenschaftliche Aufarbeitungen bis in<br />
die 80er Jahre. Eine erste monografische<br />
Studie erschien gar erst 1999.<br />
Neuste Forschungen zeigen, dass<br />
Sklaverei und Sklavenhandel keine lokalen<br />
oder regionalen Phänomene waren,<br />
die getrennt <strong>von</strong>einander existierten,<br />
sondern als weltweiter «dynamischer<br />
Bestandteil eines sich (...) in globalen<br />
Bezügen vernetzenden und zunehmend<br />
kapitalistisch ausgerichteten Wirtschaftssystems»<br />
zu betrachten sind. ●<br />
Pressefotografie Als die Welt noch schwarzweiss war<br />
Eine Spur <strong>von</strong> Elvis in der Haartolle, gewagte Jackets<br />
und ein mürrisch-scheuer Blick auf die maskierte<br />
Schöne. Auf dem Maskenball im «Kreuz» in<br />
Schüpfheim ist 1977 die Welt noch in guter Ordnung.<br />
Emanuel Ammons Fotoband «70er» bringt eine Zeit<br />
zurück, als Fotos schwarzweiss waren und Röcke<br />
kurz, als man noch ohne Helm aufs Töffli sass und die<br />
Kinderwagen aussahen wie auf der Bühne bei Emil.<br />
Auch der junge Emil selbst fehlt nicht in dieser<br />
Rückschau des Luzerner Fotografen, ebenso wenig<br />
wie der alte Hans Erni, die 13-jährige Anne Sophie<br />
Mutter oder Guru Maharishi, mit Rolls Royce in<br />
Weggis. Von 1975 an arbeitete Ammon als Pressefotograf<br />
für das «Luzerner Tagblatt», was ihn nicht<br />
nur an die Musikfestspiele und in den Zirkus, sondern<br />
auch zu Schwingfesten, Verkehrsunfällen und<br />
Bränden führte. Verdienstvoll erklärt der Fotograf in<br />
eigenen Bildlegenden, wer da auftrat beim<br />
Punkkonzert in Adligenswil, und wie es kam, dass er<br />
die Rockband Krokus mitten auf der Bühne zwischen<br />
den Musikern stehend ablichten konnte.<br />
Kathrin Meier-Rust<br />
Emanuel Ammon: 70er. Pressefotografie. Aura<br />
Fotobuchverlag, Luzern 2011. 256 Seiten, Fr. 86.–.