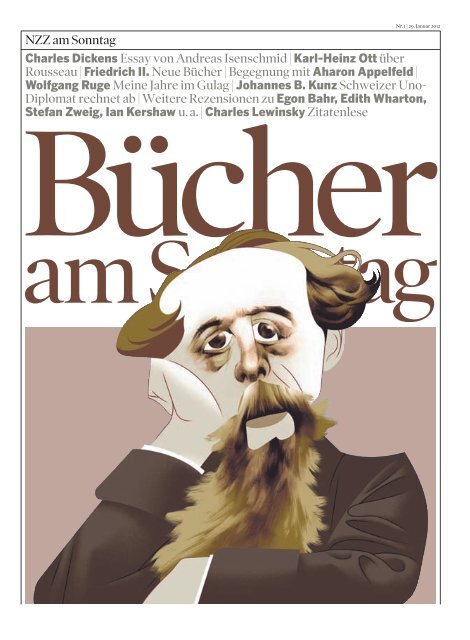Charles Dickens Essay von Andreas Isenschmid - Neue Zürcher ...
Charles Dickens Essay von Andreas Isenschmid - Neue Zürcher ...
Charles Dickens Essay von Andreas Isenschmid - Neue Zürcher ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Nr. 1 | 29. Januar 2012<br />
<strong>Charles</strong> <strong>Dickens</strong> <strong>Essay</strong> <strong>von</strong> <strong>Andreas</strong> <strong>Isenschmid</strong> | Karl-Heinz Ott über<br />
Rousseau | Friedrich II. <strong>Neue</strong> Bücher | Begegnung mit Aharon Appelfeld |<br />
Wolfgang Ruge Meine Jahre im Gulag | Johannes B. Kunz Schweizer Uno-<br />
Diplomat rechnet ab | Weitere Rezensionen zu Egon Bahr, Edith Wharton,<br />
Stefan Zweig, Ian Kershaw u. a. | <strong>Charles</strong> Lewinsky Zitatenlese
10CFWMIQ7DMBRDT5TIduI03YdTWVUwjYdUxbs_Wjo2YODnJ-97OOOX53a8t1cQqE50lRlenbW06FJGXQJkF6gH4epJyp-fwLUVlHE7syT2QSRr7kPWoO6HySy1_DmvL18AnUKAAAAA<br />
10CAsNsjY0MDAx1TU0NTEyNQQATFw5ng8AAAA=<br />
Lesetipp
Inhalt<br />
Der Ruf der<br />
Aufklärung ist<br />
nicht verhallt<br />
Belletristik<br />
4 Aharon Appelfeld: Der Mann, der nicht<br />
aufhörte zu schlafen<br />
Von Christoph Plate<br />
6 Edith Wharton: Ein altes Haus am Hudson<br />
River<br />
Von Pia Horlacher<br />
François Villon: Das Kleine und das Grosse<br />
Testament<br />
Von Stefana Sabin<br />
7 Karl-Heinz Ott: Wintzenried<br />
Von Martin Zingg<br />
8 Youssef Ziedan: Azazel<br />
Von Susanne Schanda<br />
9 «Jede Freundschaft mit mir ist verderblich».<br />
Joseph Roth und Stefan Zweig. Briefwechsel<br />
1927–1938<br />
Von Arnaldo Benini<br />
Markus Brüderlin: Die Kunst der<br />
Entschleunigung<br />
Von Gerhard Mack<br />
10 A. F. Th. van der Heijden: Tonio<br />
Von Sieglinde Geisel<br />
11 Stewart O’Nan: Emily, allein<br />
Von Simone <strong>von</strong> Büren<br />
Kurzkritiken Belletristik<br />
11 Katharina Hacker: Eine Dorfgeschichte<br />
Von Regula Freuler<br />
Iren Baumann: Noch während die Pendler<br />
heimfahren<br />
Von Manfred Papst<br />
Friedrich Achleitner: Iwahaubbt<br />
Von Manfred Papst<br />
Nancy Mitford: Landpartie mit drei Damen<br />
Von Regula Freuler<br />
<strong>Essay</strong><br />
Nr. 1 | 29. Januar 2012<br />
<strong>Charles</strong> <strong>Dickens</strong> <strong>Essay</strong> <strong>von</strong> <strong>Andreas</strong> <strong>Isenschmid</strong> | Karl-Heinz Ott über<br />
Rousseau | Friedrich II. <strong>Neue</strong> Bücher | Begegnung mit Aharon Appelfeld |<br />
Wolfgang Ruge Meine Jahre im Gulag | Johannes B. Kunz Schweizer Uno-<br />
Diplomat rechnet ab | Weitere Rezensionen zu Egon Bahr, Edith Wharton,<br />
Stefan Zweig, Ian Kershaw u. a. | <strong>Charles</strong> Lewinsky Zitatenlese<br />
<strong>Charles</strong> <strong>Dickens</strong><br />
(Seite 12).<br />
Illustration <strong>von</strong><br />
André Carrilho<br />
12 <strong>Charles</strong> <strong>Dickens</strong>, Schriftsteller<br />
Verliebt in die Romane eines 200-Jährigen<br />
Von <strong>Andreas</strong> <strong>Isenschmid</strong><br />
Der Kampf um Gedankenfreiheit ist ein aufregendes, ja gefährliches<br />
Unterfangen. John Locke musste ins Exil fliehen, um seine «Discourses<br />
Concerning Government» fertig zu stellen. Voltaires Schriften wurden<br />
verboten, Diderots Werke verbrannt, die «Encyclopédie» auf den Index<br />
gesetzt. Im 18. Jahrhundert wurden Philosophen oft gejagt, geächtet,<br />
inhaftiert. Auch heute erfordert der Ausbruch aus der Unmündigkeit<br />
Courage, wie Manfred Geier in seinem neuen Buch «Aufklärung – Das<br />
europäische Projekt» beschreibt (Seite 18). Vom turbulenten Leben des<br />
Genfer Aufklärers Jean-Jacques Rousseau, dem wichtigen Wegbereiter<br />
der Französischen Revolution, und seiner pädagogisch-erotischen<br />
Lehrmeisterin Madame de Warens erzählt anderseits Karl-Heinz Ott in<br />
seinem grandiosen Roman «Wintzenried» (S. 7).<br />
Einer, der Toleranz hochhielt und verfolgten Autoren Asyl gewährte,<br />
war Preussenkönig Friedrich der Grosse. Das historische Urteil über<br />
ihn fällt heute, im Jahr seines 300. Geburtstages, differenzierter aus, so<br />
zeigt unsere Rezension der neusten Publikationen (S. 16).<br />
Botschafter Paul Widmer bespricht das «gescheite und mutige Buch»<br />
seines Kollegen Johannes B. Kunz: ein Plädoyer gegen den drohenden<br />
Souveränitätsverlust und eine kritische Bilanz humanitärer Uno-<br />
Einsätze (S. 20). Dies und auch Leichteres finden Sie, liebe Leserinnen<br />
und Leser, auf den folgenden Seiten. Urs Rauber<br />
Kolumne<br />
Malik Ambar aus Sudan (1550–1626).<br />
Aus Michael Mann: Sahibs, Sklaven<br />
und Soldaten (S. 24).<br />
15 <strong>Charles</strong> Lewinsky<br />
Das Zitat <strong>von</strong> Ludwig Börne<br />
Kurzkritiken Sachbuch<br />
15 Esther Girsberger: Eveline Widmer-Schlumpf<br />
Von Urs Rauber<br />
Otto Stich: Ich blieb einfach einfach<br />
Von Urs Rauber<br />
Philipp Blom: Angelo Soliman<br />
Von Geneviève Lüscher<br />
Daniela Kuhn: Zwischen Stall und Hotel<br />
Von Kathrin Meier-Rust<br />
Sachbuch<br />
16 Christian <strong>von</strong> Krockow: Friedrich der Grosse<br />
Ute Frevert: Gefühlspolitik<br />
Johannes Bronisch: Der Kampf um Kronprinz<br />
Friedrich<br />
Von Kathrin Meier-Rust<br />
18 Manfred Geier: Aufklärung – Das europäische<br />
Projekt<br />
Von Katja Gentinetta<br />
19 Peter Michael Keller: Cabaret Cornichon<br />
Von Urs Bitterli<br />
Bernd Brunner: Der Mond<br />
Von Thomas Köster<br />
20 Johannes B. Kunz: Der letzte Souverän und<br />
das Ende der Freiheit<br />
Von Paul Widmer<br />
Amy Stewart: Gemeine Gewächse<br />
Von André Behr<br />
21 Wolfgang Ruge: Gelobtes Land<br />
Von Urs Rauber<br />
22 Egon Bahr, Peter Ensikat: Gedächtnislücken<br />
Von Gerd Kolbe<br />
Ian Kershaw: Das Ende<br />
Von Markus Schär<br />
23 Heiner Boehncke, Hans Sarkowicz:<br />
Grimmelshausen<br />
Von Manfred Koch<br />
24 Michael Mann: Sahibs, Sklaven und Soldaten<br />
Von Geneviève Lüscher<br />
Emanuel Ammon: 70er<br />
Von Kathrin Meier-Rust<br />
25 Thomas Buomberger, Peter Pfrunder:<br />
Schöner leben, mehr haben<br />
Von Martin Walder<br />
26 Klaus Töpfer, Ranga Yogeshwar: Unsere<br />
Zukunft<br />
Von Patrick Imhasly<br />
Das amerikanische Buch<br />
Derek Chollet, Samantha Power: The Quiet<br />
American. Richard Holbrooke in the World<br />
Von <strong>Andreas</strong> Mink<br />
Agenda<br />
27 Olivia Harrison: George Harrison<br />
Von Manfred Papst<br />
Bestseller Januar 2012<br />
Belletristik und Sachbuch<br />
Agenda Februar 2012<br />
Veranstaltungshinweise<br />
Chefredaktion Felix E. Müller (fem.) Redaktion Urs Rauber (ura.) (Leitung), Regula Freuler (ruf.), Geneviève Lüscher (glü.), Kathrin Meier-Rust (kmr.), Manfred Papst (pap.)<br />
Ständige Mitarbeit Urs Altermatt, Urs Bitterli, <strong>Andreas</strong> <strong>Isenschmid</strong>, Manfred Koch, Gunhild Kübler, <strong>Charles</strong> Lewinsky, Beatrix Mesmer, <strong>Andreas</strong> Mink, Klara Obermüller, Angelika Overath,<br />
Stefan Zweifel Produktion Eveline Roth, Hans Peter Hösli (Art-Director), Urs Schilliger (Bildredaktion), Felix Eberlein (Layout), Korrektorat St. Galler Tagblatt AG<br />
Verlag NZZ am Sonntag, «Bücher am Sonntag», Postfach, 8021 Zürich. Telefon 044 258 11 11, Fax 044 261 70 70, E-Mail: redaktion.sonntag@nzz.ch<br />
29. Januar 2012 ❘ NZZ am Sonntag ❘ 3
Belletristik<br />
Roman Zum 80. Geburtstag Aharon Appelfelds erscheint sein neues autobiografisches<br />
Buch. Darin beschwört er die jüdische Vergangenheit und Israels Gegenwart<br />
<strong>Neue</strong> Melodien in<br />
einer alten Sprache<br />
Aharon Appelfeld: Der Mann, der nicht<br />
aufhörte zu schlafen. Aus dem<br />
Hebräischen <strong>von</strong> Mirijam Pressler.<br />
Rowohlt, Berlin 2012. 285 Seiten, Fr. 28.50.<br />
Von Christoph Plate<br />
Als Hebräisch zu seiner neuen Muttersprache<br />
wurde, wäre er fast verstummt.<br />
Weil er immer noch auf Deutsch und<br />
Jiddisch dachte und weil sie ihn zwangen,<br />
die neue Sprache zu benutzen.<br />
Heute, 66 Jahre nach seiner Ankunft in<br />
diesem Land, mag er Hebräisch. Die<br />
Sprache ist alt, voller Bilder, und sie lebt,<br />
auch wenn geschwiegen wird.<br />
Es ist laut. Wir sitzen im Restaurant<br />
des Tichu-House, einer Galerie im Zentrum<br />
Jerusalems. Die jungen Frauen am<br />
Nachbartisch, leicht übergewichtig und<br />
etwas zu stark geschminkt, sind so lärmig,<br />
dass Aharon Appelfeld immer wieder<br />
einmal sanft strafend hinüberschaut.<br />
Dann essen wir weiter, schauen uns an,<br />
reden, bis die Frauen nebenan wieder<br />
laut werden. Vor über 50 Jahren war der<br />
heute 80-Jährige zum ersten Mal hier.<br />
Der Philosoph Martin Buber brachte ihn<br />
ins Haus <strong>von</strong> Anna Tichu, der malenden<br />
Frau eines Wiener Augenarztes. «Freitags<br />
gab es Apfelstrudel mit Sahne und<br />
Kaffee, zwei Dutzend Intellektuelle<br />
waren da, ich war zu schüchtern, um<br />
auch nur etwas zu sagen», erklärt Appelfeld.<br />
Er zeigt die breiten Ledersessel,<br />
in denen sie damals sassen.<br />
Kandidat für den Nobelpreis<br />
Heute gehört das Haus der Museumsgesellschaft,<br />
Appelfeld kommt gern<br />
hierher, plaudert mit den Sicherheitsleuten<br />
am Eingang, und die Serviertöchter<br />
begegnen ihm mit einer Ehrfurcht,<br />
als wüssten sie, dass dieser Mann mit<br />
der blauen Schiebermütze auf dem kahlen<br />
Schädel immer wieder ein Kandidat<br />
für den Literaturnobelpreis ist.<br />
Sein neues, bei Rowohlt auf Deutsch<br />
erschienenes Buch «Der Mann, der<br />
nicht aufhörte zu schlafen» ist eine<br />
4 ❘ NZZ am Sonntag ❘ 29. Januar 2012<br />
Eloge auf das Leben, eine Danksagung<br />
an seine Eltern und ein Zeugnis da<strong>von</strong>,<br />
wie jemand sich eine neue Sprache erkämpfen<br />
muss. Zuhause in Czernowitz<br />
sprach man in der assimilierten jüdischen<br />
Familie Deutsch. Paul Celan<br />
wohnte in der gleichen Strasse. Damals<br />
war Czernowitz Schnittstelle zwischen<br />
Ost und West, heute liegt es vergessen<br />
im Südwesten der Ukraine, nahe der<br />
Grenze zu Rumänien.<br />
Träumt Appelfeld <strong>von</strong> seinen Eltern<br />
– die Mutter wurde <strong>von</strong> rumänischen<br />
Faschisten erschossen, der Vater überlebte<br />
den Holocaust und emigrierte<br />
nach Jahren in der Sowjetunion nach Israel<br />
–, dann spricht er das Deutsch eines<br />
8-Jährigen. Im Traum ist Aharon aber<br />
schon erwachsen, und der Vater macht<br />
sich lustig über dessen Kinderdeutsch.<br />
Zur Mutter sagt er: «Mama, ich habe<br />
eine neue Sprache.» Appelfeld teilt sein<br />
Aharon Appelfeld<br />
Geboren wurde Aharon Appelfeld am<br />
16.2.1932 in der Nähe <strong>von</strong> Czernowitz<br />
(damals Rumänien, heute Ukraine). Er<br />
wuchs in einem gut bürgerlichen Haushalt<br />
auf. Damals hiess er noch Erwin. Erst<br />
der Holocaust habe ihn zum Juden gemacht,<br />
sagt er. Er musste den Mord an<br />
seiner Mutter miterleben, wurde mit dem<br />
Vater zusammen ins Ghetto gesperrt und<br />
schlug sich später alleine bis nach Italien<br />
durch. Von dort gelang er 1946 nach Palästina.<br />
Diese traumatischen Erlebnisse<br />
sind die Triebfeder seines Schaffens.<br />
Seine Muttersprache war Deutsch, heute<br />
ist die für ihn wichtigste Sprache Hebräisch.<br />
Er arbeitete <strong>von</strong> 1975 bis 2001 als<br />
Literaturprofessor an der Ben Gurion<br />
Universität in Beerscheba. Zu seinen<br />
gros sen Romanen gehören: «Blumen der<br />
Finsternis», «Bis der Tag anbricht» und<br />
«Elternland». Für «Der eiserne Pfad»<br />
wurde er 1999 mit dem National Jewish<br />
Book Award ausgezeichnet.<br />
Croissant und strahlt zufrieden. Er<br />
trinkt koffeinfreien Kaffee, der aus<br />
einem altmodischen Tassenfilter tröpfelt.<br />
Dann bestellt er eine Gemüsesuppe,<br />
Osteuropäer liebten doch Suppen, obwohl<br />
diese hier längst nicht so gut sei,<br />
wie die im Café Sprüngli am Paradeplatz<br />
in Zürich.<br />
In «Der Mann, der nicht aufhörte zu<br />
schlafen» geht es um vieles. Um die<br />
Suche nach einer Melodie in der Sprache,<br />
um das Bewusstsein für die eigene<br />
Geschichte und die Bedeutung des Sich-<br />
Erinnerns, um die eigene Position in der<br />
Gegenwart zu bestimmen. Seit einigen<br />
Jahren bekommt Appelfeld Briefe <strong>von</strong><br />
israelischen Lesern, die schreiben, sie<br />
hätten ihre Eltern oder Grosseltern nie<br />
nach dem jüdischen Leben in Osteuropa<br />
und nach dem Holocaust gefragt.<br />
«Meine Bücher würden ihnen diese untergegangene<br />
Welt des Judentums, ihre<br />
Gerüche und Schönheit nahe bringen.»<br />
Liest er diese Briefe, zittert er manchmal<br />
vor Aufregung und Last. Ihm wird da<br />
eine Rolle zugedacht, die er gar nicht<br />
annehmen mag. Lange wurde Appelfeld<br />
vom literarischen Establishment gescholten,<br />
weil er keinen Agitprop<br />
schrieb, sondern die Geschichte jener<br />
erzählte, die nach dem Holocaust aus<br />
Europa nach Palästina gekommen<br />
waren. Das passte nicht nach Israel.<br />
Appelfeld hat damals festgestellt, dass<br />
«man als assimilierter Jude Weltbürger<br />
ist, während man als Israeli schnell provinziell<br />
wird».<br />
«Der Mann, der nicht aufhörte zu<br />
schlafen» ist ein autobiografischer<br />
Roman, wobei jedes seiner Bücher auch<br />
den Aharon Appelfeld zu enthalten<br />
scheint, der früher Erwin hiess. Aharon<br />
wurde in Czernowitz als Erwin geboren,<br />
als er mit ukrainischen Banditen<br />
umherzog, nannte er sich Janosch.<br />
Appelfeld ist überzeugt, dass jede Art<br />
<strong>von</strong> Äusserung eine Verstellung sei, die<br />
Literatur aber eine der am wenigsten<br />
verstellten Äusserungen. Es sind dies<br />
Erinnerungen, wie sie einige auch schon<br />
in seinem Buch «Die Geschichte eines
Lebens» vorkommen, nur sind sie jetzt<br />
vielfältiger, reflektierter, stärker ausgearbeitet.<br />
Der Ich-Erzähler schreibt <strong>von</strong><br />
der Kindheit, vom Holocaust, <strong>von</strong> der<br />
Flucht, <strong>von</strong> der beschützenden Wärme<br />
einer Hure am Strand <strong>von</strong> Neapel. Appelfeld<br />
durchläuft noch einmal seine<br />
Versuche, sich nach der Ankunft in Palästina<br />
und der Verwundung im Krieg<br />
gegen die Araber seine Identität zu erhalten.<br />
Es ist dies die Persönlichkeit<br />
eines Mannes, der Kleist und Stifter<br />
liest, um den Eltern nahe zu sein, die<br />
Bibel, um sich an seine religiösen Grosseltern<br />
zu erinnern, und Karl Marx, um<br />
auch seine kommunistischen Onkel zu<br />
würdigen.<br />
Vielleicht braucht es ein Leben als<br />
Philosoph, um scheinbar einfach zu<br />
schreiben, so wie er es tut. Ob er immer<br />
noch seine Manuskripte einige Jahre in<br />
die Schublade lege, um sie danach wieder<br />
zu bearbeiten, zu streichen und erst<br />
dann an den Verlag zu übergeben? «Ja,<br />
fünf Jahre müssen sie liegen», sagt er.<br />
Das mache er bis heute, «oder haben Sie<br />
etwa den Eindruck, ich hätte dafür keine<br />
Zeit?», fragt der bald 80-Jährige und<br />
lacht. Dann gehen wir hinauf in den ehemaligen<br />
Salon <strong>von</strong> Frau Tichu, in dem<br />
Aharon Appelfeld in die Intellektuellenszene<br />
<strong>von</strong> Jerusalem eingeführt worden<br />
war. «Diese Leute haben mich auf eine<br />
Art gerettet», sagt er und scheint sie alle<br />
dort sitzen zu sehen in den schweren<br />
Ledersesseln. Irgendwann hat er sich<br />
dann auch getraut mitzureden. Mit Hannah<br />
Ahrendt hat er gestritten, weil ihre<br />
Theorie <strong>von</strong> der Banalität des Bösen<br />
nicht zuträfe. Banal sei das Gute, das<br />
Böse dagegen sei ungemein kreativ. Er<br />
sei eigentlich immer ein Rebell gewesen,<br />
einer, der sich gegen Vereinnahmung<br />
gewehrt habe.<br />
Fiktion ist Wahrheit<br />
Appelfelds nur mit ein paar Strichen<br />
gezeichnete Charaktere haben oft noch<br />
Erde unter den Fingernägeln, sie sind<br />
einfache Leute, eine Prostituierte, ein<br />
Dorfschullehrer, eine Bäuerin, die alle<br />
auf ihre Art fähig sind, über den Rand<br />
der engen Dorfwelt hinauszuschauen.<br />
Appelfeld beschreibt den Verrat einiger<br />
Juden und Nichtjuden und erzählt <strong>von</strong><br />
der Menschlichkeit der anderen.<br />
Vielleicht ist es auch dieser Lebenswille,<br />
der den Mann, der nicht aufhörte<br />
zu schlafen, irgendwann aufwachen<br />
liess. Der Mann, der ein Junge war,<br />
wurde <strong>von</strong> den Überlebenden in Europa<br />
auf ihrer Wanderung nach Palästina<br />
immer weitergetragen, so wie Appelfelds<br />
Vater den Sohn auf einem der<br />
Todesmärsche getragen und geschoben<br />
hatte. Als der Junge Erwin dann in Palästina<br />
ist, begegnet er zum Glück auch<br />
solchen, die ihn so lassen, wie er ist, die<br />
nicht den neuen Juden schaffen wollen,<br />
der blond und blauäugig ist und sich nie<br />
mehr wird demütigen lassen müssen.<br />
Der Ich-Erzähler trifft auf Menschen,<br />
die sich an seinen Vater erinnern und an<br />
dessen literarische Ambitionen, auch an<br />
dessen Schock, als der das erste Mal<br />
Kafka las.<br />
Wenn ihm heute die Kinder und Enkel<br />
der Holocaust-Überlebenden schreiben,<br />
dann ist das natürlich nicht nur Last. Es<br />
ist auch späte Genugtuung für die harte<br />
Zeit, als der literarische Betrieb ihn zwar<br />
ehrte, aber nie ganz akzeptierte, weil der<br />
Rebell sich weigerte, seine Vergangenheit<br />
abzustreifen, so wie die anderen<br />
ihre Lagerkleidung abgelegt hatten.<br />
Appelfeld lächelt, während es an den<br />
Tischen noch lebhafter wird. Da kommen<br />
viele, auch orthodoxe Juden, sie<br />
essen Salat mit viel Knoblauch, Käsekuchen<br />
und Gemüsesuppe. Das Handy<br />
klingelt, die Frau des Autors ist dran. Die<br />
drei Kinder der Appelfelds sind Anwalt,<br />
Literaturwissenschafter und Maler geworden.<br />
Die Enkel, Teenager noch, lesen<br />
die Bücher des Grossvaters. Sie fragen,<br />
was Fiktion sei, ob er all das erlebt habe,<br />
ob er <strong>von</strong> einer Hure vor den Nazis versteckt<br />
wurde oder wie das war, den Cousin<br />
zu finden, dessen Vater konvertierte<br />
und der seine Mitte verlor. Und was<br />
antwortet er den Enkelinnen? «Dass die<br />
Fiktion die Wahrheit ist.» l<br />
Der neue Roman <strong>von</strong><br />
Aharon Appelfeld ist<br />
eine Danksagung an<br />
seine Eltern. Hier ein<br />
Bild aus dem Jahr<br />
2004 in Israel.<br />
29. Januar 2012 ❘ NZZ am Sonntag ❘ 5<br />
MICHA BAR AM / MAGNUM
Belletristik<br />
Klassiker Edith Whartons Porträt einer verhinderten<br />
Künstlerin liegt in der deutschen Erstübersetzung vor<br />
Zeiten der Unschuld<br />
Edith Wharton: Ein altes Haus am Hudson<br />
River. Aus dem Amerikanischen <strong>von</strong><br />
Andrea Ott. Manesse, München 2011.<br />
624 Seiten, Fr. 36.90.<br />
Von Pia Horlacher<br />
Jane Austen, Henry James, Edith Wharton<br />
– hätte man vor der Jahrtausendwende<br />
eine Prophezeiung gewagt, welche<br />
Art <strong>von</strong> Literaturverfilmungen auf<br />
das 21. Jahrhundert einstimmen würden,<br />
so wäre man wohl zuletzt auf diese<br />
Namen gestossen. Doch Zufall war es<br />
nicht. Nachdem Martin Scorsese 1993<br />
Whartons «The Age of Innocence», dieses<br />
Sittengemälde aus dem Goldenen<br />
Zeitalter New Yorks, zu einem Meisterwerk<br />
der Leinwand adaptiert hatte,<br />
ahnte man es: Scheinbar altmodische Literatur<br />
kann aktuelle Zeitfragen schärfer<br />
ausleuchten als vieles, was <strong>von</strong> Zeitgenossen<br />
produziert wird. Die Geschichte<br />
<strong>von</strong> der kapitalistischen Gier und deren<br />
Verheerungen wiederholt sich.<br />
Die <strong>Neue</strong>ngländerin aus bestem Haus<br />
mit dem unbestechlichen ethnologischen<br />
Blick auf ihre eigene Gesellschaft,<br />
begann erst mit vierzig zu schreiben –<br />
aus einer unglücklichen Ehe heraus, die<br />
sie oft auf Reisen trieb. Vor allem nach<br />
Europa; in Frankreich liess sie sich nach<br />
ihrer Scheidung nieder, dort liegt sie begraben.<br />
Beides, ihr Unglück und ihre<br />
Weltläufigkeit, sollte ihr viel Stoff bieten<br />
für Romane, die das Ersticken in der<br />
Enge und den Selbstverlust in der Flucht<br />
thematisieren. Vor allem aber den Untergang<br />
einer Gesellschaft, die zwischen<br />
müder Dekadenz und rasender Gier dahinsiecht<br />
und schliesslich in der grossen<br />
François Villon: Das Kleine und das Grosse<br />
Testament. Aus dem Französischen,<br />
mit einem Nachwort <strong>von</strong> Frank-Rutger<br />
Hausmann. Reclam, Leipzig 2011.<br />
145 Seiten, Fr. 11.90.<br />
Von Stefana Sabin<br />
Spätestens durch Brechts Refrain zu<br />
«Nannas Lied» (1939) ist die Frage «Wo<br />
ist der Schnee vom vergangenen Jahr?»<br />
sprichwörtlich geworden. Diese Frage<br />
hatte sich Brecht bei dem bedeutendsten<br />
Dichter des französischen Spätmittelalters<br />
geliehen, nämlich bei François<br />
Villon, dem Meister des parodistischsozialkritischen<br />
Gedichts.<br />
Villons Identität ist – wie diejenige<br />
Shakespeares – unklar. Er soll 1431 in<br />
Paris geboren und Anfang 1463, nach<br />
einem abenteuerlichen Leben, ver-<br />
6 ❘ NZZ am Sonntag ❘ 29. Januar 2012<br />
Depression <strong>von</strong> Börsen und Individuen<br />
zerfallen wird.<br />
So auch in ihrem Spätwerk aus dem<br />
Jahr 1929. Im alten Haus am Fluss, das<br />
unbewohnt, aber voller Geister der Erinnerung<br />
vor sich hinmodert, treffen<br />
sich zwei Sprösslinge, die aus parallelen<br />
Welten flüchten. Vance Weston, empfindsamer<br />
Sohn eines erfolgreichen Immobilienhändlers<br />
aus dem Mittleren<br />
Westen, und Halo Spear, intelligente<br />
Tochter einer verarmenden Bildungsbürgerfamilie<br />
aus der Oberschicht New<br />
Yorks. Im alten Haus, im Schatten reich<br />
bestückter Bücherwände und einer untergehenden<br />
Kultur des Geistes entfaltet<br />
sich eine Seelenverwandschaft und eine<br />
noch unerkannte Liebe, die selbst literarische<br />
Früchte tragen wird.<br />
Inspiriert <strong>von</strong> dieser exotischen Lebenswelt<br />
mausern sich Vances vage<br />
künstlerische Ambitionen zur ernsten<br />
Schriftstellerei; gleich sein erster Roman<br />
wird zum Überraschungserfolg. Halo,<br />
seine Türöffnerin in die literarische Gesellschaft<br />
der Ostküste, seine Muse,<br />
seine Lektorin und der eigentliche kreative<br />
Motor, muss es ihrem Geschlecht<br />
gemäss bei der Inspiration und der Arbeit<br />
im Hintergrund bewenden lassen.<br />
Der finanzielle Niedergang ihrer Familie<br />
drängt sie zum Opfer einer Heirat<br />
mit einem reichen Verehrer, in der sie<br />
zunehmend an Lebenskraft verliert.<br />
Das Unglück der beiden nimmt seinen<br />
Lauf. Am Ende dieser «Zeit der Unschuld»<br />
schwinden Vances Illusionen<br />
dahin im jahrelangen Lavieren zwischen<br />
Überheblichkeit und Opportunismus,<br />
zwischen «unmoralisch» in der Werbung<br />
verdientem Geld und bitterer<br />
Armut, während Halos Jugend und Ta-<br />
Die amerikanische<br />
Erzählerin Edith<br />
Wharton erhielt 1921<br />
den Pulitzer-Preis.<br />
Ballade François Villons Vermächtnis in einer frechen und geschmeidigen Neufassung<br />
Ein Vorbild der derben Sozialkritik<br />
schwunden sein. Lange hat man seine<br />
Gedichte autobiografisch gedeutet, aber<br />
inzwischen hat sich die These durchgesetzt,<br />
dass ein Pariser Jurist sich den<br />
Namen des Gauners François Villon zu<br />
eigen machte, um Justiz- und Institutionenschelte<br />
scharfzüngig zu versifizieren.<br />
Wer auch immer Villon war – seine<br />
Frechheit und sein Sprachwitz wurden<br />
traditionsbildend. Die französischen<br />
Symbolisten sahen in ihm den «poète<br />
truand» als Vorläufer des «poète maudit»,<br />
und für die deutschen Expressionisten<br />
wurde die derbe Sozialkritik vorbildlich.<br />
Als Villons Hauptwerk gelten die beiden<br />
«Testamente»: Es sind Gedichtzyklen,<br />
in denen das lyrische Ich ein Vagabund<br />
ist, der sein Leben am Rande der<br />
Gesellschaft beschreibt, über die Pariser<br />
Honoratioren herzieht und die Unmöglichkeit<br />
der reinen Liebe beklagt. «Das<br />
lent in der Düsternis einer traditionellen<br />
Ehe zusehends verblüht. So etwas<br />
wie ein «unhappy Happyend» zeichnet<br />
sich ab – 1932, wird Wharton die Fortsetzung<br />
der Geschichte präsentieren.<br />
Vordergründig ist das ein klassisches<br />
«portrait of the artist as a young man»,<br />
hintergründig das rare Porträt einer jungen<br />
Frau als verhinderte Künstlerin.<br />
Eingebettet in ein Tableau <strong>von</strong> Figuren,<br />
die sich zu einer zeitlosen Satire auf die<br />
Moden und Heucheleien des Kultur-<br />
und Literaturbetriebes versammeln, repräsentieren<br />
die beiden jungen Menschen<br />
eine Epoche der Verschiebungen<br />
zwischen alten und neuen Welten, wie<br />
sie uns, eine Jahrhundertwende später,<br />
durchaus vertraut scheinen. ●<br />
kleine Testament» verbindet Parodien<br />
höfischer Liebeslyrik mit satirischen Legaten<br />
an Amts- und Würdeträger. Nicht<br />
zuletzt die Politikerschelte, die darin<br />
steckt, macht die Verse bis heute aktuell.<br />
«Das grosse Testament» enthält selbstreflexive,<br />
elegische und satirische Verse,<br />
in die ausgeformte Balladen eingestreut<br />
sind – darunter die «Ballade der Frauen<br />
<strong>von</strong> einst», deren Refrain Brecht für<br />
«Nannas Lied» benutzte.<br />
Villons «Testamente» sind voller<br />
Anspielungen auf damalige Ereignisse<br />
und Figuren und in höchstem Mass<br />
sprachspielerisch, so dass Übersetzungen<br />
zum philologisch-ästhetischen<br />
Abenteuer werden. Darauf hat sich<br />
der Freiburger Romanist Frank-Rutger<br />
Hausmann eingelassen und eine rhythmisierte<br />
deutsche Fassung geschaffen,<br />
die die Frechheit und die Geschmeidigkeit<br />
des Originals erhält. ●<br />
LEBRECHT MUSIC & ARTS
Roman Der deutsche Schriftsteller Karl-Heinz Ott zeichnet das Leben Rousseaus fulminant nach<br />
Er stürzte sich in die Wirren<br />
seiner Epoche<br />
Karl-Heinz Ott: Wintzenried. Hoffmann<br />
und Campe, Hamburg 2011. 207 Seiten,<br />
Fr. 30.50.<br />
Von Martin Zingg<br />
Ohne ihn wäre alles anders gekommen.<br />
Ohne Wintzenried hätte der junge Jean-<br />
Jacques Rousseau seinen Platz im Herzen<br />
und im Bett <strong>von</strong> «Mama» nicht verloren:<br />
Es wäre ihm erspart geblieben, in<br />
die weite Welt hinaus zu ziehen und sich<br />
in Unternehmungen zu stürzen, deren<br />
Ende nicht abzusehen war.<br />
«Mama» ist Madame de Warens. Bei<br />
ihr, der dreizehn Jahre Älteren, kommt<br />
der junge Jean-Jacques im Alter <strong>von</strong><br />
sechzehn Jahren unter. Hinter ihm liegen<br />
schwierige Zeiten. Seine Mutter ist<br />
im Kindbett gestorben: «Ich kostete<br />
meiner Mutter das Leben, und meine<br />
Geburt war mein erstes Unglück»,<br />
schreibt er später. Sein Vater hat sich<br />
wieder verheiratet, die Lehrzeit in Genf<br />
war freudlos. Bei «Mama» wird er, <strong>von</strong><br />
einigen Reisen unterbrochen, lange<br />
Jahre des Glücks verbringen. Allerdings<br />
verlangt «Mama» gleich zu Beginn, dass<br />
er, der calvinistisch aufgewachsen ist,<br />
zum Katholizismus übertritt Ω Madame<br />
de Warens bekommt für ihre Bemühungen<br />
Geld <strong>von</strong> der katholischen Kirche.<br />
Ihr junger Zögling und Geliebter, das<br />
muss sie bald erkennen, ist anstrengend,<br />
empfindlich, oft krank und scheut jede<br />
Anstrengung. Als er <strong>von</strong> einem Kuraufenthalt<br />
in Montpellier zurückkehrt, hat<br />
«Mama» einen neuen Geliebten: Wintzenried,<br />
<strong>von</strong> Beruf Perückenmacher.<br />
Jean-Jacques muss den Haushalt verlassen.<br />
Eine Kränkung für immer.<br />
Von Ehrgeiz getrieben<br />
In «Wintzenried» erzählt Karl-Heinz<br />
Ott die Geschichte <strong>von</strong> Jean-Jacques<br />
Rousseau, die Geschichte eines Mannes,<br />
der zunächst unschlüssig durchs Leben<br />
dümpelt. Eine Ausbildung hat er nicht,<br />
<strong>von</strong> vielem bloss ungefähre Vorstellungen,<br />
eigentlich kann er noch nichts. In<br />
seinen Phantasien jedoch könnte er<br />
alles werden: Komponist, Pfarrer, Diplomat.<br />
Einen Versuch als Komponist wagt<br />
er in Lausanne, wo er sich sehr kokett<br />
als Musiker präsentiert und den Auftrag<br />
bekommt, ein Menuett zu komponieren.<br />
Dessen öffentliche Aufführung wird zur<br />
Blamage. Und weil er mit dem Notensystem<br />
nicht zurechtkommt, beschliesst<br />
er kurzerhand, ein neues zu erfinden,<br />
eines, das nur mit Zahlen operiert. Das<br />
wird dann die nächste Blamage.<br />
Mit seiner Erfindung im Gepäck<br />
macht er sich auf nach Paris. Er will anerkannt,<br />
berühmt werden. Er lernt Diderot<br />
kennen, der gerade ein grosses Projekt<br />
wälzt, die «Encyclopédie», aber der<br />
geplante Aufstieg will nicht gelingen Ω<br />
bis er realisiert, dass er Zugang finden<br />
muss zu einem der Pariser Salons, die<br />
<strong>von</strong> resoluten und einflussreichen<br />
Damen geführt werden.<br />
Eine dieser Damen verschafft ihm Arbeit.<br />
In Venedig wird er Sekretär des<br />
französischen Botschafters, nun glaubt<br />
er sich auf dem Weg zur Diplomatenkarriere.<br />
Es kommt anders. Zwar scheint er<br />
gute Briefe schreiben zu können, aber er<br />
ist überheblich, aufbrausend und korrupt.<br />
Und er hat ein Talent, die Gunst<br />
des Augenblicks zu versäumen und sich<br />
hinterher darüber zu ärgern.<br />
Kritiker des Fortschritts<br />
Karl-Heinz Ott lenkt seinen Rousseau<br />
sehr geschickt und immer unterhaltsam<br />
durch die biografisch verbürgten Stationen,<br />
aber er präsentiert keine Biografie,<br />
nennt keine Jahreszahlen und hält kein<br />
Philosophieseminar. Er zeigt seinen<br />
Jean-Jacques gleichsam <strong>von</strong> hinten, als<br />
den oft Verzweifelten, Suchenden, <strong>von</strong><br />
Grössenwahn und Verfolgungsängsten<br />
Geplagten. Als Erotomanen, der sich<br />
ständig in Frauen verliebt und sich<br />
durch Onanieren vor deren Nähe<br />
schützt. Als einen, den viele Zufälle voranbringen<br />
und Vorbehalte bremsen.<br />
Als Rousseau in Paris vom Preisausschreiben<br />
einer Akademie erfährt, beschliesst<br />
er, daran teilzunehmen. Es geht<br />
um die Frage, ob der Fortschritt der Wissenschaften<br />
und Künste unsere Sitten<br />
Jean-Jacques<br />
Rousseau (1712–1778)<br />
mit «Mama», seiner<br />
ersten Geliebten,<br />
Madame de Warens,<br />
in Annecy.<br />
verfeinert oder verdorben habe. Als er<br />
Diderot da<strong>von</strong> erzählt, rät ihm dieser,<br />
den Fortschritt nicht zu rühmen: Loben<br />
sei bloss langweilig. Kritik am Fortschritt<br />
hingegen werde auffallen. Diderot,<br />
der das als Spiel auffasst und selber<br />
kein Wort da<strong>von</strong> glaubt, diktiert ihm<br />
auch gleich die ersten paar Sätze. Rousseau<br />
muss sich anfänglich überwinden,<br />
den Faden weiterzuspinnen.<br />
Mit seiner furiosen Kritik an den Folgen<br />
des Fortschritts wird Rousseau den<br />
ersten Preis gewinnen, und damit hat er<br />
auch sein lebenslängliches Thema. Er<br />
wird ein einfaches, aber ziemlich turbulentes<br />
Leben führen, zusammen mit seiner<br />
Geliebten Thérèse, und er wird sich<br />
konsequenterweise mit den führenden<br />
Aufklärern verkrachen. Viele Adlige<br />
wiederum suchen bei ihm, der alle seine<br />
fünf Kinder im Waisenhaus abgeliefert<br />
hat, Rat in Fragen der Erziehung.<br />
In seinem grandiosen Roman zeichnet<br />
Ott eine höchst interessante, <strong>von</strong><br />
Widersprüchen geprägte Figur. Dass sie<br />
<strong>von</strong> belegbaren Daten gestützt wird, ist<br />
hier zweitrangig. Interessanter ist das<br />
Bild eines Menschen, der sich buchstäblich<br />
ins Gewühl seiner Epoche stürzt<br />
und seine tragische Zerrissenheit auf<br />
skandalöse Weise auslebt Ω und in vielem<br />
aus dem Rahmen eben dieser Epoche<br />
fällt. Otts Roman erzählt damit, indirekt<br />
und mit leichter Hand, auch <strong>von</strong><br />
den Bedingungen, unter denen das <strong>Neue</strong><br />
entsteht. Es sind oft krumme Wege.●<br />
29. Januar 2012 ❘ NZZ am Sonntag ❘ 7<br />
SCALA ARCHIVES
Belletristik<br />
Roman Das preisgekrönte Werk <strong>von</strong> Youssef Ziedan<br />
erzählt vom bewegten Leben eines Geistlichen aus dem<br />
fünften Jahrhundert<br />
Stachel im Fleisch<br />
eines christlichen<br />
Mönchs<br />
Youssef Ziedan: Azazel. Aus dem<br />
Arabischen <strong>von</strong> Larissa Bender.<br />
Luchterhand, München 2011. 448 Seiten,<br />
Fr. 32.90.<br />
Von Susanne Schanda<br />
Schon der Titel ist für die religiöse Leserschaft<br />
eine Provokation: «Azazel»<br />
heisst im Alten Testament wie im Koran<br />
Satan, gefallener Engel oder auch Sündenbock.<br />
Er spielt die treibende Rolle in<br />
Youssef Ziedans preisgekröntem Roman<br />
und ist zugleich der Stachel im Fleisch<br />
des ägyptischen Mönchs Hypa. Ketzerisch<br />
fragt Azazel den <strong>von</strong> Glaubenszweifeln<br />
gepeinigten Mönch: «Hat Gott<br />
den Menschen erschaffen oder umgekehrt?»<br />
Der Autor Youssef Ziedan beschäftigt<br />
sich als Philosoph, Sufismus-Forscher<br />
und Direktor der Handschriftenabteilung<br />
der Bibliothek <strong>von</strong> Alexandria seit<br />
Jahrzehnten mit alten Schriften. Nach<br />
etlichen wissenschaftlichen Büchern<br />
hat er für seinen zweiten Roman «Azazel»<br />
2009 den Arabischen Bookerpreis<br />
erhalten. In Ägypten löste der Roman<br />
einen Sturm der Entrüstung aus und<br />
wurde zum Bestseller. Mehrere Bischöfe<br />
der Koptisch-Orthodoxen Kirche warfen<br />
Ziedan vor, den christlichen Glauben<br />
zu verunglimpfen, sprachen ihm als<br />
Muslim das Recht ab, über das Christentum<br />
zu schreiben, und forderten ein<br />
Verbot des Buches – erfolglos.<br />
Löste Kontroverse aus<br />
Auch muslimische Geistliche ereifer ten<br />
sich über den Roman, in dem ein junger<br />
Mönch zwischen der asketischen Hingabe<br />
an den Glauben und seinen körperlichen<br />
Begierden hin und her gerissen<br />
wird. Zwar hat die Kontroverse dem<br />
Buch zusätzliche Popularität verschafft.<br />
Dennoch bedauert der Autor im Gespräch<br />
die Angriffe: «Es ist absurd, mir<br />
vorzuwerfen, dass ich das Christentum<br />
schlecht mache. Mein Roman richtet<br />
sich gegen keine Kirche, sondern gegen<br />
die Haltung, im Namen der Religion<br />
Gewalt auszuüben. Er thematisiert das<br />
Menschsein in seiner Vielfalt <strong>von</strong> Fühlen,<br />
Denken, Glauben, Zweifeln und<br />
Sehnen.»<br />
Youssef Ziedan hat seine Geschichte<br />
in der frühchristlichen Zeit in Ägypten,<br />
Palästina und Syrien angesiedelt, als die<br />
Kirche <strong>von</strong> theologischen Kontroversen<br />
8 ❘ NZZ am Sonntag ❘ 29. Januar 2012<br />
und Machtkämpfen erschüttert wurde.<br />
Erzähler ist der Mönch Hypa, angetrieben<br />
<strong>von</strong> Azazel, einer schillernden, lockenden<br />
sowie irritierenden Figur, die<br />
er zuerst entrüstet zum Schweigen bringen<br />
will, schliesslich aber als innere<br />
Stimme erkennt. Auf 30 Pergamentrollen<br />
schreibt er seine Erinnerungen nieder,<br />
gequält <strong>von</strong> Schuldgefühlen und um<br />
seinen Glauben ringend. Hypa stammt<br />
aus einem Dorf im südlichen Ägypten,<br />
wo an der Schwelle zum fünften Jahrhundert<br />
noch der Glaube an die alten<br />
ägyptischen Götter herrscht. Als junger<br />
christlicher Mönch studiert er Medizin<br />
und bricht dann auf gegen Norden. Im<br />
kosmopolitischen und intriganten Alexandria<br />
lässt er sich <strong>von</strong> der schönen Oktavia<br />
zur Lust verführen und beinahe um<br />
den Verstand bringen. Als mindestens<br />
so sündhaft gelten der Kirche allerdings<br />
die Vorträge der heidnischen Philosophin,<br />
Astronomin und Mathematikerin<br />
Hypatia, denen er fasziniert lauscht.<br />
Entsetzt und machtlos muss er mit ansehen,<br />
wie die Gelehrte <strong>von</strong> einem christlichen<br />
Mob angegriffen und zu Tode<br />
geschleift wird.<br />
Brennend aktuell<br />
Der Schock dieser Gewalttat im Namen<br />
des Christentums wird zum Wendepunkt,<br />
vertreibt ihn aus Alexandria, vorerst<br />
nach Jerusalem und <strong>von</strong> dort weiter<br />
in ein abgelegenes Kloster auf einem<br />
Hügel nördlich <strong>von</strong> Aleppo. Hier will er<br />
sich nach seiner abenteuerlichen Wanderschaft<br />
mit nur 33 Jahren der Welt entziehen,<br />
sich dem Studium und seinem<br />
Kräutergarten widmen und als Arzt den<br />
notleidenden Menschen helfen. Doch es<br />
kommt anders.<br />
Der Roman erzählt die Ereignisse<br />
nicht chronologisch, sondern folgt den<br />
Erinnerungssprüngen des Mönches. Gerade<br />
dessen innere Auseinandersetzung<br />
lässt uns als Lesende mitfiebern und<br />
atemlos weiterblättern, als würde sich<br />
das Geschehen hier und jetzt vor unseren<br />
Augen abspielen. Youssef Ziedan<br />
erzählt auf der Folie der Geschichte<br />
einen modernen Entwicklungsroman<br />
<strong>von</strong> brennender Aktualität. Ein Vergleich<br />
mit dem amerikanischen Thriller<br />
«Da Vinci Code» bietet sich an, greift<br />
aber zu kurz. «Azazel» ist keine leichte<br />
Kost, sondern ein philosophischer<br />
Roman, der sich mit arabischer Theologie,<br />
Moral und der Selbstverantwortung<br />
des Einzelnen auseinandersetzt. Er ist<br />
Youssef Ziedan sucht<br />
in seinem Roman nach<br />
dem Licht im Dunkeln.<br />
Koptischer Mönch<br />
im Kloster <strong>von</strong> Wadi<br />
Natrun in Ägypten.<br />
«mit Blut, Schweiss und Tränen geschrieben»,<br />
wie der Autor sagt. Umso<br />
mehr freut es ihn, dass der Roman gerade<br />
bei jungen Lesern so gut ankommt. In<br />
Ägypten hat inzwischen sein jüngster<br />
historischer Roman das Buch «Azazel»<br />
<strong>von</strong> der Spitze der Bestsellerlisten verdrängt.<br />
Der Autor wird bei seiner Arbeit<br />
<strong>von</strong> einem aufklärerischen Impuls getrieben:<br />
«Ich habe bereits 55 Bücher geschrieben,<br />
und immer mit dem Anspruch,<br />
Licht ins Dunkel zu bringen,<br />
Verständnis für unser kulturelles Erbe<br />
zu wecken.» Sein Arbeitsplatz, die geschichtsträchtige<br />
Bibliothek <strong>von</strong> Alexandria,<br />
wurde einst <strong>von</strong> Cäsar angezündet<br />
und vor rund zehn Jahren in Zusammenarbeit<br />
mit der Unesco wieder errichtet,<br />
mit Blick aufs Mittelmeer.<br />
«Wozu haben wir die Bibliothek wieder<br />
aufgebaut, wenn nicht, um aufzuklären?»<br />
fragt Youssef Ziedan. ●<br />
ANDREA PISTOLESI / TIPS / BILDAGENTUR ONLINE
Briefwechsel Die beiden österreichischen Autoren Joseph Roth und Stefan Zweig tauschten sich<br />
über persönliche Probleme und Schriftstellerkollegen aus<br />
«Roosevelt ist ein Schwindler»<br />
«Jede Freundschaft mit mir ist<br />
verderblich». Joseph Roth und Stefan<br />
Zweig. Briefwechsel 1927–1938. Hrsg.<br />
Madeleine Rietra. Wallstein,<br />
Göttingen 2011. 623 Seiten, Fr. 53.90.<br />
Von Arnaldo Benini<br />
Ein Briefwechsel mit eher wenigen Briefen<br />
legt selten Zeugnis für eine Existenz<br />
ab. Genau dies jedoch ist der Fall bei Joseph<br />
Roth und seiner elfjährigen Korrespondenz<br />
mit Stefan Zweig. Der Band<br />
enthält 219 Briefe <strong>von</strong> Roth, 49 Antworten<br />
Zweigs, einige Briefe zwischen Roth<br />
und Zweigs Ehefrau Friderike, Ausschnitte<br />
<strong>von</strong> 58 Briefen mit Bezug auf<br />
Roth, fast alle <strong>von</strong> Stefan und Friderike<br />
Zweig an Bekannte gerichtet, sowie<br />
Zweigs Nachruf auf den 1939 verstorbenen<br />
Freund. Ein Kommentar und ein<br />
historisch-biografisches Nachwort vervollständigen<br />
das hervorragend edierte<br />
Werk. Allerdings ist nur ein Bruchteil<br />
des Briefwechsels der Jahre 1927 bis 1938<br />
erhalten, die Roth und Zweig teilweise<br />
im Exil verbrachten. Im Exil Verfasstes<br />
geht leicht verloren, weil die Geflohenen<br />
nur das Nötigste mitnehmen – und<br />
Roth reiste pausenlos «nur mit drei Koffern»<br />
durch ganz Europa.<br />
«Ich bin entsetzt» schreibt er im Juli<br />
1933 an Zweig, «ich habe kein einziges<br />
meiner Bücher.» Roth richtet seine Briefe<br />
an den «sehr verehrten und sehr lieben<br />
Stefan Zweig», ohne den 13 Jahre<br />
Älteren und viel Bekannteren je zu<br />
duzen. Von einigen Ausnahmen abgesehen,<br />
greifen die beiden Autoren kaum<br />
politische und kulturelle Themen auf.<br />
Roths Briefe an den geduldigen und<br />
grosszügigen Zweig sind eine Litanei an<br />
Klagen über familiäres Unglück und<br />
über «unsägliche Peinlichkeiten», verursacht<br />
meist durch den Alkohol, der<br />
das erzählerische Talent bedroht und<br />
die Honorare hinwegspült. Der Ton ist<br />
jeweils ultimativ: Zweig muss sofort antworten,<br />
er muss «Geld telegraphisch<br />
anweisen», weil Roth sonst verhungern<br />
oder der Lynchjustiz der Gläubiger anheimfallen<br />
würde, er muss sich bei<br />
einem Verleger sofort für ein Buch einsetzen,<br />
das Roth, wie sich später herausstellt,<br />
bereits einem anderen abgetreten<br />
hat. Roth ist für die erbrachten Dienste<br />
zwar dankbar, aber wenn Zweig nicht<br />
reagiert, überschüttet er ihn mit Verachtung<br />
oder schreibt ihm, um ihn zu verletzen.<br />
Er ist sich bewusst, dass er die<br />
Beziehung missbraucht: «Jede Freundschaft<br />
mit mir ist verderblich.»<br />
Die Geduld des Wiener Aristokraten<br />
Zweig jedoch ist unendlich. 1934 schreibt<br />
er einer Freundin, es sei «furchtbar<br />
schwer» mit Roth. Er sehe «keinen Ausweg<br />
mehr», weil ihn «der Alkohol ganz<br />
unterhöhlt». Die Freundschaft dauerte<br />
bis zu Roths Tod 1939. Dessen Urteile<br />
über Kollegen sind <strong>von</strong> Ressentiments<br />
geprägt und meist masslos: Thomas<br />
Mann «ist einfach naiv und dem eigenen<br />
Talent geistig nicht gewachsen». «Die<br />
Geschichten Jaakobs» haben ihn «direct<br />
angewidert. Es ist eine Schande, eine<br />
Schamlosigkeit». Am 31. August 1933 ist<br />
er sicher, dass der «Usurpator der Objektivität»<br />
Thomas Mann imstande sei,<br />
sich «mit Hitler auszusöhnen». Bei<br />
René Schickele liegt «Feigheit» vor,<br />
beim «Krakehler» (sic) Döblin «irritierender<br />
Infantilismus», und Romain Rolland<br />
ist «ein falscher Prophet».<br />
Beide Briefpartner sind überzeugte<br />
antizionistische Juden. Roth schreibt<br />
1935 an Zweig: «Die Zionisten stehen<br />
den Nazis sehr nahe.» Roosevelt ist für<br />
ihn «ein Schwindler, ein grosser Gauner,<br />
ein Gangster». Das sind Beispiele einer<br />
innerhalb der deutschen Emigration<br />
häufigen Aggressivität, oft in der meisterhaften<br />
Sprache verfasst, die man aus<br />
Roths Romanen und Erzählungen kennt.<br />
Anders als Zweig hatte Roth bereits kurz<br />
Entschleunigung Die Kehrseite der Moderne<br />
Dass unser Leben immer hektischer wird, erfahren<br />
wir täglich. Dass wir gerne mehr Ruhe hätten, ohne<br />
auf Schnelligkeit verzichten zu müssen, wissen wir<br />
auch. Hussein Chalayan zeigt uns, wie das Paradox<br />
aussehen könnte. In einer Videoinstallation lässt der<br />
1970 auf Zypern geborene Künstler eine Frau mit<br />
Hochgeschwindigkeit <strong>von</strong> London nach Istanbul<br />
reisen. Ganz entspannt sitzt sie in einer Kapsel, isst<br />
gelegentlich etwas oder lässt Badewasser einlaufen.<br />
Die Landschaft saust an ihr vorbei. Ausser hin und<br />
wieder einem Atomkraftwerk ist nichts zu erkennen.<br />
Im Moment äusserster Ruhe wird das Aussen zur<br />
Staffage. Die Zeitreise gehört seit Jules Verne zur<br />
Moderne, Hollywood hat das Thema ausgeschlachtet.<br />
Spätestens seit 1776 James Watt die erste<br />
Dampfmaschine installiert hat, gilt Geschwindigkeit<br />
nach Hitlers Machtergreifung keine<br />
Zweifel, dass ein Krieg bevorstehe. Gemeinsam<br />
mit Thomas Mann gehörte er<br />
zu den wenigen, die zu jener Zeit über<br />
ein sicheres Gefühl für die Realität verfügten.<br />
Zweig dagegen ist auffällig zurückhaltend<br />
und beschränkt sich auf<br />
Trost und Empfehlungen: Sein Freund<br />
solle dem Alkohol abschwören, so wie<br />
Zweig auf seine täglich 20 Zigarren verzichtet<br />
hat, und nicht überreizt gegen<br />
alles und alle schwadronieren. Vergeblich<br />
– die gut gemeinten Ratschläge vermögen<br />
gegen die Verzweiflung des<br />
Freundes nichts auszurichten. Zweig<br />
stand Roth sehr nahe und hat ihn aufrichtig<br />
bemitleidet. Es fehlte ihm aber<br />
die Überzeugungskraft, dem Freund<br />
entscheidend zu helfen. Der Briefwechsel<br />
zwischen Roth und Zweig widerspiegelt<br />
die Tragödie <strong>von</strong> Roths Leben – mit<br />
Intermezzi einer opera buffa. ●<br />
als Inbegriff <strong>von</strong> Fortschritt und Zukunft. Die Futuristen<br />
haben sie vor dem Ersten Weltkrieg gefeiert,<br />
Skeptiker wie Jean Tinguely haben sie ein paar<br />
Jahrzehnte später mit sanfter Ironie hinterfragt.<br />
Seine Maschinen laufen leer und machen einen<br />
Höllenlärm. Das Widerspiel <strong>von</strong> Ruhebedürfnis und<br />
Beschleunigungssehnsucht wird in dem Band, der<br />
eine Ausstellung im Kunstmuseum Wolfsburg<br />
begleitet (bis 9. 4.), in seinen vielen Kapiteln <strong>von</strong> der<br />
Romantik an ausdrucksstark aufgefächert. Die<br />
Kunstgeschichte lässt sich auch unter diesem Aspekt<br />
betrachten. Aus dem Dilemma unserer Wünsche<br />
werden wir allerdings nicht entlassen. Gerhard Mack<br />
Markus Brüderlin (Hrsg.): Die Kunst der<br />
Entschleunigung. Hatje Cantz, Ostfildern 2011.<br />
260 Seiten, 402 Abbildungen, Fr. 66.50.<br />
29. Januar 2012 ❘ NZZ am Sonntag ❘ 9
Belletristik<br />
Autobiografischer Roman Ein niederländischer Autor setzt seinem Sohn ein Denkmal<br />
Wenn Literatur<br />
zur Trösterin wird<br />
A. F. Th. van der Heijden: Tonio.<br />
Ein Requiemroman. Aus dem<br />
Niederländischen <strong>von</strong> Helga <strong>von</strong><br />
Beuningen. Suhrkamp, Berlin 2011.<br />
671 Seiten, Fr. 26.90.<br />
Von Sieglinde Geisel<br />
Von der Trauer um einen geliebten<br />
Menschen bleibt niemand verschont,<br />
auch nicht die Schriftsteller. Mit<br />
«Tonio» hat der niederländische Autor<br />
A. F. Th. van der Heijden seinem Sohn<br />
ein Denkmal gesetzt: Am frühen Morgen<br />
des 23. Mai 2010 verunfallte Tonio in<br />
Amsterdam mit dem Velo, am gleichen<br />
Tag starb er, noch nicht 22-jährig. «Solange<br />
die Literatur den Tod nicht zu<br />
überwinden vermag, hat sie nach meiner<br />
Auffassung die Rolle (Funktion)<br />
einer Trösterin bei allen Todesängsten.»<br />
Diese Zeilen <strong>von</strong> 1981 stammen aus<br />
einem Band mit Notizen aus dem Alltag.<br />
Nun stellt van der Heijdens «Requiemroman»<br />
die Rolle der Literatur als Trösterin<br />
auf die Probe.<br />
Diffuse Lichtgestalt<br />
«Wenn ich es (…) jetzt schreibe, schon<br />
in diesem Sommer, wird es ein Bericht<br />
<strong>von</strong> innen (…), direkt aus der Gefühlsverwirrung<br />
heraus … Das Schreiben<br />
wird dann zu einem Teil des Ringens,<br />
und umgekehrt.» Ende Mai, eine Woche<br />
nach Tonios Tod, hat van der Heijden<br />
mit dem Buch begonnen, so erfährt man<br />
gegen Ende der 671 Seiten. Er habe seinem<br />
Gedächtnis freien Lauf gelassen<br />
und dieses Material dann «in einer<br />
Struktur untergebracht, die in etwa der<br />
eines Romans gleicht» – mit dem Ziel,<br />
seinen Sohn «in Prosa lebendig zu erhalten».<br />
Die strenge äussere Form, in der<br />
die Aufzeichnungen komponiert sind,<br />
erweckt den Eindruck, das Chaos der<br />
Gefühlsverwirrung lasse sich in eine<br />
Ordnung bannen – als wäre das eigene<br />
Leben, der eigene Schmerz ein Romanstoff,<br />
über den der Autor verfügen könnte,<br />
der am «Schwarzen Pfingstsonntag»<br />
aus seiner Ruhe gerissen wurde. Zwei<br />
Polizisten melden, Tonio liege «in kritischem<br />
Zustand» im Operationssaal. Der<br />
Bericht über die folgenden quälenden<br />
Stunden wird nun mit weiteren Zeitebenen<br />
verflochten: mit Erinnerungen an<br />
das Kind Tonio, Gesprächen mit seinen<br />
Freunden über den letzten Tag, Versuchen,<br />
den Unfall zu rekonstruieren, Reflexionen<br />
über Schuldgefühle.<br />
Stolz signiert der achtjährige Tonio<br />
bei Lesungen die Bücher seines Vaters.<br />
Später macht er sich über dessen Arbeitswut<br />
lustig: «Bist du schon bei zehn<br />
Seiten pro Tag?» – «Fünf sind das Minimum<br />
(…). Sechs, sieben sind machbar.<br />
Acht ist ein Supertag», so die Antwort.<br />
10 ❘ NZZ am Sonntag ❘ 29. Januar 2012<br />
A. F. Th. van der<br />
Heijden verarbeitet<br />
seine Trauernotizen<br />
über den bei<br />
einem Velounfall<br />
verstorbenen Sohn zu<br />
einem Requiem.<br />
Zum Streit kam es nie, auch später nicht.<br />
Tonio erscheint als eine Lichtgestalt, die<br />
undeutlich bleibt, ebenso wie seine<br />
Mutter Mirjam.<br />
Wie privat ist dieser Requiemroman?<br />
Bisweilen blättert man in einem literarischen<br />
Familienalbum, das einen nichts<br />
anzugehen scheint, doch in der nächsten<br />
Szene ist man unmittelbar berührt.<br />
Mit den Eltern stehen wir am Spitalbett<br />
des sterbenden Sohns. «Er schlief nicht,<br />
und er war auch noch nicht aus dem<br />
Traum erwacht, der das Leben war.»<br />
Wenn van der Heijden nicht nur seinen<br />
eigenen Schmerz erforscht, sondern das<br />
Wesen der Trauer überhaupt, ist nichts<br />
mehr privat. «Ich lief umher wie ein bis<br />
ins Mark betrogener Liebhaber, in dem<br />
die Liebe immer noch wächst und<br />
wächst.» «Wir liessen den Nerv frei liegen<br />
und erzwangen so den Schmerz, der<br />
uns mit Tonio verband.»<br />
Neben solchen Sätzen begegnet man<br />
in diesem offenbar schnell geschriebenen<br />
Buch allerdings auch Phrasen aus<br />
dem Allgemeinwortschatz des Trauerns.<br />
«In Tonios Tod kann ich keinerlei<br />
Ziel, keinerlei Sinn entdecken.» Auch<br />
Mirjam findet keine eigenen Worte für<br />
den Schmerz: «So schrecklich … so<br />
schrecklich, dass ich ihn nie mehr sehen<br />
werde.» Das sind Sätze, wie sie jeder<br />
sagen könnte, und deshalb bleiben sie in<br />
der Literatur ohne Wirkung. Der sprachliche<br />
Übermut wiederum, der in den<br />
ausgreifenden Romanzyklen van der<br />
Heijdens so kraftvoll daherkommt, erzeugt<br />
hier, wo es um sein eigenes Leid<br />
geht, grell verunglückte Sätze. «Der gestorbene<br />
Tonio ruht unausweichlich<br />
schwer und reglos in der wimmernden<br />
Hängematte meiner Aufmerksamkeit.»<br />
Berührend ehrlich<br />
Welchen Massstab soll man an diese<br />
Tagebuch-Notizen in Romanform anlegen?<br />
Man ist berührt <strong>von</strong> der Ehrlichkeit,<br />
mit der van der Heijden seine Trauer<br />
mitteilt – umso mehr jedoch schmerzen<br />
die vielen Sätze, die dem Floskelhaften,<br />
Alltäglichen verhaftet sind. «Diese<br />
Notizen haben KEINEN LITERARI-<br />
SCHEN ANSPRUCH, die jetzigen nicht<br />
und auch nicht die zurückliegenden», so<br />
hiess es in der Notiz-Sammlung «Engelsdreck».<br />
Auch «Tonio» besteht aus<br />
Alltagsnotizen, allerdings aus einem<br />
Alltag im Ausnahmezustand. Es sei ihm<br />
nicht gelungen, zum Kern dessen vorzudringen,<br />
was wirklich passiert sei, notiert<br />
van der Heijden nach einem Besuch<br />
bei seinem Bruder. Diesen Eindruck hat<br />
man auch nach der Lektüre: Der Plauderton,<br />
der über weite Strecken herrscht,<br />
nimmt den Ereignissen ihr Gewicht.<br />
Man hat dieses dicke Buch nicht nur<br />
überraschend schnell gelesen, man hat<br />
es auch «gern» gelesen. Doch dies ist<br />
das falsche Kompliment. Was fehlt, ist<br />
jener Trost, den Literatur zu geben vermag,<br />
wenn sie den Schmerz durch Sprache<br />
verwandelt. ●<br />
ROBERT RIZZO / HOLLANDSE HOOGTE / LAIF
Roman Unspektakulärer Alltag,<br />
klischeehaft geschildert<br />
Eine alte Dame<br />
gerät in Wut<br />
PETER PEITSCH<br />
Stewart O'Nan: Emily, allein. Aus dem<br />
Amerikanischen <strong>von</strong> Thomas Gunkel.<br />
Rowohlt, Hamburg 2011. 352 Seiten,<br />
Fr. 30.50.<br />
Von Simone <strong>von</strong> Büren<br />
Betagte Protagonisten, gebrechlich, vergesslich<br />
und kompliziert, gibt es in der<br />
Literatur wenige. Bei Stewart O’Nan, der<br />
Thriller schreibt und sich gerne mit dramatischen<br />
Stoffen befasst, erwartet man<br />
sie schon gar nicht. Doch nun hat der<br />
Amerikaner mit «Emily, allein» einen<br />
Roman über eine alte Frau geschrieben,<br />
deren «Leben keine dringende oder notwendige<br />
Angelegenheit mehr» ist.<br />
Emily ist über achtzig und seit Jahren<br />
verwitwet, eine pflichtbewusste Dame,<br />
die viel erwartet und leicht enttäuscht<br />
wird – etwa wenn Kinder und Enkel zu<br />
früh abreisen und keine Dankesbriefe<br />
schreiben. Ihr Leben besteht aus langen<br />
Hunde spaziergängen, Frühgottesdiensten<br />
und dem Ausschneiden <strong>von</strong> Rabattgutscheinen.<br />
O’Nan beschreibt Emilys unspektakulären<br />
Alltag gewissenhaft und in nüchternem<br />
Stil. Das Irritierende dabei ist,<br />
dass er Dinge behauptet, anstatt sie<br />
sichtbar zu machen: Der Drittpersonerzähler<br />
beschreibt eine Frau, die zu<br />
Hause gerne klassische Musik hört und<br />
in Fotoalben blättert, sagt dann aber,<br />
dass sie sich in ihrem Haus «klaustrophobischen<br />
Gedanken ausgeliefert»<br />
fühlt. Er zeigt uns eine unscheinbare<br />
Dame, höflich und angepasst, sagt aber,<br />
sie habe schlimme Wutanfälle. Und statt<br />
ihre Empfindungen zu beschreiben, legt<br />
er ihr Sentenzen in den Mund: Angesichts<br />
des Todes «in Hysterie zu verfallen<br />
hatte keinen Sinn».<br />
Was der 50-jährige Autor vorlegt, ist<br />
ein Klischee <strong>von</strong> Alter. Auf den 350 Seiten<br />
kommt alles vor, was man mit dem<br />
Alltag einer betagten Frau assoziiert:<br />
Vergesslichkeit, Angst vor Stürzen<br />
«beim Auffüllen des Vogelhäuschens»,<br />
das Wählen der republikanischen Partei<br />
auch nach Bush, Schlaflosigkeit, Abhängigkeit<br />
<strong>von</strong> Nachbarn, Fixiertsein auf<br />
ein Haustier, Hang zu Paranoia, Arztbesuche,<br />
Testamentschreiben, Beerdigungen,<br />
verklärte Erinnerungen.<br />
Es fehlen die unerwarteten Einzigartigkeiten,<br />
die eine Figur lebendig<br />
machen. Nur Ansätze dazu<br />
sind zu erkennen: Etwa<br />
wenn Emily merkt, dass<br />
man ihr in ihren geliebten<br />
viktorianischen Filmen<br />
die Nebenrolle<br />
der schrulligen Alten<br />
geben würde, während<br />
sie sich selber<br />
immer noch in der<br />
Hauptrolle sieht. ●<br />
Kurzkritiken Belletristik<br />
Katharina Hacker: Eine Dorfgeschichte.<br />
S. Fischer, Frankfurt 2011. 127 Seiten,<br />
Fr. 25.90.<br />
Über der bürgerlichen Kindheit liegt die<br />
Trägheit der Sonntagnachmittage und<br />
der Sommer auf dem Land. Bei der<br />
44-jährigen Katharina Hacker, deutsche<br />
Buchpreisträgerin («Die Habenichtse»,<br />
2006), sind es die Sommer, welche die<br />
gebürtige Frankfurterin mit ihrer Familie<br />
in einem Odenwalder Dorf zubrachte.<br />
In ihrem schmalen Buch gibt sie weniger<br />
eine titelgebende «Geschichte»<br />
wieder als atmosphärische Erinnerungspassagen:<br />
Arier-Dokumente im Estrich,<br />
Hitze, Gewitter, die wilde Fantasie der<br />
drei Geschwister, Dorfdeppen, die verehrte<br />
Grossmutter. Die Autorin erzählt<br />
aus der Gegenwart heraus, das Autobiografische<br />
kryptisch verneinend. Wozu?<br />
Das verschleiernd Märchenhafte im<br />
Ton, in der Syntax bleibt und damit die<br />
Stimmung, die einen einhüllt wie ein<br />
samtenes Futteral. Oder wie die Langeweile<br />
eines Sommers auf dem Land.<br />
Regula Freuler<br />
Friedrich Achleitner: Iwahaubbt. Gedichte<br />
im Dialekt. Zsolnay, Wien 2011. 208 Seiten,<br />
Fr. 25.90.<br />
Der 1930 im oberösterreichischen Schalchen<br />
geborene Friedrich Achleitner ist<br />
Schriftsteller, Architekt und emeritierter<br />
Professor für angewandte Kunst. 1955<br />
stiess er zur Wiener Gruppe um Bayer,<br />
Artmann und Rühm. Er publizierte<br />
Dialektgedichte sowie Konkrete Poesie<br />
und Montagetexte. Berühmt wurde sein<br />
experimenteller «Quadratroman» <strong>von</strong><br />
1973. In den letzten Jahren hat er mehrere<br />
Sammlungen <strong>von</strong> kurzen Texten publiziert,<br />
in denen sich Beobachtungsgabe,<br />
kauziger Humor und Sprachmusikalität<br />
verbinden. Nun legt er unter dem Titel<br />
«Iwahaubbt» seine gesammelten, im<br />
Dialekt des Innviertels verfassten Gedichte<br />
vor. Sie sind im Lauf eines halben<br />
Jahrhunderts entstanden und <strong>von</strong> vielfältigem<br />
Zauber. Übermütig spielen sie<br />
mit Formen wie der Stanze und Litanei.<br />
Nicht immer sind sie auf Anhieb zu entziffern.<br />
Für neugierige Sprachspieler<br />
aber sind sie ein unerschöpflicher Quell<br />
des Vergnügens.<br />
Manfred Papst<br />
Iren Baumann: Noch während die Pendler<br />
heimfahren. Gedichte. Waldgut, Frauenfeld<br />
2011. 80 Seiten, Fr. 20.10.<br />
Die Lyrikerin Iren Baumann gehört zu<br />
den originellsten Stimmen der <strong>Zürcher</strong><br />
Literaturszene. Das Werk der 1939 geborenen<br />
Dichterin ist schmal, aber bedeutsam.<br />
Fünf Gedichtbände umfasst es<br />
mittlerweile. Die reimlosen, in freien<br />
Rhythmen gehaltenen Zeilen widerspiegeln<br />
oft Alltagsbeobachtungen und<br />
kommen ohne prätentiöses Vokabular<br />
aus, sind aber doch hintersinnige Wortgespinste.<br />
Zärtlichkeit und Genauigkeit<br />
verbinden sich in ihnen mit einer koboldhaften<br />
Heiterkeit. Iren Baumann<br />
sieht in die Menschen hinein und durch<br />
sie hindurch, scheinbar simple Dinge<br />
schimmern bei ihr in einem gebrochenen<br />
Licht und offenbaren so eine ungeahnte<br />
Schönheit. Die aber steht niemals<br />
still: Denn Kobolde haben einen sicheren<br />
Instinkt, der sie alle Feierlichkeit<br />
vermeiden und stets neue Volten schlagen<br />
lässt.<br />
Manfred Papst<br />
Nancy Mitford: Landpartie mit drei<br />
Damen. Satirischer Roman. Graf, München<br />
2011. 247 Seiten, Fr. 24.50.<br />
Herausfordernd und doch mit jener Gelassenheit<br />
der Selbstbewussten schaut<br />
sie einen an auf der Umschlagfoto. Der<br />
Eindruck täuscht nicht: Nancy Mitford<br />
(1904–1973), Tochter eines britischen<br />
Barons, scheute keine Konflikte, weder<br />
im Privaten noch im Schreiben Ω bei<br />
letzterem mit Erfolg. Auch im Roman<br />
«Wigs on the Green», der nun zum<br />
zweiten Mal auf Deutsch übertragen<br />
wurde, seit er 1935 im Original erschienen<br />
ist, nimmt ihr bekannter Witz keine<br />
Rücksicht auf die Nächsten. Die da<br />
waren: sechs Geschwister, darunter<br />
zwei glühende Hitler-Verehrerinnen<br />
(die eine, Guinness-Erben-Gattin, liess<br />
sich scheiden, um den Faschistenführer<br />
Sir Oswald Mosley zu ehelichen). In<br />
Porträts <strong>von</strong> beissendem Spott lässt die<br />
Autorin Nancy Mitford die Verwandtschaft<br />
auftreten. Eine Neuauflage verhinderte<br />
sie 1951: Zu viel Grausames sei<br />
im Krieg geschehen. Aus heutiger Sicht:<br />
Eine grossartige Groteske!<br />
Regula Freuler<br />
29. Januar 2012 ❘ NZZ am Sonntag ❘ 11
<strong>Essay</strong><br />
<strong>Charles</strong> <strong>Dickens</strong> (1812–1870) mutet seinen Leserinnen und Lesern ganz<br />
viel Kitsch zu, schreibt aber so unvergesslich wie kein zweiter Autor.<br />
<strong>Andreas</strong> <strong>Isenschmid</strong> hat mit dessen Werk einige Lesewochen verbracht<br />
Verliebt in<br />
die Romane eines<br />
200-Jährigen<br />
Alle, soweit sie Klassiker lesen, halten es mit<br />
Stendhal, Flaubert und, etwas seltener vielleicht,<br />
mit Balzac. Alle lesen Jane Austen und<br />
George Eliot. Aber <strong>Charles</strong> <strong>Dickens</strong>? Er ist eher<br />
eine Angelegenheit des gehobenen (und gekürzten)<br />
Jugendbuches, ferner ein englischer<br />
Nationalsport. Aber wirklich gelesen wird er,<br />
einer repräsentativen Langzeitbeobachtung<br />
meines Lesefreundeskreises zufolge, kaum.<br />
«Mit <strong>Dickens</strong> hatte ich immer Mühe» – keinen<br />
Satz habe ich in den zurückliegenden Wochen<br />
meiner <strong>Dickens</strong>-Lektüre häufiger gehört.<br />
Dabei ist es kinderleicht, sich in den alten <strong>Dickens</strong><br />
zu verlieben. Meine todsichere <strong>Dickens</strong>-<br />
Verführungsanthologie besteht aus den ersten<br />
dreissig Seiten seiner drei besten Romane. Wer<br />
die Anfangskapitel <strong>von</strong> «Bleakhaus», <strong>von</strong> «Grosse<br />
Erwartungen» und <strong>von</strong> «Unser gemeinsamer<br />
Freund» liest, um den ist es geschehen. Es wer-<br />
<strong>Charles</strong> <strong>Dickens</strong><br />
Vor 200 Jahren, am 7. Februar 1812, kam<br />
<strong>Charles</strong> <strong>Dickens</strong> zur Welt, am 9. Juni 1870 ist er<br />
gestorben. Wer sein produktives Leben verfolgen<br />
will, findet in Hans-Dieter Gelferts Biografie<br />
einen verlässlichen Begleiter, der auch die<br />
wichtigsten Werke vorstellt (C. H. Beck, 380<br />
Seiten, Fr. 40.90). Hinreissend geschrieben ist<br />
Claire Tomalins englischsprachige Biografie mit<br />
fabelhaften Bildern (Penguin, 530 S., Fr. 29.50).<br />
Wie der Jüngling <strong>Dickens</strong> sich über Nacht in<br />
einen Literaturstar verwandelte, zeigt Robert<br />
Douglas-Fairhurst in «Becoming <strong>Dickens</strong>»<br />
(Harvard University Press, 390 S., Fr. 39.90).<br />
Die feinsten Neuübersetzungen stammen <strong>von</strong><br />
Melanie Walz: Sie hat den späten Roman<br />
«Grosse Erwartungen» herausgegeben (Hanser,<br />
830 S., Fr. 46.90) und die teils erstmals<br />
übersetzten Reportagen «Reisender ohne<br />
Gewerbe» (C. H. Beck, 128 S., Fr. 21.90).<br />
12 ❘ NZZ am Sonntag ❘ 29. Januar 2012<br />
den in seinem imaginären Lesermuseum einige<br />
Szenen, Figuren und Stimmungen auf ewig mit<br />
einer Kraft strahlen, wie sie bei den oben genannten<br />
Klassikern eher selten vorkommt.<br />
Nehmen wir die Ouvertüre der «Grossen Erwartungen»,<br />
die Hanser in einer fabelhaft kommentierten<br />
Übersetzung neu herausgebracht<br />
hat. <strong>Dickens</strong> war 48 Jahre alt, als er das Buch<br />
begann, neben «David Copperfield» sein einziger<br />
durchgängig in der ersten Person erzählter<br />
Roman. Und wie «Copperfield» und «Oliver<br />
Twist» beginnt er in der Welt eines Kindes.<br />
Pip, wie der Held heisst, mag sechs, sieben<br />
Jahre alt sein, als er am Tag vor Weihnachten,<br />
«an einem denkwürdigen nasskalten Nachmittag,<br />
der sich zum Abend neigte», seine «erste<br />
und eindringliche Vorstellung <strong>von</strong> der wahren<br />
Beschaffenheit der Dinge» erhält. Erst begreift<br />
er auf dem Friedhof vor den Grabsteinen seiner<br />
Eltern und Geschwister aufs mal, was er und<br />
seine Welt sind: dass er ein Waise ist, dass das<br />
feuchte, <strong>von</strong> Gräben und Schleusen durchzogene<br />
Marschland seine Heimatgegend ist und<br />
«dass das kleine Espenlaubbündel, das sich vor<br />
alledem zu fürchten und zu weinen begann, Pip<br />
war». Im gleichen Augenblick begreift er auch,<br />
wie diese Welt ist: finster und brutal. Ein<br />
schrecklich aussehender Mann mit einem grossen<br />
Eisen am Bein, ein Sträfling, wie sich zeigen<br />
wird, springt zwischen den Gräbern hervor,<br />
herrscht ihn an, hält ihn an den Füssen in die<br />
Luft und fordert ihn unter brutalsten Todesandrohungen<br />
auf, ihm am andern Morgen Esswaren<br />
und eine Feile zu bringen.<br />
Es liesse sich nun lange weiter resümieren,<br />
wie Pip nach Hause geht, unter Qualen stiehlt,<br />
sich im Frühnebel rausschleicht und wie<br />
schliesslich mitten im Weihnachtsmahl, gerade<br />
als sein Diebstahl aufzufliegen droht, Soldaten<br />
auf der Suche nach entflohenen Sträflingen ins<br />
Haus dringen. Zum Schluss ist Pip auf dem Rücken<br />
seines Pflegevaters in einfallender Nacht<br />
und im eisigen Graupelschauer dabei, als die<br />
Sträflinge wie in einer BBC-News-Sendung <strong>von</strong><br />
heute unter Geschrei, Schüssen, Fackellicht<br />
blutend aus einem Schlammgraben gezogen<br />
und in Handschellen gelegt werden.<br />
Aber Literatur lässt sich nicht zusammenfassen,<br />
und <strong>Dickens</strong> am wenigsten. Man muss sein<br />
erzählerisches Grossgenie haben, um auf dreissig,<br />
vierzig Seiten eine so dichte, tiefe, stim-<br />
Es ist bekannt, dass <strong>Dickens</strong><br />
aus dem Schicksal <strong>von</strong><br />
Kindern in seelischem und<br />
körperlichem Elend<br />
literweise sentimentalen<br />
Kitsch-Sirup gepresst hat.<br />
mungsstarke und komplexe Welt zu erzeugen,<br />
wie sie uns in den Eröffnungen <strong>von</strong> seinen grossen<br />
Romanen begegnet. Im Vergleich zu diesem<br />
Vollkorn sind nicht wenige andere Klassiker<br />
bleiches Toastbrot. Kommt dazu, dass in <strong>Dickens</strong><br />
dichter Ouvertüre der «Grossen Erwartungen»<br />
zugleich der ganze <strong>Dickens</strong>-Kosmos<br />
symbolisch drinsteckt.<br />
Lebenstrauma des Autors<br />
Welches sind die Elemente des <strong>Dickens</strong>-Kosmos?<br />
Zuallererst sind es Kinder in seelischem<br />
und körperlichem Elend. Zur Arbeit gezwungene<br />
Kinder wie Oliver Twist. Geschlagene Kinder<br />
wie Pip, Waisen- und Heimkinder, Kinder<br />
mit einer tiefen Sehnsucht nach Wärme, Familie,<br />
Aufgehobenheit. Dass <strong>Dickens</strong> aus dem<br />
Schicksal dieser Kinder literweise sentimentalen<br />
Kitsch-Sirup gepresst hat, ist bekannt. Man<br />
«müsse ein Herz aus Stein haben, um bei Little<br />
Nells Tod nicht in Lachen auszubrechen», geht<br />
ein böses Wort Oscar Wildes zur Heldin des<br />
Romans «Der Raritätenladen»; <strong>Dickens</strong> hat es<br />
sich redlich verdient. Aber die Menge, die im
<strong>Charles</strong> <strong>Dickens</strong> (1812–1870) mit zwei seiner Töchter, der Schriftstellerin Mary <strong>Dickens</strong> und der Malerin Kate <strong>Dickens</strong>, um 1865.<br />
29. Januar 2012 ❘ NZZ am Sonntag ❘ 13<br />
BRIDGEMANART
<strong>Essay</strong><br />
Szene aus dem Film «Great Expectations» (1974), einer amerikanischen Verfilmung des <strong>Dickens</strong>-Romans.<br />
Hafen <strong>von</strong> New York dem Schiff, das die letzte<br />
Fortsetzung des «Raritätenladens» nach Amerika<br />
brachte, voller Angst entgegenrief «Ist Little<br />
Nell tot?», war auch nicht blöd. In <strong>Dickens</strong><br />
Kindern steckt ein Leiden und Sehnen, das<br />
allen Kitsch übersteigt.<br />
Das alles hat natürlich mit <strong>Dickens</strong>' Lebenstrauma<br />
zu tun: als er zwölf Jahre alt war, haben<br />
ihn seine Eltern wegen finanzieller Nöte für ein<br />
Jahr zur Arbeit in eine Schuhwichsfabrik weggesperrt,<br />
bald darauf kam sein Vater für kurze<br />
Zeit ins Gefängnis. Diese Erfahrung war für <strong>Dickens</strong><br />
so traumatisierend, dass er sie sein Leben<br />
lang nur einem einzigen Menschen erzählt hat,<br />
sie aber doch lebenslänglich hinausschrie,<br />
indem er sie in all seine Bücher hineinschrieb.<br />
Ein nach seinem Tod publiziertes autobiografisches<br />
Fragment über diese Erfahrung wirkt bis<br />
in zahlreiche wörtliche Übereinstimmungen<br />
hinein – wie ein Brühwürfel all seiner Werke.<br />
Romantechnischer Grossmeister<br />
Doch dieses Trauma wäre keiner Erwähnung<br />
wert, wenn <strong>Dickens</strong> es nicht so meisterlich umgesetzt<br />
hätte. Einzigartig in der Weltliteratur ist<br />
seine feine Darstellung des kindlichen Seelenlebens.<br />
Hinreissend ist aber auch, wie er das<br />
kindliche Sehnen ins Grosse, in die Handlun -<br />
gen und Baupläne seiner Romane übersetzt.<br />
<strong>Dickens</strong> ist der romantechnische Grossmeister<br />
der Familienzusammenführung.<br />
Familienkons truktion ist oft geradezu der<br />
Handlungsmotor seiner Bücher. Allenthalben<br />
finden Elende und Reiche, Adlige und Depravierte<br />
in abenteuerlichen Handlungsverschlingungen<br />
als Eltern und deren verlorene, vergessene,<br />
totgeglaubte Kinder zueinander. Der Sträfling,<br />
der Pip am Anfang des Romans bedroht,<br />
wird als sein verkannter Wohltäter ihm den sozialen<br />
Aufstieg zu verschaffen versuchen, den<br />
seine Eltern ihm schuldig bleiben mussten. Zugleich<br />
wird dieser Sträfling sich als der Vater<br />
der <strong>von</strong> Pip lebenslang angebeteten kalten<br />
Schönheit Estella herausstellen. Auch für Estellas<br />
einst ganz elende Mutter hat <strong>Dickens</strong> ein<br />
warmes Romanplätzchen arrangiert.<br />
14 ❘ NZZ am Sonntag ❘ 29. Januar 2012<br />
Interessanter als dieses Plätzchen ist aber die<br />
Herkunft der Mutter. Bevor sie Haushälterin<br />
(und Geliebte?) eines der abertausend Rechtsanwälte<br />
wurde, die <strong>Dickens</strong> Werk bevölkern,<br />
war sie eine gewalttätige Landstreicherin, Herumtreiberin,<br />
Mörderin. Sie ist eine der zahllosen<br />
Figuren, die <strong>Dickens</strong> Bücher – zweites Element<br />
des <strong>Dickens</strong>-Kosmos – zu einer sozialgeschichtlichen<br />
Enzyklopädie der armen Klassen<br />
machen. In <strong>Dickens</strong> Büchern ist die Lebenswirklichkeit<br />
der einfachen und armen Menschen<br />
so umfassend und so leuchtend dargestellt<br />
wie in keinem anderen Werk der Weltliteratur.<br />
Gewiss kannte auch Cervantes die einfachen<br />
Leute, Flaubert hat die Geschichte einer<br />
<strong>Dickens</strong> Blick auf das<br />
schmutzstarrende, dunkle,<br />
elende London, auf die<br />
einstürzenden Häuser der<br />
Armen ist grossartig und<br />
unvergleichlich.<br />
Magd geschrieben, Tolstoi wandte sich den<br />
Knechten zu, und Zola zeigte, was es bei <strong>Dickens</strong><br />
noch nicht gibt, Arbeiter im modernen<br />
Sinn. Aber <strong>Dickens</strong> Blick auf das schmutzstarrende,<br />
dunkle London, auf die alle Augenblicke<br />
einstürzenden Häuser der Armen, auf den elenden<br />
«Streifen vorstädtischer Sahara» ist grossartig<br />
und unvergleichlich. Bei <strong>Dickens</strong> und nur<br />
bei ihm bekommen die Halbwahnsinnigen, um<br />
die wir im städtischen Alltag einen grossen<br />
Bogen machen, ihren ausführlichen Auftritt.<br />
Jede Gesellschaft wendet vor ihren elendesten<br />
Realitäten den Blick weg – <strong>Dickens</strong> zwang die<br />
seine hinzusehen. Das ist der bis heute unendlich<br />
bewegende christliche Teil in ihm.<br />
Schliesslich kombiniert sich, nächstes Element<br />
seines Kosmos, sein sozialer Blick mit<br />
einem kritischen politischen Urteil. Er liebt<br />
DDP IMAGES<br />
noch die geringsten unter seinen Menschenbrüdern,<br />
aber den Adel und die herrschenden<br />
politischen Eliten übergiesst er mit ätzendem<br />
Spott. Selten merkt man das stärker als am Anfang<br />
<strong>von</strong> «Unser gemeinsamer Freund», beim<br />
Wechsel <strong>von</strong> der teilnehmenden, dunkel leuchtenden<br />
Schilderung der Leichenfischer in<br />
der Themse zur kalten und ganz und gar modernen<br />
Satire auf ein Diner bei den neureichen<br />
Veneerings. Das hätte Tom Wolfe nicht besser<br />
gekonnt. Doch all das wird übertroffen <strong>von</strong> der<br />
Schilderung des Kanzleigerichts am Anfang<br />
<strong>von</strong> «Bleakhaus». Der amerikanische Starkritiker<br />
Harold Bloom, der <strong>Dickens</strong> über Tolstoi<br />
und neben Shakespeare stellt, hat das feine Argument<br />
formuliert, erst Kafka habe uns geholfen,<br />
diesen Anfang richtig zu sehen: als Darstellung<br />
einer Rechtskrake, die alle Menschen so<br />
unentrinnbar bannt und vernichtet wie das System<br />
in Kafkas «Prozess».<br />
Verwandlung ins Märchenhafte<br />
In der Beschreibung des Kanzleigerichts enthüllt<br />
sich schliesslich das letzte Element des<br />
<strong>Dickens</strong>-Kosmos. Man kann es das mythische<br />
Element nennen. <strong>Dickens</strong> hat für seine Beschreibung<br />
des Kanzleigerichts zwar ausführlich<br />
recherchiert, aber zugleich gibt er dem Gericht<br />
durch die Art seiner Beschreibung eine<br />
mythische Qualität. Er verwandelt eine wohlbekannte<br />
Londoner Institution, indem er sie in<br />
Düsternis, Nebel und Russ hüllt in einen dunkel<br />
drohenden Höllenschlund. Diese Verwandlung<br />
reporterhaft realistischer Beschreibungen – <strong>Dickens</strong><br />
begann als Reporter – in etwas Überwirkliches<br />
ereignet sich in vielen seiner Romane.<br />
Ausser in mythische Dimensionen kann sie<br />
auch ins Märchenhafte, in die Legende, in die<br />
Romanze zielen. Immer wieder wehen jedenfalls<br />
anderweltliche Schleier und Vorhänge<br />
durch <strong>Dickens</strong>' Hardcore-Realismus. Und oft<br />
haben diese Stellen, an denen einem ganz anders<br />
wird, mit den kühn überraschenden Identitätsumschwüngen<br />
des Autors zu tun: der im<br />
finstersten Loch verstorbene Drogensüchtige<br />
entpuppt sich als der Liebhaber der schönsten<br />
aller schönen und unerreichbaren Ladys – und<br />
schon wird die so undurchdringliche Realität<br />
auf etwas ganz anderes durchsichtig.<br />
Aber: so viele Gründe es gibt, sich in <strong>Dickens</strong><br />
zu verlieben, reichen sie auch für die Verwandlung<br />
der Verliebtheit in Liebe? Zahllose ausschweifende<br />
<strong>Dickens</strong>leser haben genau das bezweifelt.<br />
Kafka stiess sich an den «Stellen grauenhafter<br />
Kraftlosigkeit, wo er müde nur das<br />
bereits Erreichte durcheinanderrührt. Barbarisch<br />
der Eindruck des unsinnigen Ganzen».<br />
Arno Schmidt: «Der frühe und mittlere <strong>Dickens</strong><br />
liefert das peinliche Schauspiel eines Schriftstellers,<br />
der sein Handwerk liederlich betreibt<br />
– ein ‹Meister der Fehlkonstruktion›». Am härtesten<br />
ist George Orwells <strong>Dickens</strong>-<strong>Essay</strong>, eine<br />
aus Liebe geschriebene, unendlich kluge Vernichtung.<br />
Niemand erreiche <strong>Dickens</strong> «im Vermögen,<br />
bildliche Vorstellungen zu evozieren.<br />
Wenn <strong>Dickens</strong> etwas einmal beschrieben hat,<br />
sieht man es für den Rest seines Lebens». Nur<br />
sei <strong>Dickens</strong> leider ein Autor, «bei dem die Teile<br />
wichtiger sind als das Ganze. Er besteht ganz<br />
aus Fragmenten, ganz aus Details – scheussliche<br />
Architektur, aber wunderbare Wasserspeier.»<br />
Freilich muss man auch die Wasserspeier<br />
oft quälend lange suchen. Denn <strong>Dickens</strong> quält<br />
seine Leser nicht selten mit endlosen, völlig<br />
überflüssigen, komplett statischen Beschreibungen,<br />
er martert sie mit Handlungen, die absurd<br />
verwinkelt, vollkommen unwahrscheinlich<br />
und kaum zu behalten sind. Doch gerade<br />
wenn man es mit einem seiner Bücher wieder<br />
mal aufgeben will, läuft man in eine dieser unvergesslichen<br />
Stellen, und es geht mit der Verliebtheit<br />
wieder los. l
GAËTAN BALLY / KEYSTONE<br />
Kolumne<br />
<strong>Charles</strong> Lewinskys Zitatenlese<br />
<strong>Charles</strong> Lewinsky ist<br />
Schriftsteller und<br />
arbeitet in den<br />
verschiedensten<br />
Sparten. Sein letzter<br />
Roman «Gerron» ist<br />
2011 bei Nagel &<br />
Kimche erschienen.<br />
Wer in der wirklichen<br />
Welt arbeiten und in der<br />
idealen leben kann, der<br />
hat das Höchste erreicht.<br />
Ludwig Börne<br />
Ist es Ihnen auch aufgefallen? Seit einiger<br />
Zeit stehen hinter dem Autorenvermerk<br />
<strong>von</strong> Artikeln immer häufiger die<br />
Worte: «Lebt und arbeitet in . . .»<br />
Sprachschludernde Redakteure hauen<br />
den Satz unterdessen so automatisch in<br />
die Tastatur, wie Werbeleute über ein<br />
hunderttausendfach verbreitetes Flugblatt<br />
die Lüge setzen: «Ihr ganz persönliches<br />
Angebot».<br />
Was müssen das für Autoren sein,<br />
frage ich mich, die darauf bestehen, der<br />
Öffentlichkeit mitzuteilen, dass sie in<br />
London, New York oder Bümpliz nicht<br />
etwa nur leben, sondern – welche<br />
Überraschung! – auch arbeiten? Oder<br />
verstehe ich den Satz falsch, und die eigentliche<br />
Botschaft lautet: «Ich arbeite<br />
nicht nur, sondern – wer hätte das gedacht?<br />
– ich lebe auch»?<br />
Seit wann, frage ich mich weiter, sind<br />
Leben und Arbeiten zwei so ganz und<br />
gar verschiedene Dinge, dass man sie in<br />
einer biografischen Notiz separat anführen<br />
muss? Stellen diese Autoren ihr<br />
Leben ein, während sie am Computer<br />
sitzen? Sagen sie ihrer Frau am Telefon:<br />
«Ich schreibe nur noch diesen Artikel<br />
zu Ende, Schatz, aber pünktlich um<br />
halb sieben fange ich wieder an zu<br />
leben»?<br />
Oder, wenn wir schon mal am Ausdeuten<br />
sind, finden sie vielleicht vor<br />
allem mitteilenswert, dass sie diese beiden<br />
so ungeheuer verschiedenen Tätigkeiten<br />
aus irgendeiner Marotte heraus<br />
tatsächlich in der gleichen Stadt ausüben?<br />
Soll der Leser darüber staunen,<br />
dass sie nicht etwa in Melbourne leben<br />
und gleichzeitig ihrer beruflichen<br />
Tätigkeit in Stockholm nachgehen?<br />
(«Wissen Sie, ich komme auf den täglich<br />
dreissig Stunden Flug so schön<br />
zum Lesen.»)<br />
Oder steckt hinter der verquasten<br />
Formulierung überhaupt keine inhaltliche<br />
Bedeutung? Macht im Kindergarten<br />
des Journalismus jeder den gleichen<br />
Sprachpurzelbaum, nur weil ihn der andere<br />
auch gemacht hat? Ist das Ganze<br />
nur – um eines der schönsten Sprachbilder<br />
<strong>von</strong> Karl Kraus seinem ursprünglichen<br />
Kontext zu entfremden – der<br />
Versuch, auf einer Glatze Locken zu<br />
drehen?<br />
Ich weiss es nicht. Ich beobachte nur,<br />
dass sich diese Formulierungsseuche<br />
immer weiter ausbreitet und dass<br />
immer noch – Wo bleibt die chemische<br />
Industrie, wenn man sie wirklich<br />
braucht? – niemand ein wirksames Mittel<br />
dagegen entwickelt hat.<br />
Ich kann Ihnen lediglich versichern:<br />
Während ich diese paar<br />
Zeilen zu Computer<br />
brachte, habe ich sowohl<br />
gearbeitet als auch<br />
gelebt.<br />
Kurzkritiken Sachbuch<br />
Esther Girsberger: Eveline Widmer-<br />
Schlumpf. Die Unbeirrbare. Orell Füssli,<br />
Zürich 2012. 208 Seiten, Fr. 29.90.<br />
Im Geheimen vorbereitet, wurde das<br />
Buch exakt am Tag der Wiederwahl <strong>von</strong><br />
Eveline Widmer-Schlumpf am 14. Dezember<br />
angekündigt. In neun Gesprächen<br />
zwischen Herbst 2010 und Juli 2011<br />
befragte Esther Girsberger die BDP-<br />
Bundesrätin über Familienpolitik, Zuwanderung,<br />
Bankgeheimnis und andere<br />
Themen. Viele Ansichten der «unbeirrbaren»<br />
EWS sind bekannt. Aufschlussreich<br />
sind ihre Antworten über den Tod<br />
ihrer Schwester, ihr Verhältnis zur<br />
Macht, oder wenn sie eingesteht, dass<br />
sie bei der Kinder-Betreuungsverordnung<br />
«einen Bock geschossen» habe.<br />
Deutlich wird auch, wie früh die Differenzen<br />
zu Christoph Blocher aufgebrochen<br />
sind: beim Zwist um die EWR-Abstimmung<br />
1992 und die «Messerstecher-<br />
Inserate» 1993. Der Studienkollege und<br />
frühere Preisüberwacher Werner Marti<br />
umschreibt EWS’ Charakter treffend mit<br />
einem Kletter-Begriff: «Free Solo».<br />
Urs Rauber<br />
Philipp Blom (Hrsg.): Angelo Soliman.<br />
Ein Afrikaner in Wien. Ausstellungskatalog.<br />
Brandstätter, Wien 2011. 248 S., Fr. 40.90.<br />
Das Umschlagporträt des schönen<br />
Schwarzen mit Turban, gekleidet in ein<br />
fürstliches Gewand des europäischen 18.<br />
Jahrhunderts, weckt Neugier. In Wien<br />
ist Angelo Soliman (1721–1796) eine<br />
stadtbekannte Grösse, über deren Ende<br />
man aber nicht gerne spricht. Soliman<br />
wurde nach seinem Tod gehäutet, wie<br />
ein Tier ausgestopft und im kaiserlichen<br />
Naturalienkabinett als halbnackter Wilder<br />
zur Schau gestellt. Das rassistische<br />
Bild des Mohren hatte im letzten Augenblick<br />
Überhand gewonnen. Soliman,<br />
einst Sklave aus der Sahelzone, hatte<br />
sich emporgearbeitet, war hochgebildet,<br />
Freimaurer, Lehrer <strong>von</strong> Fürstensprösslingen<br />
und Gesprächspartner <strong>von</strong> Kaiser<br />
Joseph II. Alles in allem das geglückte<br />
Leben eines Migranten, ein Erfolg der<br />
Aufklärung. Mit der Schändung seines<br />
Leichnams verwies die Gesellschaft Soliman<br />
aber wieder in die alte Ecke.<br />
Geneviève Lüscher<br />
Otto Stich: Ich blieb einfach einfach.<br />
Autobiografie mit Texten <strong>von</strong> I. Bachmann.<br />
Schwabe, Basel 2011. 144 Seiten, Fr. 28.–.<br />
Der gerade 85 gewordene Otto Stich ist<br />
der Prototyp eines schweizerischen<br />
Dorfpolitikers: bodenständig, bieder,<br />
pragmatisch und bauernschlau. Mit 30<br />
wird der Arbeitersohn erster (und bisher<br />
einziger) sozialdemokratischer Gemeindepräsident<br />
<strong>von</strong> Dornach (SO).<br />
Mit 36 rückt er in den Nationalrat nach,<br />
bleibt dort aber ein Hinterbänkler. Bis er<br />
1983 gegen den Willen seiner Partei <strong>von</strong><br />
den Bürgerlichen zum Bundesrat gewählt<br />
wird. Die Bankiervereinigung<br />
würdigte den ebenso sozialen wie eigensinnigen<br />
Politiker nach seinem Rücktritt<br />
1995 als «hervorragenden Finanzminister».<br />
Nun plaudert Stich frank und frei<br />
über Internas aus dem Bundesrat, stichelt<br />
gegen Adolf Ogi und zieht über die<br />
legendäre «SP-Viererbande» (Gerwig,<br />
Hubacher, Uchtenhagen und Renschler)<br />
her. Der «hartgrindige Schwarzbube»<br />
bleibt sich selber auch in seiner schmalbrüstigen<br />
Autobiografie treu.<br />
Urs Rauber<br />
Daniela Kuhn: Zwischen Stall und Hotel.<br />
15 Geschichten aus Sils im Engadin. Limmat,<br />
Zürich 2012. 180 Seiten, Fr. 34.–.<br />
Christina Godley führt die Stüva Marchetta,<br />
ihre Schwester Maria die Pensiun.<br />
Bis heute arbeiten sie sieben lange<br />
Tage in der Woche, wie es schon ihre<br />
Mutter tat, in Küche, Gaststube und<br />
Garten. Sils, darin sind sie sich einig, ist<br />
zu gross geworden: «Früher war man<br />
überall zu Hause – heute vermögen es<br />
die Hiesigen kaum mehr, hier zu wohnen.»<br />
Die Schwestern sind zwei <strong>von</strong> 17<br />
«echten» Silsern und Silserinnen, die<br />
die Journalistin Daniela Kuhn aus ihrem<br />
Leben erzählen lässt. Sie haben in Gastgewerbe<br />
und Landwirtschaft, als Schreiner,<br />
Kutscher oder Skilehrer gearbeitet.<br />
Sie erinnern sich an illustre Gäste – General<br />
Guisan! –, an Zeiten, als die Touristen<br />
vor allem im Sommer kamen und<br />
noch jeder im Dorf einen Stall hatte. Sie<br />
lassen ein altes Sils aufleben, das schon<br />
heute <strong>von</strong> der Luxus-Tourismus-Fassade<br />
verdeckt, bald ganz verschwinden wird.<br />
Kathrin Meier-Rust<br />
29. Januar 2012 ❘ NZZ am Sonntag ❘ 15
Sachbuch<br />
Geschichte Lange schwankte das historische Urteil über den<br />
preussischen König Friedrich II. zwischen Verehrung und<br />
Verdammung. Heute steht seine Ambivalenz im Vordergrund<br />
Friedrich<br />
der Grosse<br />
Christian Graf <strong>von</strong> Krockow: Friedrich der<br />
Grosse. Ein Lebensbild. Lübbe, Köln 2012<br />
(Neuauflage). 224 Seiten, Fr. 31.50.<br />
Ute Frevert: Gefühlspolitik. Friedrich II.<br />
als Herrscher über die Herzen?<br />
Wallstein, Göttingen 2012. 159 S., Fr. 24.50.<br />
Johannes Bronisch: Der Kampf um<br />
Kronprinz Friedrich. Wolff gegen Voltaire.<br />
Landt, Berlin 2011. 125 Seiten, Fr. 28.50.<br />
Von Kathrin Meier-Rust<br />
Philosophenkönig mit Flöte oder zynischer<br />
Machtpolitiker, der Adolf Hitler<br />
zum Präventivkrieg inspirierte – lange<br />
schwankte das Urteil über Friedrich den<br />
Grossen zwischen kultischer Verehrung<br />
und absoluter Verdammung. Noch Helmut<br />
Schmidt liess als frischgekürter<br />
Verteidigungsminister die Büste Friedrichs<br />
aus seinem Büro entfernen. Doch<br />
mit den grossen preussischen Jubiläumsjahren<br />
– zum 200-jährigen Todestag<br />
des Königs 1986, zum 300-jährigen Jubiläum<br />
des preussischen Königtums 2001<br />
Friedrich der Grosse<br />
Friedrich II. wird am 24. Januar 1712 als<br />
ältester Sohn des preussischen Königs<br />
Friedrich Wilhelm I. und seiner Gattin<br />
Sophie Dorothea in Berlin geboren.<br />
1736 bezieht der Kronprinz das Schloss<br />
Rheinsberg und widmet sich dem<br />
Studium der Philosophie, Geschichte<br />
und Poesie. 1740 wird er zum König <strong>von</strong><br />
Preussen gekrönt.<br />
Friedrich II., auch Friedrich der Grosse<br />
genannt, gilt als Repräsentant des aufgeklärten<br />
Absolutismus. Er führt zahlreiche<br />
Reformen in Justiz und Verwal tung<br />
durch und versteht sich als «Erster<br />
Diener des Staates». Unter seiner<br />
Herrschaft etabliert sich Preussen als<br />
europäische Grossmacht. Am 17. August<br />
1786 stirbt Friedrich in Potsdam.<br />
16 ❘ NZZ am Sonntag ❘ 29. Januar 2012<br />
und nun zum 300-jährigen Geburtstag<br />
des Königs am 24. Januar 2012 – ist das<br />
Urteil der Historiker ausgewogener geworden,<br />
steht die abgründige Ambivalenz<br />
dieser Figur im Vordergrund.<br />
Geblieben ist die Faszination des Königs<br />
und seines an Drama so reichen Lebens.<br />
Rund zwei Dutzend <strong>Neue</strong>rscheinungen<br />
sollen es sein in diesem Winter:<br />
nebst mehreren Biografien etwa die<br />
Erstpublikation der Vortragsnotizen des<br />
grossen Basler Historikers Jacob Burckhardt<br />
zu seiner Vorlesung über «Das<br />
Zeitalter Friedrichs des Grossen» (C. H.<br />
Beck), neue Darstellungen des Vater-<br />
Sohn-Konfliktes (Pieper) oder <strong>von</strong><br />
Friedrich als Musiker (C. H Beck) bis<br />
hin zum Friedrich-der-Grosse-Gedächtnisspiel.<br />
Wo also anfangen?<br />
Empfehlenswerter Klassiker<br />
Wer einen ersten Zugang sucht greift<br />
mit Gewinn zu einem preussischen<br />
Klassiker, wie ihn nebst Sebastian Haffner<br />
(«Preussen ohne Legende») oder<br />
Marion Gräfin Dönhoff («Preussen –<br />
Mass und Masslosigkeit») auch Christian<br />
Graf <strong>von</strong> Krockow verfasst hat (1986,<br />
Neuauflage Lübbe 2012). Der aus pommerschem<br />
Adel stammende Historiker<br />
lehrte an verschiedenen deutschen Universitäten.<br />
In seinem «Lebensbild»<br />
Friedrichs II. versteht er es auf glänzende<br />
Weise, das biografische Drama dieses<br />
Königs mit seiner überragenden Bedeutung<br />
für die europäische Geschichte<br />
immer neu zu verflechten.<br />
Hier findet sich alles: Die Kindheit<br />
und Jugend im Zeichen des gewalttätigen<br />
«Soldatenkönigs» Friedrich Wilhelm<br />
I., dem sein intellektuell und musisch<br />
begabter Sohn geradezu physisch<br />
zuwider ist; nach dem Fluchtversuch<br />
des 18-Jährigen lässt er diesen in den<br />
Kerker werfen und die Hinrichtung des<br />
Freundes Katte mit ansehen. Die weitgehend<br />
autodidaktische Bildung des Kronprinzen<br />
zum schöngeistigen Aufklärer,<br />
der in den ersten Tagen seiner Regierung<br />
Folter und Zensur abschafft (nicht<br />
für lange allerdings) und in Preussen<br />
Religionstoleranz verkündet, nach dem<br />
berühmten Motto «Ein jeder muss nach<br />
seiner Façon selig werden». Und der<br />
dann wenige Monate später mit der<br />
Armee, die sein Vater geschaffen hatte,<br />
das österreichische Schlesien überfällt.<br />
Der diesen Raub durch drei Kriege hindurch<br />
gegen eine Übermacht der europäischen<br />
Grossmächte verteidigt und<br />
doch den Siebenjährigen Krieg nur dank<br />
einem Wunder übersteht: dem «Mirakel<br />
des Hauses Brandenburg», das darin besteht,<br />
dass die Zarin Elisabeth rechtzeitig<br />
stirbt.<br />
Es findet sich die Freundschaft des<br />
Königs mit Voltaire, die mit der Flucht<br />
des Spötters ein bitteres Ende nimmt.<br />
Sein tiefgründiger Hass auf Frauen,<br />
nicht nur weil mit Maria Theresia in Österreich,<br />
Elisabeth in Russland und Madame<br />
Pompadour in Frankreich Preussens<br />
Erzfeinde sozusagen ein weibliches
Gesicht hatten. Der männerbündische<br />
Geist, der Preussens Geschichte prägt,<br />
und die zynische Menschenverachtung,<br />
die den alternden König verbittern und<br />
vereinsamen liess. Der historische<br />
Ruhm, den er fand, weil er aus dem Flickenteppich<br />
der mausarmen «Sandbüchse»<br />
am Rande Europas einen modern<br />
verwalteten Militärstaat machte,<br />
und der Abscheu, weil er dafür kaltherzig<br />
eine Million Tote und die Verheerung<br />
seines Landes in Kauf nahm.<br />
Einen neuen Zugang sucht die renommierte<br />
Historikerin Ute Frevert: Als<br />
Vertreterin der «emotionalen Wende»<br />
in der Kulturwissenschaft fragt sie nach<br />
der «Gefühlspolitik» Friedrich des<br />
Gros sen. Damit meint sie nicht etwa die<br />
wahren Gefühle des Königs, die schlicht<br />
nicht zu ergründen seien. Vielmehr geht<br />
es ihr um Gefühle als Werkzeuge des politischen<br />
Handelns, wie sie in der Politik<br />
längst selbstverständlich sind, man<br />
denke etwa an den Kniefall Willy<br />
Brandts im Warschauer Ghetto. Es geht<br />
darum, wie der König Gefühle einsetzte,<br />
in Propaganda, Rhetorik und Selbstdarstellung,<br />
um die Zustimmung, ja gar die<br />
Liebe seiner Untertanen zu wecken.<br />
Denn just dies hatte der junge Kronprinz<br />
in seinem berühmten Traktat vom<br />
«Antimacchiavell» verlangt: dass ein<br />
Fürst als «erster Diener seines Staates»<br />
nicht Furcht, sondern Liebe wecke in<br />
seinen Untertanen und «Herr über die<br />
Herzen» werde.<br />
Gelang es Friedrich in seinen 46 Regierungsjahren<br />
Herr der Herzen zu sein?<br />
Ute Frevert vermag die Frage nicht<br />
wirklich zu beantworten. Zwar zog der<br />
König alle richtigen Register: Er warf<br />
sich persönlich ins Schlachtgetümmel,<br />
er trauerte am Grabe seiner Soldaten<br />
und Generale. Er ermunterte Bitt- und<br />
Klageschriften, die er selbst kaum las,<br />
demonstrierte Frömmigkeit, die er si-<br />
Friedrich der Grosse<br />
spielte auch Flöte.<br />
Hauskonzert in<br />
Sanssouci. Ölbild<br />
<strong>von</strong> Adolph Friedrich<br />
Menzel, 1850–52.<br />
FINE ART IMAGES<br />
cherlich nicht empfand, und nahm, trotz<br />
seiner Abneigung gegen das Zeremoniell,<br />
die althergebrachten Huldigungen<br />
entgegen. Ein eigenes Kapitel widmet<br />
Frevert dem huldvollen Lüpfen des<br />
Hutes, das der berittene König zu praktizieren<br />
pflegte: Gegen 200 Mal, berichtet<br />
ein Augenzeuge, habe er es auf einem<br />
einzigen Ritt durch Berlin getan. Doch<br />
um Liebe zum Volk ging es bei alledem<br />
kaum: Zu selbstverständlich, zu unüberwindlich<br />
war die Distanz eines Monarchen<br />
zu seinen Untertanen.<br />
Keine echte Zuneigung<br />
Noch unklarer bleibt der Unterschied<br />
zwischen echtem Gefühl und handfestem<br />
Interesse auf Seiten dieser Untertanen.<br />
Zwar sangen die Soldaten auf ihren<br />
langen Märschen unaufhörlich Kirchen-<br />
und Königslieder, zwar zirkulierten Königsoden<br />
und Devotionalien aller Art,<br />
doch auch sie beweisen kaum echte Zuneigung.<br />
Zudem bot Friedrich weder<br />
Mätressen und Skandale noch eine eigene<br />
königliche Familie, an der sich die<br />
Neugierde der Untertanen hätte «ab-<br />
arbeiten» können. Und selbst wenn ihn<br />
die Zeitgenossen als «Mensch», als mitfühlenden<br />
und empfindsamen König anriefen,<br />
sieht die Historikerin hierin vor<br />
allem eine Projektion <strong>von</strong> Wünschen.<br />
Insgesamt lässt die offenbar nicht zu beantwortende<br />
Frage den Titel ihres Buches<br />
trotz dem interessanten Material<br />
etwas gar theoretisch bleiben.<br />
Einen Zugang ganz anderer Art bietet<br />
ein schmales Bändchen des Berliner<br />
Historikers Johannes Bronisch. Hier<br />
geht es um eine Episode im Jahr 1736, als<br />
Kronprinz Friedrich 24 Jahre alt war und<br />
das Schloss Rheinsberg bezog, wo er<br />
sich vier Jahre lang seiner Bildung, der<br />
Musik und dem Tischgespräch mit<br />
geistreichen Freunden widmen wird.<br />
Der in sächsischen Diensten ergraute<br />
Diplomat Ernst Christoph <strong>von</strong> Manteuffel<br />
buhlt, wie viele andere, um die Gunst<br />
des Thronfolgers. Mit Hilfe der gut<br />
christlichen Lehren des deutschen Aufklärers<br />
Christian Wolff will er ihn zum<br />
wahrhaft aufgeklärten Herrscher bilden.<br />
Er wird seine Sache schnell und gründlich<br />
verlieren – an den atheistischen<br />
Spötter Voltaire nämlich.<br />
Wie sich die Frage nach der Unsterblichkeit<br />
der Seele mit politischen Intrigen<br />
und einem rätselhaften Pseudonym<br />
verbindet, wie gegensätzliche Strömungen<br />
der Aufklärung mit Machtinteressen<br />
zusammenspielen, insbesondere mit<br />
jenen eines französischen Gesandten,<br />
der mit 100 000 (!) Flaschen französischen<br />
Weins und Voltaires Schriften in<br />
Berlin eintrifft, wie schliesslich Friedrich<br />
auf den weltberühmten Namen<br />
«Sanssouci» kam – all dies wird hier,<br />
reich mit Quellen unterfüttert, erzählt<br />
wie ein Krimi. Anspruchsvoll in seiner<br />
Dichte, ist das Buch doch immer klar<br />
formuliert und zudem wunderschön illustriert.<br />
Wie es uns durch den Sehschlitz<br />
einer kleinen Nebenepisode tief<br />
in die unendliche Vielfalt der historischen<br />
Landschaft des 18. Jahrhunderts<br />
blicken lässt – das ist meisterhafte Geschichtsschreibung.<br />
l<br />
29. Januar 2012 ❘ NZZ am Sonntag ❘ 17
Sachbuch<br />
Aufklärung Gedankenfreiheit und Mündigkeit sind nicht<br />
allein europäische, sondern universelle Werte<br />
Locke, Voltaire,<br />
Kant und andere<br />
Provokateure<br />
Manfred Geier: Aufklärung – Das<br />
europäische Projekt. Rowohlt,<br />
Reinbek 2012. 352 Seiten, Fr. 35.50.<br />
Von Katja Gentinetta<br />
Der Sprach- und Literaturwissenschafter<br />
Manfred Geier legt eine umfangreiche<br />
und wohldokumentierte Geschichte<br />
der Aufklärung vor. Mit der Charakterisierung<br />
der Aufklärung als «europäisches<br />
Projekt» fragt er gleich zu Beginn:<br />
Ist die Aufklärung abgeschlossen? Und:<br />
ist sie universell? Der Ausflug in die Geschichte<br />
lohnt sich.<br />
Anhand der zentralen Figuren John<br />
Locke und dem Third Earl of Shaftesbury<br />
(Anthony Ashley Cooper war ein Philosoph<br />
des frühen 18. Jahrhunderts),<br />
Voltaire und Jean-Jacques Rousseau,<br />
Moses Mendelssohn, Olympe de<br />
Gouges, Wilhelm <strong>von</strong> Humboldt und natürlich<br />
Immanuel Kant, zeichnet der<br />
Autor die philosophische Dynamik des<br />
18. Jahrhunderts nach und füllt die Aufklärung<br />
mit Leben.<br />
Die Geschichte beginnt in England,<br />
und sie beginnt mit einem Abenteuer:<br />
mit Lockes umfangreichen Schriften,<br />
die er bei seiner Rückkehr aus dem holländischen<br />
Exil nach England verpackt<br />
und verschifft hatte – ohne freilich eine<br />
Kopie derselben zu haben. Die Texte<br />
kamen heil an, und mit seinem Plädoyer<br />
für «life, liberty and estate» – der These,<br />
dass sich die Menschen «zum gegenseitigen<br />
Schutz ihres Lebens, ihrer Freiheiten<br />
und ihres Vermögens» zusammengeschlossen<br />
hätten – wird Locke zum<br />
Philosophen der «Glorious Revolution»,<br />
jenes friedlichen Übergangs zur<br />
konstitutionellen Monarchie.<br />
Unter Einsatz des Lebens<br />
Überhaupt ruft das Buch <strong>von</strong> Manfred<br />
Geier in Erinnerung, dass die Gedanken<br />
der Aufklärung nicht einfach in häuslicher<br />
Abgeschiedenheit entwickelt wurden,<br />
um dann ihren natürlichen und ungehinderten<br />
Weg an die Öffentlichkeit<br />
zu finden. Im Gegenteil: Unter teilweisem<br />
Einsatz ihres Lebens entschlossen<br />
sich die Aufklärer, ihre provozierenden<br />
Erkenntnisse zu publizieren. So flüchtet<br />
Locke 1683 ins holländische Exil, um<br />
seine «Discourses Concerning Government»<br />
fertig zu stellen. Voltaires «Lettres<br />
philosophiques», ein Loblied auf die<br />
politische, wirtschaftliche und geistige<br />
18 ❘ NZZ am Sonntag ❘ 29. Januar 2012<br />
Freiheit Englands, werden 1734 in Frankreich<br />
verurteilt, und gegen ihn ergeht<br />
ein Haftbefehl. Diderots «Pensées philosophiques»<br />
werden verbrannt, er<br />
selbst 1749 ins Gefängnis <strong>von</strong> Vincennes<br />
gesteckt. Weil er seine Autorschaft gesteht,<br />
und weil die Verleger der Enzyklopädie<br />
intervenieren, werden ihm<br />
schliesslich Schriftverkehr und Besuche<br />
doch erlaubt.<br />
Die «Encyclopédie» wird später nicht<br />
nur in Frankreich verboten, sondern<br />
auch vom Papst auf den Index gesetzt;<br />
katholischen Besitzern droht die Exkommunikation.<br />
Die Einschätzung dieses<br />
28 Bände umfassenden, in 25 Jahren<br />
<strong>von</strong> mehreren hundert Autoren verfassten<br />
Werks durch die Obrigkeit hätte unmissverständlicher<br />
nicht sein können:<br />
«Die Vorteile eines solchen Werks für<br />
Künste und Wissenschaften können den<br />
irreparablen Schaden für Glauben und<br />
Sittlichkeit niemals aufwiegen.»<br />
Gleichberechtigung für alle<br />
Welche Rolle der Glaube und die Religionszugehörigkeit<br />
– immerhin 150 Jahre<br />
nach der Reformation – noch spielten,<br />
beschreibt Manfred Geier anhand des<br />
Schicksals <strong>von</strong> Moses Mendelssohn.<br />
Dieser Unternehmer und Philosoph, der<br />
in Berlin vom «sans papier» zum angesehenen<br />
Bürger aufstieg, musste sich,<br />
aufgefordert vom <strong>Zürcher</strong> Theologen<br />
Johann Caspar Lavater, öffentlich zu seinem<br />
Judentum bekennen, ohne freilich<br />
das Christentum angreifen zu dürfen.<br />
Lavaters Fehdehandschuh war nichts<br />
weniger als die Rückkehr hinter die <strong>von</strong><br />
John Locke postulierte Gewissensfreiheit<br />
in Glaubensangelegenheiten. Für<br />
diesen war zwar eine Moral ohne Gott<br />
nicht vorstellbar, wohl aber eine ohne<br />
kirchliche Unterweisung, womit er die<br />
Autorität der Institution Kirche untergrub.<br />
Dass die Gedankenfreiheit auch für<br />
Frauen galt, war beileibe keine Selbstverständlichkeit.<br />
So liessen die Enzyklopädisten<br />
keine Frauen als Autoren zu,<br />
und für Rousseau war, wie für Sophie in<br />
seinem Roman «Emile», jede Frau «dazu<br />
geschaffen, zu gefallen und sich zu unterwerfen».<br />
Geier illustriert diese ungleiche<br />
Aufklärung mit einem «Requiem<br />
auf eine mutige Frau», nämlich<br />
Olympe de Gouges, die 1793 in Paris<br />
guillotiniert wurde. Nur Kant hegte<br />
diesbezüglich keine Zweifel: Selbst<br />
wenn er die Frauen dem «schönen Ge-<br />
«Die Freiheit für das<br />
Volk»: Besucher<br />
vor dem bekannten<br />
Gemälde <strong>von</strong> Eugène<br />
Delacroix (1830) im<br />
Louvre in Paris.<br />
schlecht» zuordnete und die Männer<br />
dem «erhabenen»: Er ging <strong>von</strong> der<br />
Gleichberechtigung der Geschlechter<br />
aus. Den Schritt in die Mündigkeit sah er<br />
genauso für das «ganze schöne Geschlecht».<br />
Dem grossen Aufklärer Kant nähert<br />
sich Geier aus der Gegenwart, genauer,<br />
dem 11. September 2001 und der folgenden<br />
Auseinandersetzung, die sich um<br />
die Frage drehte, ob die europäische<br />
Aufklärung gescheitert sei. Jenseits des<br />
Atlantiks beschuldigte Robert Kagan die<br />
Europäer des falschen Glaubens an ein<br />
posthistorisches Paradies. Unter Bezugnahme<br />
auf Kants kurze Abhandlung<br />
«Vom ewigen Frieden» hielten Derrida,<br />
Habermas und Sloterdijk dagegen.<br />
Ralph Dahrendorf und Timothy Garton<br />
Ash versuchten zu vermitteln, indem sie<br />
Kant <strong>von</strong> Rousseau abgrenzten. Ein<br />
wahrer Philosophenstreit, der noch weitere<br />
Kreise zog – und mit dem Geier zuletzt<br />
illustriert, wie alltagsnah und notwendig<br />
Philosophie sein kann.<br />
Die Antwort auf die eingangs gestellten<br />
Fragen liefert das Buch explizit und<br />
implizit: Die historische Aufklärung war<br />
eine europäische; das Streben nach<br />
Mündigkeit aber ist universell und immerwährend.<br />
Gerade heute wieder erstreckt<br />
sich der Ruf der Aufklärung über<br />
den Globus. Und er verlangt, wie damals,<br />
Klarheit und vor allem Mut. ●<br />
Katja Gentinetta ist Lehrbeauftragte<br />
der Hochschule St. Gallen und<br />
Gesprächsleiterin «Sternstunde<br />
Philosophie» am Schweizer Fernsehen.<br />
BERTHOLD STEINHILBER / LAIF
Theater Die Programme des Cabaret Cornichon liefern einen Spiegel der gesellschaftlichen<br />
Verhältnisse in der Schweiz <strong>von</strong> 1934 bis 1951<br />
Das ätzende Gegengift<br />
Peter Michael Keller: Cabaret Cornichon.<br />
Geschichte einer nationalen Bühne.<br />
Chronos, Zürich 2011. 428 Seiten, Fr. 78.–.<br />
Von Urs Bitterli<br />
Am 1. Mai 1934 fand im Hotel Hirschen<br />
im <strong>Zürcher</strong> Niederdorf die erste Vorführung<br />
des Cabaret Cornichon statt. Im<br />
Vorjahr hatten der Schweizer Walter<br />
Lesch und der Deutsche Otto Weissert<br />
den Entschluss gefasst, ein Kabarett ins<br />
Leben zu rufen. Man fand, wie dies später<br />
das Ensemble-Mitglied Max Werner<br />
Lenz euphemistisch formulierte, das<br />
Leben in der Schweiz sei «einfach zu<br />
süss» und «eine kleine, ätzende Gegensäure»<br />
sei nötig, «um das glückvolle Dasein<br />
in der Schweiz» nicht in den Himmel<br />
wachsen zu lassen. Lesch übernahm<br />
die künstlerische und Weissert die administrative<br />
Leitung.<br />
Das Cabaret Cornichon arbeitete<br />
viele Jahre sehr erfolgreich; man ging<br />
auf Tournee, trat an der Weltausstellung<br />
in Paris und an der Landesaustellung auf<br />
und spielte in Truppenunterkünften.<br />
Manche der Autoren und Schauspieler<br />
des Cornichon waren zusätzlich bei<br />
Presse, Radio oder Film tätig. Ensemble-<br />
Mitglieder wie Elsie Attenhofer, Heinrich<br />
Gretler, Zarlie Carigiet und Emil<br />
Hegetschweiler wurden zu herausragenden<br />
Repräsentanten der Schweizer<br />
Theatergeschichte.<br />
Während siebzehn Jahren trat das<br />
Cornichon beinahe wöchentlich auf. Es<br />
verfolgte die politischen Entwicklungen<br />
im In- und Ausland, reagierte spontan<br />
auf Tagesereignisse und thematisierte<br />
die Ängste und Hoffnungen der Bevölkerung.<br />
In der Zeit des Kalten Krieges<br />
gelang es dem Cornichon nicht mehr,<br />
Bernd Brunner: Der Mond.<br />
Die Geschichte einer Faszination.<br />
Antje Kunstmann, München 2011.<br />
320 Seiten, Fr. 28.50.<br />
Von Thomas Köster<br />
Im späten 16. Jahrhundert formulierte<br />
der italienische Naturforscher und Dramatiker<br />
Giambattista della Porta den<br />
Gedanken vom Mond als Informations-<br />
Bildschirm. «Ein Parabolspiegel grosser<br />
Brennweite sollte Buchstaben auf die<br />
Oberfläche projizieren, die dann <strong>von</strong><br />
den Menschen auf der Erde zu lesen gewesen<br />
wären», beschreibt Bernd Brunner<br />
die Idee. Auch wenn aus dieser Vision<br />
bekanntlich nichts wurde, umreisst<br />
sie bildhaft das, was das Buch Brunners<br />
sich publikumswirksam zu positionieren.<br />
Eines der letzten erfolgreichen Programme<br />
ging 1947 über die Bühne und<br />
stand, aktuell genug, unter dem Motto<br />
«Zwüschet Whisky und Wodka». Vier<br />
Jahre danach war Schluss.<br />
Zur Geschichte des Cabaret Cornichon<br />
liegt seit kurzem eine sorgfältig<br />
erarbeitete, gut lesbare Dissertation vor.<br />
Der Verfasser, Peter Michael Keller, sah<br />
sich mit einer äusserst komplexen Quellenlage<br />
konfrontiert. Die Nummerntexte<br />
liegen in der Regel nicht gedruckt vor;<br />
die Tondokumente sind lückenhaft und<br />
Filmaufnahmen fehlen ganz. Keller<br />
musste in zahlreichen privaten Nachlässen<br />
und Archiven nach den Textgrund-<br />
«Zwüschet Whisky<br />
und Wodka» (1947):<br />
Programm des<br />
Cabaret Cornichon.<br />
liefert: Zeigt es doch eindringlich auf,<br />
wie stark die Menschheit ihre Wünsche,<br />
Sehnsüchte und Ängste seit jeher über<br />
die Kulturgrenzen hinweg auf die unwirtliche<br />
Kugel zu projizieren wusste.<br />
Überaus kenntnisreich und anschaulich<br />
erzählt Brunner <strong>von</strong> der Entstehung<br />
und physischen Beschaffenheit des<br />
Mondes, und <strong>von</strong> der Geschichte unserer<br />
Mondwahrnehmung. Dabei wird offenbar,<br />
wie sehr die Betrachtung des<br />
Erdtrabanten unsere Gedankenwelt beeinflusst<br />
hat – und wie stark sich die Bilder<br />
<strong>von</strong> ihm in Malerei, Dichtung, Religion,<br />
Philosophie, Trivial- und Hochkultur<br />
durch technische Innovationen wie<br />
das Fernrohr gewandelt haben – oder<br />
eben durch die Raumfahrt, die nicht nur<br />
erstmals die dunkle Seite des Mondes<br />
beleuchtete, sondern durch den Blick<br />
lagen der Nummern suchen, diese den<br />
einzelnen Programmen zuordnen und in<br />
eine plausible chronologische Ordnung<br />
bringen.<br />
In der kollektiven Erinnerung erscheint<br />
das Cabaret Cornichon als Inbegriff<br />
des intellektuellen Widerstandes<br />
gegen Nationalsozialismus und Faschismus.<br />
Mitglieder des Ensembles betonten<br />
diesen Aspekt in ihren Erinnerungen,<br />
und Historiker übernahmen diese<br />
Sicht, die zwar nicht falsch ist, der Themenvielfalt<br />
der Cornichon-Programme<br />
aber zu wenig Rechnung trägt. Es ist das<br />
grosse Verdienst <strong>von</strong> Kellers Darstellung,<br />
dass sie das Cornichon als Spiegel<br />
gesellschaftlicher Verhältnisse und als<br />
Ausdruck der mentalen Verfassung unseres<br />
Landes begreift. Die Geistige Landesverteidigung,<br />
zu der sich das Cornichon<br />
bekannte, war ja nicht nur, wie zuweilen<br />
in polemischer Verkürzung behauptet<br />
wird, eine Art Anti-Ideologie<br />
zum Nationalsozialismus. Das Cornichon<br />
verstand sich auch nicht als Propaganda-Instrument;<br />
aber es ermöglichte<br />
in schwieriger Zeit eine nationale<br />
Selbstdarstellung, in der Scherz, Satire,<br />
Ironie und tiefere Bedeutung sich nuancenreich<br />
verbanden. Der Verfasser führt<br />
zahlreiche Nummerntexte in vollem<br />
Wortlaut vor, kommentiert sie kenntnisreich<br />
und fügt vorzügliche Szenenfotos<br />
bei. Das Cornichon hat keinen Tucholsky<br />
oder Kästner hervorgebracht; aber<br />
manche Verse haben ihre Frische und<br />
ihren Biss nicht verloren.<br />
Kellers Buch darf als die abschliessende<br />
Darstellung zu diesem Thema bezeichnet<br />
werden; es stellt einen gewichtigen<br />
Beitrag zur Geistesgeschichte unseres<br />
Landes dar. ●<br />
Urs Bitterli ist emeritierter Professor für<br />
neuere Geschichte der Universität Zürich.<br />
Astronomie Der blaue Planet hat die Gedankenwelt der Erdbewohner schon immer beeinflusst<br />
Mensch und Mond<br />
WILLI EIDENBENZ / CABARET ARCHIV<br />
vom Mond auf die Erde auch unsere<br />
Vorstellung vom blauen Planeten prägte.<br />
Dass das Bild, das der Autor dabei<br />
präsentiert, bei der Fülle an historischem<br />
Material <strong>von</strong> eigenen Vorlieben<br />
geprägt ist, tut dem positiven Gesamteindruck<br />
dabei keinen Abbruch.<br />
«Ohne unseren Mond wäre die Erde<br />
ein völlig anderer Ort», schreibt Brunner<br />
gleich zu Beginn seines Buchs: Zu<br />
Ebbe und Flut leistet er ebenso seinen<br />
Beitrag wie zum Wechsel der Jahreszeiten<br />
oder zu einem moderaten Klima,<br />
ohne das das Leben in seiner jetzigen<br />
Form wohl gar nicht entstanden wäre.<br />
Wie lebendig und vielfältig der Mond<br />
nicht nur unser Leben, sondern auch<br />
unser Denken beeinflusst hat, wird man<br />
als Leser am Ende der Lektüre mit Sicherheit<br />
besser begreifen. ●<br />
29. Januar 2012 ❘ NZZ am Sonntag ❘ 19
Sachbuch<br />
Globalisierung Botschafter Johannes B. Kunz warnt vor Verlust der Souveränität<br />
Schweizer Uno-Diplomat rechnet mit<br />
internationaler Gemeinschaft ab<br />
Johannes B. Kunz: Der letzte Souverän<br />
und das Ende der Freiheit. Internationale<br />
Politik und bürgerliche Rechte.<br />
NZZ Libro, Zürich 2012. 400 Seiten,<br />
Fr. 58.–.<br />
Von Paul Widmer<br />
Johannes B. Kunz hat ein gescheites und<br />
mutiges Buch geschrieben. Gescheit,<br />
weil er mit einem beeindruckenden<br />
Wissen und viel Scharfsinn die These<br />
verteidigt, dass Souveränität die Freiheit<br />
und das Wohlbefinden eines Volkes<br />
auch im Zeitalter der Globalisierung erhöht.<br />
Derlei liegt zurzeit nicht im Mainstream.<br />
Vielmehr vernimmt man täglich,<br />
jeder Staat müsse Souveränität abgeben,<br />
um sich in einer globalisierten<br />
Welt richtig zu positionieren. Ob das<br />
auch stimmt, wird kaum hinterfragt.<br />
Kunz bürstet gegen den Strich. Es bereitet<br />
ihm offensichtlich Vergnügen, die<br />
landläufige Meinung in ihrer konventionellen<br />
Bequemlichkeit als falsch zu entlarven.<br />
Das gilt derzeit als politisch unkorrekt.<br />
Man will nicht wissen, wie die<br />
einzelnen Akteure der sogenannten internationalen<br />
Gemeinschaft oft zusammenspannen,<br />
um die Souveränität <strong>von</strong><br />
Staaten und die Freiheit der Bürger zu<br />
beschränken.<br />
Unter anderem zeigt er am Beispiel<br />
des, wie er es nennt, «humanitär-interventionistischen<br />
Komplexes», wie fragwürdig<br />
gerade auch humanitäre Interventionen,<br />
die in bester Absicht eingeleitet<br />
werden, enden können. Nicht selten<br />
erreichen sie das Gegenteil <strong>von</strong> dem,<br />
was sie bezwecken. Oft ist die Lage nach<br />
Amy Stewart: Gemeine Gewächse.<br />
Radierungen <strong>von</strong> Briony Morrow-<br />
Cribbs. Berliner Taschenbuch,<br />
Berlin 2011. 299 Seiten, Fr. 18.90.<br />
Von André Behr<br />
Ohne Chemie wären weder das Leben,<br />
noch die Materialen und technischen<br />
Geräte denkbar, die uns den Alltag erleichtern.<br />
Dennoch hat die Chemie<br />
einen schlechten Ruf, weil «chemisch»<br />
mit «künstlich» und oft auch «giftig»<br />
assoziiert wird. Dabei wird vergessen,<br />
dass die für den Menschen gefährlichsten<br />
Stoffe <strong>von</strong> der Natur synthetisiert<br />
werden. Zum Beispiel <strong>von</strong> Quallen, oder<br />
in stattlicher Anzahl auch <strong>von</strong> Pflanzen.<br />
Aus Krimis bestens bekannt ist etwa<br />
das Strychnin, das aus dem Samen des<br />
20 ❘ NZZ am Sonntag ❘ 29. Januar 2012<br />
Johannes B. Kunz<br />
setzt ein Fragezeichen<br />
hinter humanitäre<br />
Interventionen: Uno-<br />
Truppen in Abidjan,<br />
Januar 2011.<br />
zu den Brechnussgewächsen zählenden<br />
Strychninbaums stammt. Der in ganz<br />
Europa und den USA verbreitete Wasserschierling<br />
wiederum produziert in<br />
seinen lecker süsslich schmeckenden<br />
Wurzeln Cicutoxin, das bereits in geringen<br />
Mengen ein Kind töten kann. Selbst<br />
Gras ist nicht immer harmlos, wie Amy<br />
Stewart in ihrem Buch über «gemeine<br />
Gewächse» am Fall des japanischen<br />
Blutgrases zeigt, dessen Blätter gefährlich<br />
wie eine Säge sind und das leicht<br />
entflammbar ist, damit es sich durch Abbrennen<br />
der Konkurrenten einen Standortvorteil<br />
verschaffen kann.<br />
In über 60 Kapiteln, bebildert mit filigranen<br />
Radierungen, erzählt die in Kalifornien<br />
lebende Autorin Geschichten<br />
über Pflanzen, die morden, verstümmeln,<br />
berauschen oder uns anderweitig<br />
ärgern können. Dabei verwebt sie ge-<br />
einer Intervention desolater als vorher.<br />
Man denke an Somalia, Afghanistan<br />
oder den Irak.<br />
Der Autor sieht die Souveränität, wie<br />
sie sich seit dem Westfälischen Frieden<br />
(1648) durchgesetzt hat, <strong>von</strong> vielen Seiten<br />
her gefährdet: vom Uno-Sicherheitsrat,<br />
<strong>von</strong> einer extensiven Auslegung der<br />
Menschenrechte, <strong>von</strong> internationalen<br />
Organisationen, die ihre eigenen Interessen<br />
verfolgen, und natürlich auch <strong>von</strong><br />
einer EU, die ihre Kompetenzen ständig<br />
zu erweitern versucht und allmählich<br />
Formen eines mittelalterlichen Reiches<br />
annimmt. Diese Entwicklung wird kräftig<br />
<strong>von</strong> einer international gut vernetzten<br />
politischen Elite gefördert. Im Allgemeinen<br />
verneint Kunz die Existenzberechtigung<br />
<strong>von</strong> internationalen Institu-<br />
Botanik Pflanzen sind nicht immer harmlos. Sie können auch morden und verstümmeln<br />
Von Blumen, die töten<br />
SUNDAY ALAMBA / AP<br />
tionen nicht, aber er kritisiert deren<br />
Auswuchern. Damit sich die internationalen<br />
Organisationen wieder auf das<br />
Wesentliche beschränken, gibt es seiner<br />
Meinung nach nur einen Weg: ihnen die<br />
finanziellen Mittel kürzen.<br />
Kunz verfügt über ein stupendes Wissen.<br />
Das breitet er grosszügig aus. Es<br />
reicht <strong>von</strong> afrikanischen Stammesgesellschaften<br />
über die chinesische Kultur<br />
bis zu Machiavelli, <strong>von</strong> begriffsgeschichtlichen<br />
Erörterungen bis zu ethnografischen<br />
Exkursen. Die Vorteile des<br />
Buches sind freilich auch dessen Nachteile.<br />
Mit seinen Vergleichen will er<br />
hieb- und stichfest eine an sich schlichte<br />
These beweisen, nämlich dass ohne<br />
staatliche Souveränität nirgends auf der<br />
Welt Freiheit, Recht und Wohlstand auf<br />
die Dauer gedeihen können. Vielleicht<br />
hätte er seine These wirkungsvoller mit<br />
einem konzisen <strong>Essay</strong> <strong>von</strong> weniger als<br />
hundert Seiten verfochten.<br />
Dennoch: In einer Zeit, in der die Internationalisierung<br />
ständig als Wert an<br />
sich angepriesen wird, tut es gut, wenn<br />
jemand mit neuem Elan an den Sinn <strong>von</strong><br />
staatlicher Souveränität erinnert. Selbst<br />
wenn einige Gedankengänge des Autors<br />
diskussionswürdig sind wie etwa sein<br />
Begriff <strong>von</strong> Souveränität, den er mit legitimer<br />
Herrschaft gleichsetzt, ist es<br />
verdienstvoll, neue subkutane Machtstrukturen<br />
aufzuzeigen – dies umso<br />
mehr als das Buch <strong>von</strong> einem Schweizer<br />
Diplomaten stammt, also <strong>von</strong> jemandem,<br />
der sich selbst in den kritisierten<br />
Sphären bewegt. Kunz ist Berater bei<br />
der Uno-Mission in New York. ●<br />
Paul Widmer ist Autor <strong>von</strong> «Schweizer<br />
Aussenpolitik und Diplomatie» (2003).<br />
schickt botanisches Wissen mit Kulturgeschichte,<br />
Symptombeschreibungen<br />
oder Garten- und Verhaltenstipps.<br />
Auf der Reise quer durch alle Kontinente<br />
erfährt man so einiges über Pfeilgifte<br />
oder Drogen, aber auch über unschöne<br />
Eigenschaften schöner Topfpflanzen<br />
in der eigenen Stube. Haben<br />
Sie etwa gewusst, dass Giftzentralen in<br />
den USA 2006 über 1600 Anrufe wegen<br />
Philodendronvergiftungen entgegennehmen<br />
mussten? Oder der Oleander zu<br />
den Hundsgiftgewächsen gehört?<br />
Stewart, die auch Wanderausstellungen<br />
organisiert und viele Vorträge hält,<br />
kostet rund um die «gemeinen» Strategien<br />
<strong>von</strong> Pflanzen mögliche Horrorszenarien<br />
so genüsslich aus, dass nach<br />
der Lektüre kein empfindsamer Leser<br />
mehr unbedarft durch Wälder, Wiesen,<br />
Gärten oder Wohnungen streift. ●
Stalinismus Erst Jahrzehnte nach seinem Aufenthalt im Gulag hat DDR-Historiker Wolfgang Ruge<br />
seine Erinnerungen niedergeschrieben. Nun gibt sein Sohn die Memoiren neu heraus<br />
Ein deutscher Iwan Denissowitsch<br />
Wolfgang Ruge: Gelobtes Land. Meine<br />
Jahre in Stalins Sowjetunion. Rowohlt,<br />
Reinbek 2012. 489 Seiten, Fr. 35.50.<br />
Von Urs Rauber<br />
Letzten Herbst erhielt Eugen Ruge für<br />
seinen Roman «In Zeiten des abnehmenden<br />
Lichts» den Deutschen Buchpreis.<br />
Der 57-jährige Dokumentarfilmer<br />
und Drehbuchautor legte eine autobiografisch<br />
geprägte Familiensaga vor, die<br />
in der DDR, Mexiko und der Sowjetunion<br />
spielt. «Das Buch erzählt <strong>von</strong> der<br />
Utopie des Sozialismus, dem Preis, den<br />
sie dem Einzelnen abverlangt, und ihrem<br />
allmählichen Verlöschen», begründete<br />
die Jury ihren Entscheid.<br />
Den gleichen Satz könnte man den<br />
Memoiren <strong>von</strong> Ruges Vater, des späteren<br />
DDR-Historikers Wolfgang Ruge<br />
(1917–2006), voranstellen, die zwischen<br />
1984 und 1999 entstanden und 2003 in<br />
einer unzulänglichen Fassung (Ruge litt<br />
damals an beginnender Demenz) publiziert<br />
wurden. Sohn Eugen entschloss<br />
sich deshalb zu einer gründlichen Überarbeitung,<br />
die er mit seinem Nachwort<br />
versehen jetzt neu herausgibt. Wolfgang<br />
Ruge wurde <strong>von</strong> seinen Eltern kommunistisch<br />
erzogen, wanderte als 16-Jähriger<br />
mit seinem zwei Jahre älteren Bruder<br />
Walter im Sommer 1933 <strong>von</strong> Berlin<br />
nach Russland aus. Im «gelobten Land»,<br />
erhielt er eine Ausbildung als Zeichner,<br />
wurde freischaffender Kartograf an der<br />
Universität Moskau und erwarb die sowjetische<br />
Staatsbürgerschaft.<br />
Vom Paradies in den Gulag<br />
Mit Begeisterung stürzte sich der Jungkommunist<br />
in die Entdeckung der neuen<br />
Welt. Er verspürte «ein unbeschreibliches<br />
Gefühl – wie es ein religiöser<br />
Mensch beim Anblick der Jungfrau<br />
Maria empfinden mag». Walter Ruge<br />
zeichnet Personen und Milieu atmosphärisch<br />
dicht, teilweise fast poetisch.<br />
Lenins Witwe Nadeshda Krupskaja, die<br />
ihm eine Lehrstelle vermittelte, beschreibt<br />
er als «steinalte und unendlich<br />
müde» Frau, die einwandfrei Deutsch<br />
gesprochen habe. In Moskau begegnete<br />
Ruge der späteren DDR-Elite um Walter<br />
Ulbricht, Johannes R. Becher, Markus<br />
Wolf und anderen.<br />
Bald wich die Hoffnung jedoch der<br />
Ernüchterung und dem Erschrecken:<br />
über die Armut, das Elend, die allmächtige<br />
Partei und das Spitzelwesen. Ruge<br />
erlebte die Jahre des politischen Terrors<br />
ab 1936. Lähmendes Entsetzen packte<br />
ihn, als er zuhause auf die Geheimdienst-Agenten<br />
wartete, die Nacht für<br />
Nacht irgendwo Leute abholten. Nach<br />
dem deutschen Angriff auf die Sowjetunion<br />
1941 traf es auch ihn: Der «deutsche<br />
Spion» wurde in die kasachische<br />
Steppe nach Karaganda deportiert. Später<br />
landete er mit anderen deutschen<br />
Wolfgang Ruge (Mitte,<br />
Zweiter <strong>von</strong> rechts)<br />
verbrachte fast fünf<br />
Jahre im Gulag und<br />
zehn Jahre in der<br />
Verbannung im Ural<br />
(Foto Frühjahr 1951).<br />
«Arbeitsmobilisierten» in einem Lager<br />
bei Soswa im Nordural.<br />
Präzise und anschaulich zeichnet der<br />
deutsche Häftling den Alltag im Gulag,<br />
die Lagerhierarchie, die Brutalität des<br />
Wachpersonals, aber auch <strong>von</strong> kriminellen<br />
Elementen unter den Häftlingen. Besonders<br />
ausgeprägt empfand er den<br />
Hass der im gleichen Lager einsitzenden<br />
Kulaken (Mittel- und Grossbauern), die<br />
ihr Essen nicht mit den «Fritzen», den<br />
Deutschen, teilen wollten. Erfüllten die<br />
Gefangenen das Plansoll nicht, wurde<br />
ihnen die ohnehin kärgliche Brotration<br />
gekürzt. Nässe, Schnee und Kälte waren<br />
ständige Begleiter. Immer wieder starben<br />
Leute an Krankheit und Entkräftung,<br />
auch der Autor war mehr als einmal<br />
kurz vor dem Ende.<br />
Traumatische Erfahrung<br />
Im Lager arbeitete Ruge als Holzfäller,<br />
Bastschuhflechter und Gleisbauer; als es<br />
ihm besser ging, als Barackenwart, Sauna-Heizer,<br />
Pilzsucher und Zeichner.<br />
Nach Kriegsende im Januar 1946 wurde<br />
die Lagerhaft in Verbannung umgewandelt:<br />
auf dem Papier erhielten die Häftlinge<br />
alle Rechte zurück, durften aber<br />
den Ort nicht verlassen. Auf die 4½<br />
Jahre Gulag folgten über 10 Jahre Verbannung,<br />
bis Ruge 1956 nach Chruschtschows<br />
Geheimrede frei kam und mit<br />
seiner dritten russischen Frau in die<br />
DDR ausreisen konnte.<br />
Ruges umfangreicher Erlebnisbericht<br />
ist ein Zeugnis <strong>von</strong> ungewöhnlicher<br />
Qualität. Packend sind nicht nur die<br />
Schilderungen des Augenzeugen, der<br />
seine traumatischen Erfahrungen jahrzehntelang<br />
mit sich trug, bevor er sie<br />
mit einem verblüffenden Erinnerungsvermögen<br />
niederschrieb. Ruge porträtiert<br />
Dutzende <strong>von</strong> Mithäftlingen, auch<br />
Wärter und Vorgesetzte, die im umfangreichen<br />
Personenregister namentlich<br />
aufgeführt sind, und setzt ihnen so ein<br />
Denkmal. Er gibt seinen Gefühlen allerdings<br />
mehr Raum als seiner politischen<br />
Desillusionierung. Grossartig sind die<br />
Passagen, in denen aufkeimende Hoffnungen<br />
sichtbar werden. Als am 4. März<br />
1953 die Nachricht <strong>von</strong> Stalins Tod<br />
durchsickerte, riefen sich die Leute verschwörerisch<br />
«SSSR» zu. Was diesmal<br />
nicht die russische Abkürzung für<br />
Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken<br />
bedeutete, sondern: «Smert Stalina<br />
spasjot Rossiju» – Stalins Tod rettet<br />
Russland!<br />
Für Eugen Ruge ist es bis heute ein<br />
Rätsel, warum sein Vater die traumatischen<br />
Erfahrungen zu DDR-Zeiten nicht<br />
öffentlich machen wollte. Es brauchte<br />
offenbar den Mauerfall, damit der «verletzbare<br />
und verletzte Mensch» die vor<br />
den Angehörigen verheimlichten Aufzeichnungen<br />
1998 wieder hervor holte.<br />
Abgesehen vom literarischen Rang darf<br />
man Wolfgang Ruges Gulag-Report<br />
wohl mit Solschenizyns Roman «Ein<br />
Tag im Leben des Iwan Denissowitsch»<br />
(1962) und Schalamows «Erzählungen<br />
aus Kolyma» (1971) vergleichen. ●<br />
29. Januar 2012 ❘ NZZ am Sonntag ❘ 21
Sachbuch<br />
Nachkriegsgeschichte Ein Politiker und ein Kabarettist enthüllen unbekannte Fakten<br />
Wie der West-Ost-Dialog wirklich war<br />
Egon Bahr, Peter Ensikat: Gedächtnislücken.<br />
Zwei Deutsche erinnern sich.<br />
Aufbau, Berlin 2012. 204 Seiten, Fr. 24.50.<br />
Von Gerd Kolbe<br />
Es ist wie eine Modeerscheinung über<br />
die Verlagsbranche, Abteilung Sachbuch,<br />
gekommen und ökonomisch<br />
obendrein. Zwei setzen sich in ein Studio,<br />
plaudern über dies und das, und fertig<br />
ist das Buch. Doch Egon Bahr, der<br />
geistige Vater und Stratege der Ost- und<br />
Deutschland-Politik Willy Brandts, und<br />
der – um im Sprachgebrauch der Zeit zu<br />
bleiben, <strong>von</strong> der die Rede ist – Autor und<br />
Chef des Ostberliner Kabaretts «Die<br />
Distel», Peter Ensikat, machen die erwähnenswerte<br />
Ausnahme. Im Dialog<br />
lassen sie 50 Jahre Nachkriegspolitik<br />
Revue passieren. Es wird nie langweilig.<br />
Der Leser erfährt, wo Westdeutsche und<br />
Ostdeutsche einer Meinung sind oder<br />
auch nicht.<br />
Da ist zum Beispiel das bis auf den<br />
heutigen Tag umstrittene Kapitel der<br />
Aufarbeitung der Stasi-Akten, also der<br />
über Karrieren und Lebensläufe entscheidenden<br />
Dossiers des DDR-Geheimdienstes.<br />
Ensikat hält die Öffnung<br />
der Stasi-Akten im Grunde für richtig;<br />
schliesslich waren es die DDR-Bürger-<br />
Ian Kershaw: Das Ende. Kampf bis in den<br />
Untergang. NS-Deutschland 1944/45.<br />
DVA, München 2011. 702 Seiten,<br />
Fr. 40.90.<br />
Von Markus Schär<br />
Es war «ein Ende mit Schrecken, wie es<br />
die Geschichte noch nie gesehen hatte»,<br />
schreibt Ian Kershaw: «Das Ausmass, in<br />
dem sich Deutschland in den letzten<br />
Monaten des Dritten Reichs in ein riesiges<br />
Leichenhaus verwandelt hat, lässt<br />
sich kaum vorstellen.» Die Deutschen<br />
kämpften, bis sich Adolf Hitler am<br />
30. April 1945 erschoss. Sie folgten ihm<br />
scheinbar willig in den Untergang, wagten<br />
keinen Aufstand, quälten weiter<br />
Juden und Zwangsarbeiter und brachten<br />
um, wer an Kapitulation dachte. Warum?<br />
Ein wissenschaftliches Werk, das die<br />
Mentalitäten im letzten Kriegsjahr untersuche,<br />
sei ihm zu seiner Verwunderung<br />
nicht eingefallen, stellt Kershaw<br />
fest. Der emeritierte Professor der Universität<br />
Sheffield, der mit seinen gewichtigen<br />
Arbeiten zur Historiografie<br />
des NS-Staates (1985) und zu Hitler<br />
(1998/2000) zu den führenden Experten<br />
für das Dritte Reich zählt, verfasste deshalb<br />
selber «eine integrierte Geschichte<br />
einer Desintegration». Mit dem Zusam-<br />
22 ❘ NZZ am Sonntag ❘ 29. Januar 2012<br />
rechtler, welche die Einrichtung einer<br />
eigens dafür geschaffenen Behörde noch<br />
vor der Wiedervereinigung durchsetzten.<br />
Bahr, der Mann aus dem Westen,<br />
hält es ausnahmsweise mit Helmut Kohl.<br />
Hätte der Altkanzler gewusst, was mit<br />
den Akten geschieht, hätte er dazu geraten,<br />
alles zu verbrennen, zu vergraben<br />
und in den Keller zu stecken. Ensikat bezweifelt<br />
heute, dass die Aktenöffnung<br />
der Geschichtsaufarbeitung dient. Es<br />
geschehe dies doch nur «aus rein tagespolitischen<br />
Interessen». Bahr wird überdeutlich.<br />
Er nennt es eine Schweinerei,<br />
«wenn die Menschen aus dem Osten<br />
härter und unnachsichtiger behandelt<br />
werden als die Nazis».<br />
Das Buch gewährt dank Bahr bislang<br />
nur unzulänglich bekannte Einblicke in<br />
die Verhandlungen, die zur Entspannung<br />
zwischen Ost und West führten.<br />
Nie wäre das Berliner Vier-Mächte-Abkommen<br />
zustande gekommen, hätte es<br />
zwischen Bonn und Moskau nicht nach<br />
amerikanischem Muster einen «Back-<br />
Channel» gegeben. Der stellvertretende<br />
Chefredakteur der «Literaturnaja Gaseta»<br />
und ein KGB-General führten im<br />
Auftrag des damaligen Moskauer Parteichefs<br />
Juri Andropow Gespräche am offiziellen<br />
Apparat vorbei. Der damalige<br />
Sowjet-Botschafter in der DDR, Abrassimow,<br />
war ahnungslos. Franzosen und<br />
menfassen <strong>von</strong> zahllosen Detailstudien<br />
und dem Auswerten <strong>von</strong> Briefen, Tagebüchern<br />
und Spitzelberichten bis hin zu<br />
Abhörprotokollen <strong>von</strong> Wehrmachtsoffizieren<br />
in britischer Kriegsgefangenschaft<br />
wollte er die Fragen beantworten:<br />
Warum wurden Hitlers selbstzerstörerische<br />
Befehle immer noch befolgt? Welche<br />
Herrschaftsmechanismen befähigten<br />
ihn dazu, das Schicksal Deutschlands<br />
zu bestimmen, wenn es für jeden<br />
offenkundig war, dass der Krieg verloren<br />
war und das Land jetzt ganz und gar<br />
verwüstet wurde?<br />
Die Darstellung setzt am 20. Juli 1944<br />
ein, als die Verschwörer um Graf <strong>von</strong><br />
Stauffenberg mit ihrem Bombenanschlag<br />
auf Hitler scheiterten. Dass der<br />
Führer das Attentat schicksalhaft überlebte,<br />
stärkte seine Herrschaft wieder,<br />
führte zur Mobilisierung des leidenden<br />
Volkes und stachelte die Nazis zu verschärftem<br />
Terror an. «Wer mir <strong>von</strong> Frieden<br />
ohne Sieg spricht, verliert seinen<br />
Kopf», drohte Hitler. Danach fährt<br />
Kershaw getreu der Chronologie fort bis<br />
am 8. Mai 1945, als Grossadmiral Karl<br />
Dönitz, der vom Führer eingesetzte<br />
Nachfolger, die Kapitulation unterschrieb.<br />
Er erzählt <strong>von</strong> der Ardennenoffensive<br />
im Dezember 1944, die nochmals<br />
Hoffnung aufkeimen liess, vom<br />
Vorrücken der Roten Armee im Osten,<br />
Briten durften die Ergebnisse abnicken.<br />
Es verhandelten der Amerikaner Ken<br />
Rush, Bahr und der Russe Valentin Falin.<br />
Es war dies bei weitem nicht der einzige<br />
Fall, in dem nach aussen der Schein<br />
gewahrt wurde. Jedermann dachte, als<br />
John F. Kennedy 1963 nach Berlin kam<br />
und im Schöneberger Rathaus mit Adenauer<br />
und Brandt zusammentraf, jetzt<br />
werde Weltpolitik gemacht. Bahr erzählt,<br />
wie es wirklich war. Kennedy memorierte<br />
mit seinem Dolmetscher einen<br />
seiner berühmtesten Sätze, der da lautet:<br />
«Ich bin ein Berliner.» Adenauer las<br />
– wer hätte das gedacht – das SED-Zentralorgan<br />
«<strong>Neue</strong>s Deutschland».<br />
Auch sonst mangelt es nicht an Anekdotischem.<br />
Ensikat berichtet, wie die<br />
Zensur der Kabaretts in Berlin, Leipzig<br />
und Dresden funktionierte. Eine institutionelle<br />
Zensur gab es nicht. Wohl aber<br />
reichte der Einspruch eines hohen Funktionärs,<br />
um ein Programm abzusetzen.<br />
Und das Komischste war, dass die Kabaretts<br />
in der DDR vom Staat finanziert<br />
wurden. Auch nach Verboten wurden<br />
die Akteure – Ensikat nennt sie «Satirebeamte»<br />
– weiter bezahlt. Wie noch in<br />
jeder Diktatur ersetzten Witze das offene<br />
Wort. Zum Beispiel dieser: «Der Kapitalismus<br />
steht am Abgrund, der Sozialismus<br />
ist schon einen Schritt weiter.»<br />
Viel Spass bei der Lektüre. ●<br />
Zweiter Weltkrieg Warum die Deutschen auch nicht aufgaben, als die Niederlage sicher war<br />
Bis zum bitteren Ende<br />
<strong>von</strong> den Flüchtlingsströmen und den<br />
Todesmärschen der KZ-Häftlinge wie in<br />
einer konventionellen Geschichte des<br />
Dritten Reiches über Dutzende <strong>von</strong> Seiten<br />
hinweg – über viel zu viele Seiten.<br />
Dabei vergisst Kershaw sein Problem<br />
oder begnügt sich, wo er doch einmal<br />
auf seine Fragestellung zurückkommt,<br />
mit Relativierungen: «Allgemeine Aussagen<br />
über die Haltung <strong>von</strong> Soldaten zu<br />
treffen ist riskant.» Oder: «Derartige<br />
Mosaiksteine lassen sich nie zu einem<br />
vollständigen Bild zusammenfassen.»<br />
Die Fakten zu durchdringen und die Impressionen<br />
zu verdichten, also generelle<br />
Aussagen zu wagen, ist aber gerade die<br />
Aufgabe des problemorientiert arbeitenden<br />
Historikers.<br />
Eine Antwort gibt Kershaw erst im<br />
Schlusskapitel: Die «charismatische<br />
Herrschaft» <strong>von</strong> Hitler, der zuletzt in<br />
seinem Berliner Bunker hockte, führte<br />
für ihn dazu, dass die Wehrmacht bis zur<br />
Zerstörung des Dritten Reichs kämpfte<br />
und die Bevölkerung dem Führer in den<br />
Untergang folgte. Sein Buch beginnt<br />
Kershaw allerdings mit Jagdszenen aus<br />
dem bayerischen Ansbach, wo am<br />
18. April 1945 ein Student, der mit Flugblättern<br />
für die kampflose Übergabe des<br />
Barockstädtchens geworben hatte, am<br />
Strick endete. Ob der Terror der Nazis<br />
allein solche Gräuel erklärt? ●
Literatur Hans Jacob Christoffel <strong>von</strong> Grimmelshausen (um 1622 bis 1676), Autor des Schelmenromans<br />
«Simplicissimus», in einer neuen Biografie<br />
Angesichts der Kriegsgräuel<br />
flüchtete er sich ins Lachen<br />
Heiner Boehncke, Hans Sarkowicz:<br />
Grimmelshausen. Leben und Schreiben.<br />
Vom Musketier zum Weltautor.<br />
Eichborn, Frankfurt a. M. 2011.<br />
499 Seiten, Fr. 45.90.<br />
Von Manfred Koch<br />
1634, im siebzehnten Jahr des Dreissigjährigen<br />
Kriegs, wird die lutherische<br />
Reichsstadt Gelnhausen <strong>von</strong> kaiserlichen<br />
Truppen eingenommen und geplündert.<br />
Viele Einwohner fliehen in die<br />
nahegelegene protestantische Festung<br />
Hanau, unter ihnen auch ein Junge <strong>von</strong><br />
zwölf, dreizehn Jahren: Hans Jacob<br />
Chris toffel <strong>von</strong> Grimmelshausen,<br />
Sprössling einer Bäcker- und Schankwirtfamilie,<br />
der nach dem frühen Tod<br />
seines Vaters im Haus der Grosseltern<br />
aufgewachsen war.<br />
«Wollustbarliches» Weltbuch<br />
Mit der Verwüstung Gelnhausens ist<br />
seine kurze Schulzeit beendet, <strong>von</strong> nun<br />
an geht es für ihn nur noch um das Überleben<br />
im Krieg. Hans Jacob wird 1635<br />
<strong>von</strong> kroatischen Soldaten aus Hanau<br />
verschleppt, dann wieder <strong>von</strong> hessischen<br />
Truppen gefangengenommen.<br />
Nach mehrmaligem Seitenwechsel landet<br />
er schliesslich in kaiserlich-katholischen<br />
Diensten, wo er es vom einfachen<br />
Musketier zum Regimentsschreiber<br />
bringt. 1649, ein Jahr nach Kriegsende,<br />
heiratet er und verdient fortan den bescheidenen<br />
Lebensunterhalt für seine<br />
vielköpfige Familie als Verwalter adliger<br />
Güter und Gastwirt. Zuletzt ist er<br />
«Schultheiss» im badischen Renchen,<br />
wo er erneut in Kriegswirren (ausgelöst<br />
durch die Feldzüge Ludwigs XIV.) gerät<br />
und 1676 stirbt.<br />
Dieser Mann, der fast die Hälfte seines<br />
Lebens an einen entsetzlichen Krieg<br />
verlor, nie eine akademische Ausbildung<br />
erhielt und später im Berufsalltag zeitraubende<br />
administrative Arbeit zu leisten<br />
hatte, war gleichwohl ein ungemein<br />
produktiver Schriftsteller. Grimmelshausen<br />
ist unbestritten der bedeutendste<br />
Prosa-Autor der deutschen Barockliteratur,<br />
Schöpfer des einzigen Romans<br />
aus dieser Zeit, der auch heute noch unmittelbar<br />
packen, begeistern, ja, in einen<br />
Leserausch versetzen kann: «Der Abenteuerliche<br />
Simplicissimus Teutsch» <strong>von</strong><br />
1668 (datiert auf 1669).<br />
Es handelt sich – barock gesprochen<br />
– um eine «historia voller safft» über<br />
das Leben eines gewissen Melchior<br />
Sternfels <strong>von</strong> Fuchshaim, der in Ich-<br />
Form <strong>von</strong> seinen Widerfahrnissen in<br />
Zeiten der Kriegspest erzählt. Ein derb<br />
lustiges, immer wieder auch erschre-<br />
ckendes Panorama <strong>von</strong> Schlachten,<br />
Schlägereien, Sauf- und Fressgelagen,<br />
abgefeimten Betrügereien, Liebeshändeln<br />
und – Momenten religiöser Besinnung.<br />
Kurz: ein «wollustbarliches» satirisches<br />
Weltbuch.<br />
Wie Grimmelshausens umfangreiches<br />
Gesamtwerk zustande kam, ist ein<br />
Rätsel. Auch seine jüngsten Biografen<br />
verneigen sich am Ende «staunend» vor<br />
einem Mann, der, «was ihm an Zeit,<br />
Ruhe, vielleicht auch Arbeitsraum fehlte,<br />
durch ein Übermass an Gaben, Eigenschaften<br />
und Fertigkeiten wettgemacht<br />
haben muss». Geschrieben haben kann<br />
er nur in Kriegs- bzw. Arbeitspausen,<br />
vornehmlich nachts. Sein Held Simplicius<br />
zieht sich im letzten Buch des Romans<br />
in eine stockfinstere Höhle zurück.<br />
Er erhellt sie mit Hilfe <strong>von</strong><br />
«schwarzen Käfern», die wunderbarer-<br />
Saftige Geschichte:<br />
Titelblatt zu «Der<br />
Abenteuerliche<br />
Simplicissimus<br />
Teutsch», Kupferstich<br />
<strong>von</strong> 1669.<br />
ALMIDI<br />
weise einen Lichtstrahl versenden –<br />
vielleicht ein Reflex auf die Beleuchtungskunst<br />
des Nachtpoeten.<br />
Eine Grimmelshausen-Biografie zu<br />
verfassen, ist ein tapferes Unternehmen.<br />
Zum einen gibt es für seine Jugend- und<br />
frühen Mannesjahre keine erhaltenen<br />
Dokumente. Auch die kargen Angaben<br />
zur Gelnhausener Kindheit und seinen<br />
Schicksalen im Krieg sind deshalb<br />
durchgängig mit einem «vermutlich»<br />
oder bestenfalls «höchstwahrscheinlich»<br />
zu versehen. Zum andern hat<br />
Grimmelshausen, als er mit über 40 Jahren<br />
endlich zu publizieren begann, seine<br />
Autorschaft systematisch versteckt. Er<br />
war ein Liebhaber des Anagramms, ein<br />
leidenschaftlicher Buchstabenverdreher,<br />
und so erwuchsen aus seinem Eigennamen<br />
all die «Samuel Greifnson<br />
<strong>von</strong> Hirschfeld», «German Schleifheim<br />
<strong>von</strong> Sulsfort», «Simon Leugfried <strong>von</strong><br />
Hartenfels» usw., die als Verfasser seiner<br />
Bücher firmierten. Am Ende wusste<br />
niemand, wer eigentlich für den überaus<br />
erfolgreichen «Simplicissimus» verantwortlich<br />
war; erst 1834 wurde Grimmelshausen<br />
<strong>von</strong> den Pionieren der Germanistik<br />
als Autor identifiziert. Am<br />
Literaturbetrieb des Barockzeitalters<br />
nahm der Aussenseiter nicht teil, deshalb<br />
fehlen auch aus diesem Bereich Dokumente,<br />
die Aufschluss über seine Person<br />
geben könnten.<br />
Fiktive Autobiografie<br />
Was bleibt den Biografen also anderes<br />
übrig, als sich an die Lebensgeschichte<br />
des Romanhelden zu halten, in die gewiss<br />
Erfahrungen seines Autors eingegangen<br />
sind? Aber «Simplicius Simplicissimus»<br />
ist eben eine höchst fiktive<br />
Autobiografie: ein Schelmenroman, der<br />
– durchaus in christlicher Absicht – die<br />
Verderbtheit der Welt anprangert, zur<br />
Freude des Lesers aber die Laster und<br />
Torheiten der sündigen Menschen so<br />
opulent beschreibt und satirisch übertreibt,<br />
dass man ständig laut auflachen<br />
möchte.<br />
Souverän meistern Boehncke und<br />
Sarkowicz die Gratwanderung, aus diesem<br />
Feuerwerk an Witz und Fabulierlust<br />
die wenigen verlässlichen Daten herauszufiltern,<br />
die – im Verbund mit akribisch<br />
recherchiertem Archivmaterial zur Geschichte<br />
seiner Familie und seiner Wirkungsstätten<br />
– immerhin die Umrisse<br />
eines biografischen Porträts ermöglichen.<br />
Vor allem aber machen sie verständlich,<br />
woher das komische Genie<br />
dieses Autors rührt. Seine Romane<br />
waren das «epische Rettungswerk»<br />
eines Kriegstraumatisierten, der sich<br />
angesichts der Gräuel seiner Zeit ins<br />
entlarvende Lachen flüchtete. ●<br />
29. Januar 2012 ❘ NZZ am Sonntag ❘ 23
Sachbuch<br />
Menschenhandel Ausbeutung und Knechtschaft begleiten die Kulturgeschichte seit jeher. Dass sie<br />
auch rund um den Indischen Ozean im grossen Stil stattfanden, belegt eine neue Studie<br />
Besiegt, versklavt, verkauft<br />
Michael Mann: Sahibs, Sklaven und<br />
Soldaten. Geschichte des<br />
Menschenhandels rund um den<br />
Indischen Ozean. Zabern, Darmstadt<br />
2012. 254 Seiten, Fr. 40.90.<br />
Von Geneviève Lüscher<br />
Das erste Bild, das beim Wort «Sklaverei»<br />
vor dem inneren Auge auftaucht,<br />
sind die im Schweisse ihres Angesichts<br />
schuftenden Schwarzen in den Zuckerrohr-<br />
oder Baumwollplantagen, angetrieben<br />
<strong>von</strong> peitschenschwingenden<br />
Weissen auf dem hohem Ross. Dieses<br />
Bild ziehe eine ganze Reihe <strong>von</strong> Klischees<br />
nach sich, so der Indologe Michael<br />
Mann <strong>von</strong> der Humboldt-Universität<br />
in Berlin, beispielsweise das der<br />
Rechtlosigkeit. Aber «zu keiner Zeit und<br />
an keinem Ort der Welt waren Sklaven<br />
ausschliesslich rechtlose Subjekte»,<br />
schreibt der Fachmann, ohne die Grausamkeit<br />
des Phänomens in Abrede zu<br />
stellen. Sklaverei gibt es in zahllosen<br />
Formen, und bis anhin existiere keine<br />
befriedigende Definition dieser seit<br />
Jahrtausenden – und bis heute – gesellschaftlich<br />
akzeptierten Erscheinung.<br />
Michael Mann selber definiert in seinem<br />
Buch «Sahibs, Sklaven und Soldaten»<br />
als Sklaven einen Menschen, der in<br />
das persönliche Eigentum eines anderen<br />
Menschen übergegangen ist, jederzeit<br />
veräussert werden kann und zur Arbeit<br />
gezwungen ist. Konzeptionell basiere<br />
die Institution Sklaverei «auf dem Ersatz<br />
für einen nicht erlittenen Tod»,<br />
meist im Kriegsfall. Das habe nichts mit<br />
Gnade oder Nächstenliebe zu tun, sondern<br />
diente einzig zur Rekrutierung <strong>von</strong><br />
Arbeitskräften.<br />
In einer kurzen Einleitung schreibt<br />
Mann über Entstehung und Ausbreitung<br />
der Sklaverei, die schon in Mesopotamien<br />
im 2. Jahrtausend vor Christus das<br />
Los der meisten Kriegsgefangenen war.<br />
Sklaverei war auch unter den Juden des<br />
Alten Testaments üblich, und ohne<br />
Heerscharen <strong>von</strong> Sklaven wären Griechen<br />
und Römer nicht in der Lage gewesen<br />
zu erreichen, was sie erreicht haben.<br />
Während aber der Sklavenanteil in der<br />
Antike «nur» 20 Prozent betrug – die<br />
«kritische Masse» um in den Augen des<br />
Autors als Sklavengesellschaft bezeichnet<br />
zu werden –, erreichte er in den Südstaaten<br />
der USA bis 70 Prozent der Gesamtbevölkerung!<br />
In den folgenden Kapiteln wird klar,<br />
dass auch in Südasien solche Sklavengesellschaften<br />
normal waren. Gemäss neueren<br />
Forschungen versorgte das sub-<br />
saharische Afrika nicht nur die Gebiete<br />
rund um das Mittelmeer, die Karibik,<br />
Nordafrika und die beiden Amerikas mit<br />
Menschenmaterial, sondern eben auch<br />
die Anrainerstaaten rund um den Indischen<br />
Ozean. Bereits vorhandene Strukturen<br />
der Sklaverei und des Sklavenhandels<br />
sind laut Mann durch die europäische<br />
Kolonialherrschaft seit dem 16.<br />
24 ❘ NZZ am Sonntag ❘ 29. Januar 2012<br />
Jahrhundert aggressiv ausgeweitet und<br />
in das transatlantische Handelssystem<br />
eingebunden worden – eine frühe Form<br />
der globalen Vernetzung. Die Abschaffung<br />
des Menschenhandels 1807 und der<br />
Sklaverei 1834 im Britischen Imperium<br />
hatte einen massiven Aufschwung beider<br />
Phänomene in den anderen Kolonialgebieten<br />
zur Folge, besonders in<br />
Mosambik, Madagaskar und Sansibar. In<br />
Ostafrika und auf der arabischen Halbinsel<br />
dauerte der Sklavenhandel an, zum<br />
Teil sogar mit britischer Unterstützung.<br />
Aufschlussreich sind die Ausführungen<br />
zur Forschungssituation. Sklaverei<br />
und Sklavenhandel sind ausgesprochen<br />
junge Untersuchungsfelder. Umfassende<br />
Gesamtdarstellungen zur Situation<br />
an der afrikanischen Ostküste und in<br />
den arabischen Ländern erschienen erst<br />
in den 1970er Jahren. Weil die britische<br />
Geschichtsschreibung die Sklaverei<br />
rund um den Indischen Ozean als etwas<br />
ganz Anderes betrachtete als diejenige<br />
in Amerika, die entsprechende Bezeichnung<br />
tunlichst vermied und so die Sklaverei<br />
in den Kolonialgebieten überhaupt<br />
in Abrede stellte, fehlten grundlegende<br />
wissenschaftliche Aufarbeitungen bis in<br />
die 80er Jahre. Eine erste monografische<br />
Studie erschien gar erst 1999.<br />
Neuste Forschungen zeigen, dass<br />
Sklaverei und Sklavenhandel keine lokalen<br />
oder regionalen Phänomene waren,<br />
die getrennt <strong>von</strong>einander existierten,<br />
sondern als weltweiter «dynamischer<br />
Bestandteil eines sich (...) in globalen<br />
Bezügen vernetzenden und zunehmend<br />
kapitalistisch ausgerichteten Wirtschaftssystems»<br />
zu betrachten sind. ●<br />
Pressefotografie Als die Welt noch schwarzweiss war<br />
Eine Spur <strong>von</strong> Elvis in der Haartolle, gewagte Jackets<br />
und ein mürrisch-scheuer Blick auf die maskierte<br />
Schöne. Auf dem Maskenball im «Kreuz» in<br />
Schüpfheim ist 1977 die Welt noch in guter Ordnung.<br />
Emanuel Ammons Fotoband «70er» bringt eine Zeit<br />
zurück, als Fotos schwarzweiss waren und Röcke<br />
kurz, als man noch ohne Helm aufs Töffli sass und die<br />
Kinderwagen aussahen wie auf der Bühne bei Emil.<br />
Auch der junge Emil selbst fehlt nicht in dieser<br />
Rückschau des Luzerner Fotografen, ebenso wenig<br />
wie der alte Hans Erni, die 13-jährige Anne Sophie<br />
Mutter oder Guru Maharishi, mit Rolls Royce in<br />
Weggis. Von 1975 an arbeitete Ammon als Pressefotograf<br />
für das «Luzerner Tagblatt», was ihn nicht<br />
nur an die Musikfestspiele und in den Zirkus, sondern<br />
auch zu Schwingfesten, Verkehrsunfällen und<br />
Bränden führte. Verdienstvoll erklärt der Fotograf in<br />
eigenen Bildlegenden, wer da auftrat beim<br />
Punkkonzert in Adligenswil, und wie es kam, dass er<br />
die Rockband Krokus mitten auf der Bühne zwischen<br />
den Musikern stehend ablichten konnte.<br />
Kathrin Meier-Rust<br />
Emanuel Ammon: 70er. Pressefotografie. Aura<br />
Fotobuchverlag, Luzern 2011. 256 Seiten, Fr. 86.–.
Konsum Die Schweiz der 50er Jahre – eine Epoche voller Widersprüche<br />
Kühlschrank und Kalter Krieg<br />
Thomas Buomberger, Peter Pfrunder<br />
(Hrsg.): Schöner leben, mehr haben. Die<br />
50er Jahre in der Schweiz im Geiste des<br />
Konsums. Limmat, Zürich 2012.<br />
267 Seiten, Fr. 54.-.<br />
Von Martin Walder<br />
Sie haben keinen guten Ruf: «die langen<br />
Fünfziger», die «falschen Fufziger», die<br />
«bleierne Zeit». Erstickend seien sie<br />
gewesen in ihrer Kultur der Verbote und<br />
des Mittelmasses, bieder im Brötchenduft<br />
der Bäckerei Zürrer, restaurativ,<br />
konformitätssüchtig; erst «68» brachte<br />
die Erlösung eines breiten politischen,<br />
sozialen und mentalen Aufbruchs.<br />
Wer gleich nach dem Zweiten Weltkrieg<br />
geboren ist, kann das <strong>von</strong> heutiger<br />
Warte aus so sehen und liegt nicht gar<br />
daneben. Interessant nur, dass die eigenen<br />
Erinnerungen an damals dem Befund<br />
teilweise widersprechen und ihn<br />
immer wieder lebhaft unterspülen.<br />
Kribbelnde Ängste<br />
War da nicht auch ein unbesorgt ansteckendes<br />
Gefühl des Aufbruchs, ein<br />
geschenktes Versprechen <strong>von</strong> Zukunft,<br />
eine naiv blühende technische Fortschrittsgläubigkeit,<br />
dass alles machbar<br />
und erreichbar sein würde? Ihr gegenüber<br />
existierte zwar die Angst im Kalten<br />
Krieg vor der totalen atomaren Vernichtung,<br />
sie wurde <strong>von</strong> uns Jugendlichen<br />
aber eher kribbelnd-abstrakt und später<br />
dann (mit Weizsäcker & Co.) auch moralisch<br />
herausfordernd erlebt. Kurz gesagt:<br />
In den Fünfzigern schien die Welt<br />
für einen Heranwachsenden noch eroberbar.<br />
Wie wenig ein pauschales «Fifties-<br />
Bashing» taugt und gerechtfertigt ist,<br />
zeigt anschaulich dieser Bild- und Textband<br />
zu jener Zeit, die sich im Übrigen<br />
nicht strikte ins Korsett einer geraden<br />
Dekade zwängen lässt. Die Fünfziger<br />
fingen bald nach dem Krieg an und<br />
reichten bis in die Hälfte der 60er Jahre<br />
hinein – in der Schweiz vielleicht mit<br />
dem Kulminationspunkt der «Expo 64»<br />
in Lausanne, die nach vorne schaute und<br />
gleichzeitig im Armee-Pavillon die alte<br />
Schweiz nochmals wehrhaft einigelte.<br />
Frauen ohne Stimmrecht<br />
In neun lesenswerten <strong>Essay</strong>s fächert der<br />
Band ein Panorama jener Jahre auf: Eine<br />
glänzende kulturgeschichtliche Analyse<br />
des Phänomens Kühlschrank respektive<br />
moderner Häuslichkeit <strong>von</strong> Beatrice<br />
Schumacher fehlt darin so wenig wie<br />
jene des damals überbordenden Mythos<br />
Auto und des Strassenbaus durch Thomas<br />
Buomberger. Die eklatanten Widersprüche<br />
zwischen weiblichen und<br />
männlichen Rollenbildern und Rollen-<br />
Realität (Stimmrecht!) werden <strong>von</strong> Elisabeth<br />
Joris blossgelegt, die erwachende<br />
Macht der Unterhaltungsindustrie zwischen<br />
Patriotismus und Weltläufigkeit<br />
<strong>von</strong> Edzard Schade und Samuel Mu-<br />
menthaler geschildert, der Einbruch des<br />
«Fremden» aus dem südlichen Nachbarland<br />
<strong>von</strong> Gianni D’Amato untersucht.<br />
Bereits Georg Kohlers Einleitungs-<br />
<strong>Essay</strong> macht unter dem Titel «Konsumglück,<br />
Kalter Krieg und Zweite Moderne»<br />
jenes Phänomen namhaft, <strong>von</strong> dem<br />
die Epoche, wie sich in den Beiträgen<br />
stets <strong>von</strong> neuem zeigt, politisch, kommerziell<br />
und kulturell durchsetzt war:<br />
der Kalte Krieg mit seinem auch das<br />
Selbstverständnis der neutralen Schweiz<br />
stabilisierenden Antikommunismus.<br />
Dieser nahm die Idee der Geistigen Landesverteidigung<br />
der Nazizeit ins erste<br />
Nachkriegsjahrzehnt in Variation herüber.<br />
Der Antikommunismus «als Klammer,<br />
welche die Schweiz zusammenhielt:<br />
Er war Ideologie und Methode»,<br />
Die Werbung in<br />
den 1950er Jahren<br />
pries das Glück des<br />
Besitzes <strong>von</strong> neuen<br />
elektrischen Geräten.<br />
schreibt Benedikt Loderer in seinem<br />
Beitrag zum «Armeereformhaus»<br />
Schweiz und erinnert an die Frage <strong>von</strong><br />
Frischs Stiller: «Was ist, wenn ihnen die<br />
Russen erspart bleiben, ihr eigenes<br />
Ziel?» Ja, was war das eigene Ziel?<br />
Im Befund des «Fortbestands tradierter<br />
Ordnung unter neuen Vorzeichen»<br />
(Beatrice Schumacher) wird einiges <strong>von</strong><br />
der Widersprüchlichkeit der Fünfziger<br />
fassbar. Nicht zuletzt spiegelt sich in<br />
dem schön gemachten Buch die bei aller<br />
Kontinuität «unterschwellige Dynamik»<br />
der Schweizer Fotografie damals auch<br />
im reichen Bildteil, den Peter Pfrunder,<br />
Direktor der Fotostiftung Schweiz, zusammengestellt<br />
hat. Da sind die Fünfziger<br />
gleich wieder zum Riechen und zum<br />
Schmecken nahe. ●<br />
29. Januar 2012 ❘ NZZ am Sonntag ❘ 25
Sachbuch<br />
Umweltschutz Zwei Experten diskutieren über die Zukunft<br />
Nicht weniger als die Energiewende<br />
Klaus Töpfer, Ranga Yogeshwar: Unsere<br />
Zukunft. Ein Gespräch über die Welt<br />
nach Fukushima. C. H. Beck, München<br />
2011. 234 Seiten, Fr. 28.50.<br />
Von Patrick Imhasly<br />
Als es vor bald einem Jahr im Atomkraftwerk<br />
Fukushima Daiichi zur nuklearen<br />
Katastrophe kam, wurde die japanische<br />
Gesellschaft in ihrem grenzenlosen<br />
Vertrauen in die Technik erschüttert.<br />
Energiepolitische Konsequenzen aus<br />
diesem Unglück zogen dann aber nicht<br />
etwa die Japaner, sondern die Deutschen<br />
und die Schweizer. Deutschland und die<br />
Schweiz beschlossen, definitiv aus der<br />
Kernenergie auszusteigen und stattdessen<br />
vermehrt auf alternative Energiequellen<br />
wie Sonne oder Wind zu setzen.<br />
Das tönt gut, doch wie müssen die<br />
Menschen ihr alltägliches Verhalten ändern,<br />
um die Energiewende möglich zu<br />
machen? Und wie wird die Welt nach<br />
26 ❘ NZZ am Sonntag ❘ 29. Januar 2012<br />
Fukushima aussehen? In einem Interviewbuch<br />
diskutieren Klaus Töpfer und<br />
Ranga Yogeshwar über Fragen, die viele<br />
<strong>von</strong> uns beschäftigen. Der CDU-Politiker<br />
Klaus Töpfer hat langjährige Erfahrung<br />
in Umwelt- und Energiethemen:<br />
als Minister für Umwelt, Naturschutz<br />
und Reaktorsicherheit unter Helmut<br />
Kohl, später als Exekutivdirektor des<br />
Umweltprogramms der Vereinten Natio<br />
nen und schliesslich als Co-Vorsitzender<br />
der deutschen Ethikkommission<br />
für eine sichere Energieversorgung, die<br />
Angela Merkel nach Fukushima einsetzte.<br />
Der indischstämmige Ranga Yogeshwar<br />
seinerseits war als Nuklearphysiker<br />
tätig, bevor er Wissenschaftsjournalist<br />
wurde und sich einen Namen als Entwickler<br />
und Moderator diverser Formate<br />
im deutschen Fernsehen machte.<br />
Bescheidenere Autos fahren, seltener<br />
fliegen, den persönlichen Energieverbrauch<br />
reduzieren, Solaranlagen auf<br />
dem Hausdach und weg vom grenzenlosen<br />
Konsum: Das sind nur ein paar der<br />
Rezepte, welche die Autoren für eine<br />
neue Gesellschaft propagieren. Denn<br />
diese muss den Strom kompensieren,<br />
der durch den Ausfall der Kernenergie<br />
wegfällt. Ob das klappen kann? «Ich bin<br />
da keineswegs resignativ», sagt Töpfer,<br />
es sei «eine grossartige Chance, die<br />
Energiewende erfolgreich umzusetzen.»<br />
«Wir müssen die Dinge grundsätzlicher<br />
angehen», erklärt demgegenüber Yogeshwar:<br />
«Mit etwas Glück werden wir<br />
in dreissig, vierzig Jahren zur Neujahrzeit<br />
keine Reden mehr hören, in denen<br />
Vokabeln wie ‹Wachstum› vorkommen.<br />
Vielmehr wird es in ihnen um Glück,<br />
Wahlmöglichkeiten, kulturelle Vielfalt<br />
und Freiheit gehen.»<br />
Was Töpfer und Yogeshwar uns erzählen,<br />
ist alles richtig, sympathisch und<br />
muss vielleicht so sein. Schade nur,<br />
klopfen sich die beiden allzu oft gegenseitig<br />
auf die Schultern. Dabei hätten sie<br />
besser kontrovers erörtert, warum die<br />
Energiewende eben doch nicht so einfach<br />
zu schaffen sein wird. ●<br />
Das amerikanische Buch Richard Holbrooke, Gestalter der US-Aussenpolitik<br />
Selten war Trauerarbeit für eine breitere<br />
Öffentlichkeit so fruchtbar wie der<br />
Sammelband The Quiet American.<br />
Richard Holbrooke in the World (Public<br />
Affairs, 383 Seiten), der die Karriere<br />
dieses bedeutenden Diplomaten mit<br />
Beiträgen <strong>von</strong> Weggefährten und anhand<br />
eigener Texte darstellt. Das Buch<br />
macht nicht nur die Verdienste<br />
Holbrookes lebendig, sondern illustriert<br />
auch die Grenzen und Möglichkeiten<br />
der amerikanische Aussenpolitik<br />
seit dem Beginn des Vietnam-Krieges<br />
unter John F. Kennedy. Der Demokrat<br />
Holbrooke war an deren Gestaltung<br />
direkt beteiligt, wenn seine Partei das<br />
Weisse Haus kontrollierte. Republikanische<br />
Regierungen hat er als scharfsinniger<br />
Publizist begleitet, während<br />
er als Banker unter anderem bei der<br />
Credit Suisse tätig war.<br />
Wie die Herausgeber Derek Chollet und<br />
Samantha Power in ihrem Vorwort erklären,<br />
entstand die Idee zu «The Quiet<br />
American» in den Wochen nach<br />
Holbrookes Tod am 13. Dezember 2010.<br />
Zwei Tage zuvor hatte er Hillary Clinton<br />
im US-Aussenministerium über<br />
seine Arbeit als Sonderbeauftragter für<br />
Afghanistan und Pakistan berichtet.<br />
Der 69-Jährige erlitt dabei einen massiven<br />
Herzinfarkt, dem er schliesslich erlegen<br />
ist. Vor seinem Krankenzimmer<br />
und auf der Beisetzung trösteten<br />
Holbrookes Freunde und Kollegen einander<br />
mit Erinnerungen, die nach einem<br />
dauerhaften Gefäss riefen, so die<br />
Herausgeber. Laut Power zählten sie<br />
und Chollet zu den vielen Talenten, die<br />
in Holbrooke einen liebevollen, aber<br />
kritischen Mentor fanden. Power lernte<br />
den Diplomaten als junge Journalistin<br />
Richard Holbrooke<br />
spricht mit einem<br />
Flüchtling im<br />
pakistanischen Lager<br />
<strong>von</strong> Chota Lahore.<br />
Autorin Samantha<br />
Power (unten).<br />
während der Balkankriege kennen. Sie<br />
ist nun zur Menschenrechtsbeauftragten<br />
<strong>von</strong> Barack Obama aufgestiegen.<br />
Chollet war Holbrookes Assistent während<br />
dessen Zeit als UN-Botschafter der<br />
USA Ende der 1990er Jahre.<br />
Trotz der persönlichen Nähe der Autoren<br />
zu ihm bleibt «The Quiet American»<br />
dem Charakter Holbrookes<br />
verpflichtet, der sich durch seinen Ehrgeiz<br />
und seine unverblümte Art in Washington<br />
auch Feinde geschaffen hat.<br />
Wie der ehemalige Staatssekretär<br />
Strobe Talbott schreibt, blieb Holbrooke<br />
deshalb der heiss ersehnte Aufstieg zum<br />
Aussenminister versagt. Auch die Autoren<br />
nehmen kein Blatt vor den Mund<br />
und schildern Holbrookes Eigensinn in<br />
anschaulichen Anekdoten. Dafür mag<br />
das Zitat <strong>von</strong> Henry Kissinger genügen,<br />
der diese vitale Persönlichkeit so beschrieben<br />
hat: «Wenn Richard dich um<br />
MOHAMMAD SAJJAD / AP<br />
etwas bittet, ist es am besten, Ja zu sagen.<br />
Denn sonst wird der Weg <strong>von</strong> einem<br />
Nein zum Ja höchst peinsam.<br />
Absagen akzeptiert er nicht.»<br />
Philosophisch stand Holbrooke dem<br />
Aussenminister republikanischer Präsidenten<br />
durchaus nahe. Wie Kissinger<br />
– allerdings nur <strong>von</strong> der Mutter her –<br />
ein Nachkomme jüdischer Naziflüchtlinge<br />
aus Deutschland, war er ein<br />
hochintelligenter Pragmatiker und<br />
überzeugt <strong>von</strong> der globalen Mission<br />
Amerikas als Ordnungsmacht. Und wie<br />
Kissinger hat Holbrooke fest geglaubt,<br />
Geschichte werde letztlich <strong>von</strong> grossen<br />
Männern gemacht. Talbott lässt keinen<br />
Zweifel daran, dass sein Freund<br />
Richard sich für eine dieser Persönlichkeiten<br />
gehalten hat. Sein grösster Erfolg,<br />
die Beilegung des Balkankonfliktes<br />
in Dayton Ende 1995, hat Holbrooke in<br />
dieser Überzeugung bestätigt.<br />
Wie die «New York Times» in einer ansonsten<br />
lobenden Besprechung anmerkt,<br />
hat der Erfolg amerikanischer<br />
Bombenangriffe auf Serbien Holbrooke<br />
jedoch zu der Illusion verleitet, diese<br />
würden auch im Irak Saddam Husseins<br />
rasch die Ziele Washingtons durchsetzen.<br />
Dabei hat Holbrooke als Co-Autor<br />
der «Pentagon Papers» bereits während<br />
des Vietnamkrieges verstanden,<br />
dass Wunschträume und konfuse Entscheidungsabläufe<br />
auch das mächtige<br />
Amerika in eine Katastrophe führen<br />
können. So haben ihn während seiner<br />
letzten, unvollendeten – und letztlich<br />
wohl unmöglichen – Mission in<br />
Afghanistan ständig Erinnerungen an<br />
Vietnam gequält. ●<br />
Von <strong>Andreas</strong> Mink
Agenda<br />
CLIVE ARROWSMITH / UMLAUT CORPORATION Der jüngste Beatle Naturschützer und Rennsport-Fan<br />
George Harrison (1943–2001) war nicht nur der<br />
jüngste und sympathischste Beatle: Er war auch als<br />
Solokünstler ein vorzüglicher Musiker – und eine<br />
vielfältige Persönlichkeit. Umweltschützer,<br />
leidenschaftlicher Gärtner und zugleich Formel-1-<br />
Fan, Sinnsucher und Filmproduzent für die schräge<br />
Truppe Monty Python. In sich gekehrter Philosoph<br />
und wilder Rock ’n’ Roller. Er tat Entscheidendes für<br />
die Popularität des Sitar-Virtuosen Ravi Shankar, mit<br />
Bestseller Januar 2012<br />
Belletristik<br />
1<br />
2<br />
3<br />
4<br />
5<br />
6<br />
7<br />
8<br />
9<br />
10<br />
Catalin D. Florescu: Jacob beschliesst zu<br />
lieben. C. H. Beck. 402 Seiten, Fr. 25.90.<br />
Michael Theurillat: Rütlischwur.<br />
Ullstein. 381 Seiten, Fr. 26.90.<br />
Umberto Eco: Der Friedhof in Prag.<br />
Hanser. 519 Seiten, Fr. 32.90.<br />
Paulo Coelho: Aleph.<br />
Diogenes. 309 Seiten, Fr. 27.90.<br />
Jonas Jonasson: Der Hundertjährige.<br />
Carl’s Books. 412 Seiten, Fr. 21.90.<br />
Alex Capus: Léon und Louise.<br />
Hanser. 314 Seiten, Fr. 24.90.<br />
<strong>Charles</strong> Lewinsky: Gerron.<br />
Nagel & Kimche. 539 Seiten, Fr. 34.90.<br />
Cecelia Ahern: Ein Moment fürs Leben.<br />
Krüger. 447 Seiten, Fr. 19.50.<br />
Jussi Adler-Olsen: Erlösung.<br />
dtv. 588 Seiten, Fr. 19.90.<br />
Paul Wittwer: Widerwasser.<br />
Nydegg. 400 Seiten, Fr. 39.-.<br />
Sachbuch<br />
1<br />
2<br />
3<br />
4<br />
5<br />
6<br />
7<br />
8<br />
9<br />
10<br />
Walter Isaacson: Steve Jobs.<br />
Bertelsmann. 701 Seiten, Fr. 35.50.<br />
Erhebung Media Control im Auftrag des SBVV; 17. 1. 2012. Preise laut Angaben <strong>von</strong> www.buch.ch.<br />
dem er hier posiert, und musizierte mit einem Who Is<br />
Who der Musikszene <strong>von</strong> Eric Clapton bis Bob Dylan.<br />
Olivia Harrison, die seit 1978 mit George verheiratet<br />
war, hat ihrem Mann einen umfassenden Text-Bild-<br />
Band gewidmet, der mit zahlreichen überraschenden<br />
Fotos und Dokumenten aufwartet. Manfred Papst<br />
Olivia Harrison: George Harrison. Living In The<br />
Material World. Knesebeck, München 2011.<br />
399 Seiten, Fr. 53.90.<br />
Guinness World Records 2012.<br />
Bibliographisches Institut. 280 Seiten, Fr. 35.90.<br />
Barney Stinson: Das Playbook.<br />
Riva. 176 Seiten, Fr. 15.90.<br />
Barney Stinson: Der Bro Code.<br />
Riva. 200 Seiten, Fr. 14.90.<br />
Rolf Dobelli: Die Kunst des klaren Denkens.<br />
Hanser. 246 Seiten, Fr. 21.90.<br />
Esther Girsberger: Eveline Widmer-<br />
Schlumpf. Orell Füssli. 208 Seiten, Fr. 29.90.<br />
Lisa Marti: Mutanfall.<br />
Wörterseh. 205 Seiten, Fr. 39.90.<br />
Richard D. Precht: Warum gibt es alles und<br />
nicht nichts. Goldmann. 200 Seiten, Fr. 34.50.<br />
Remo H. Largo: Jugendjahre.<br />
Piper. 400 Seiten, Fr. 35.90.<br />
Martin Ott: Kühe verstehen.<br />
Faro. 172 Seiten, Fr. 34.90.<br />
Agenda Februar 2012<br />
Basel<br />
Dienstag, 7. Februar, 19 Uhr<br />
Barbara Honigmann:<br />
Bilder <strong>von</strong> A. Lesung,<br />
Fr. 17.–. Literatur haus,<br />
Barfüssergasse 3,<br />
Tel. o61 261 29 50.<br />
Donnerstag, 9. Februar, 19 Uhr<br />
Sandra Hughes: Zimmer 307. Lesung,<br />
Fr. 17.–. Literaturhaus (s. oben).<br />
Donnerstag, 23. Februar, 19 Uhr<br />
Heiko Haumann: Hermann Diamanski –<br />
Überleben in der Katastrophe. Lesung,<br />
Fr. 17.–. Literaturhaus (s. oben).<br />
Bern<br />
Donnerstag, 2. Februar, 19 Uhr<br />
Werner Wüthrich: Frauen Land Frauen.<br />
Lesung, Eintritt frei, inkl. Apéro. Haupt-<br />
Buchhandlung, Falkenplatz 14,<br />
Tel. 031 309 09 09.<br />
Freitag, 17. Februar, 19.30 Uhr<br />
Pedro Lenz: Dr Goalie bin ig. Lesung,<br />
Fr. 20.–. Forum Altenberg, Altenberg -<br />
str. 40, Tel. 031 332 77 60.<br />
Mittwoch, 22. Februar, 20 Uhr<br />
Milena Moser: Montagsmenschen.<br />
Lesung, Fr. 15.–. Thalia im Loeb,<br />
Spitalgasse 47/51, Tel. 031 320 20 40.<br />
Zürich<br />
Donnerstag, 2. Februar, 20 Uhr<br />
Endo Anaconda: Walterfahren. Lesung,<br />
Fr. 18.–. Kaufleuten, Pelikanplatz 1,<br />
Tel. 044 225 33 77.<br />
Dienstag, 7. Februar, 20 Uhr<br />
Arno Camenisch:<br />
Ustrinkata. Lesung,<br />
Fr. 18.– . Literaturhaus,<br />
Limmatquai 62,<br />
Tel. 044 254 50 00.<br />
Donnerstag, 9. Februar, 20 Uhr<br />
Asli Erdogan. Die türkische Autorin in<br />
Residence im Gespräch. Fr. 18.– inkl.<br />
Apéro. Literaturhaus (s. oben).<br />
Freitag, 10. Februar, 16 Uhr<br />
Albert der Storch. Kinderlesung<br />
mit Claudia Engeler. Für Kinder<br />
<strong>von</strong> 4 bis 8 Jahren. Pestalozzi-Bibliothek,<br />
Zürich-Affoltern, Bodenacker 25.<br />
Info: www.pbz.ch.<br />
Mittwoch, 22. Februar, 20 Uhr<br />
Helen FitzGerald: Tod sei Dank. Lesung,<br />
Fr. 15.–. Kaufleuten (s. oben).<br />
Donnerstag, 23. Februar, 20 Uhr<br />
Sarah Kuttner: Wachstumsschmerz.<br />
Lesung, Fr. 25.–. Komplex 457,<br />
Hohlstrasse 457, Tel. 044 500 00 60.<br />
Bücher am Sonntag Nr. 2<br />
erscheint am 26. 2. 2012<br />
Weitere Exemplare der Literaturbeilage «Bücher am<br />
Sonntag» können bestellt werden per Fax 044 258 13 60<br />
oder E-Mail sonderbeilagen@nzz.ch. Oder sind – solange<br />
Vorrat – beim Kundendienst der NZZ, Falkenstrasse 11,<br />
8001 Zürich, erhältlich.<br />
29. Januar 2012 ❘ NZZ am Sonntag ❘ 27<br />
YVONNE BÖHLER MICHA BAR AM / MAGNUM
Freiheit, Recht und Reichtum sind eine direkte Folge staatlicher<br />
Souveränität. Im Umkehrschluss bedeutet das: Je weniger<br />
Souveränität, desto weniger Reichtum, Recht und Freiheit. Dennoch<br />
wird heute in internationalen Gremien viel über Souveränitätsverzicht<br />
als Mittel zur Mehrung <strong>von</strong> Frieden und Wohlstand diskutiert.<br />
Johannes B. Kunz geht in seinem Buch diesem Widerspruch auf den<br />
Grund und erläutert den Zusammenhang zwischen Souveränität und<br />
Freiheit bzw. Demokratie.<br />
Die staatliche Souveränität sieht er durch die Machtpolitik, die internationalen<br />
Organisationen, den heutigen humanitären Interventionismus<br />
und die Europäische Union gefährdet. Er setzt die Souveränität<br />
in Bezug zur Globalisierung und zeigt Wege auf, wie sie gewahrt<br />
werden kann.<br />
DIE NEUE POLIS GeorgKreis ·Das «Helvetische Malaise»<br />
www.nzz-libro.ch<br />
Das «Helvetische Malaise»<br />
Max Imbodens historischer Zuruf<br />
und seine überzeitliche Bedeutung<br />
GeorgKreis<br />
«Helvetisches Malaise» <strong>von</strong> 1964 gehört zu<br />
den in seiner Zeit am häufigsten zitierten<br />
Schriften. Ihr Ruhm hallt bis heute nach.<br />
Derander Universität Basel lehrende und<br />
als Freisinniger politisierende Professor<br />
fürStaats- und Verwaltungsrecht Max<br />
Imboden setzt sich darin kritisch mit den<br />
Schwächen des politischen Systems der<br />
Schweiz auseinander.Schon damals merkte<br />
er an, dass die Schweiz nicht als autarke Insel<br />
im europäischen Staatengefüge existieren<br />
kann. In der <strong>Neue</strong>dition dieser historischen<br />
Intervention wirdder Text mithilfeerstmals<br />
zugänglicher Tagebuchaufzeichnungen in<br />
den zeitgenössischen Kontext eingeordnet,<br />
im Detail kommentiert und im Lichte der<br />
weiteren Entwicklung bewertet.<br />
[164 Seiten zeitgenössische Politik]<br />
DIE NEUE POLIS<br />
Verlag <strong>Neue</strong> <strong>Zürcher</strong> Zeitung<br />
2011. 164 Seiten, 7s/w Abbildungen.<br />
Fr. 24.– / € 21.–<br />
10CFWMMQ6DMBAEX3TW7tpnuFyJ6BAFoncTpc7_q0A6ii1mNNptSy_4b1n3cz2SQHOjB6vSw4umnrNU0OYEKYF6IQTJux69gdEr6ribC4waCGNY7UMNg7ofLsfQVL7vzw9_1Lk_gAAAAA==<br />
10CAsNsjY0MDAx1TU0tTQ0NgIA9MxGoQ8AAAA=<br />
2011. 400 Seiten, 5Grafiken.<br />
Fr. 58.– / € 50.–<br />
Max Imbodens Buch «Helvetisches Malaise» hat 1964 für heftige<br />
Diskussionen gesorgt. Es diagnostizierte der schweizerischen Politik<br />
u. a. Isolationismus, Sloganisierung und Verdrossenheit beim Wahlund<br />
Stimmvolk. In Intellektuellenvoten fällt das Schlagwort<br />
«helvetisches Malaise» seither regelmässig, obwohl zu vermuten ist,<br />
dass nicht alle den wegweisenden Text noch präsent haben.<br />
Jetzt kann Abhilfe geschaffen werden. Georg Kreis hat Imbodens<br />
Text mit Kommentaren und Hinweisen zur Wirkungsgeschichte neu<br />
herausgegeben.