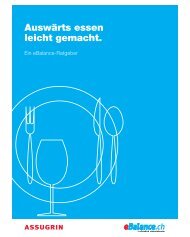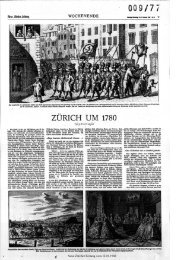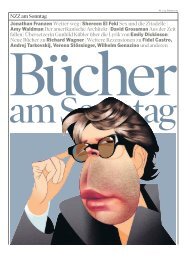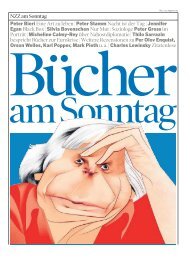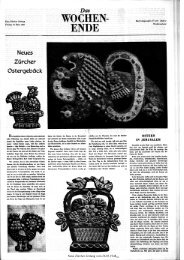Charles Dickens Essay von Andreas Isenschmid - Neue Zürcher ...
Charles Dickens Essay von Andreas Isenschmid - Neue Zürcher ...
Charles Dickens Essay von Andreas Isenschmid - Neue Zürcher ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Belletristik<br />
Roman Zum 80. Geburtstag Aharon Appelfelds erscheint sein neues autobiografisches<br />
Buch. Darin beschwört er die jüdische Vergangenheit und Israels Gegenwart<br />
<strong>Neue</strong> Melodien in<br />
einer alten Sprache<br />
Aharon Appelfeld: Der Mann, der nicht<br />
aufhörte zu schlafen. Aus dem<br />
Hebräischen <strong>von</strong> Mirijam Pressler.<br />
Rowohlt, Berlin 2012. 285 Seiten, Fr. 28.50.<br />
Von Christoph Plate<br />
Als Hebräisch zu seiner neuen Muttersprache<br />
wurde, wäre er fast verstummt.<br />
Weil er immer noch auf Deutsch und<br />
Jiddisch dachte und weil sie ihn zwangen,<br />
die neue Sprache zu benutzen.<br />
Heute, 66 Jahre nach seiner Ankunft in<br />
diesem Land, mag er Hebräisch. Die<br />
Sprache ist alt, voller Bilder, und sie lebt,<br />
auch wenn geschwiegen wird.<br />
Es ist laut. Wir sitzen im Restaurant<br />
des Tichu-House, einer Galerie im Zentrum<br />
Jerusalems. Die jungen Frauen am<br />
Nachbartisch, leicht übergewichtig und<br />
etwas zu stark geschminkt, sind so lärmig,<br />
dass Aharon Appelfeld immer wieder<br />
einmal sanft strafend hinüberschaut.<br />
Dann essen wir weiter, schauen uns an,<br />
reden, bis die Frauen nebenan wieder<br />
laut werden. Vor über 50 Jahren war der<br />
heute 80-Jährige zum ersten Mal hier.<br />
Der Philosoph Martin Buber brachte ihn<br />
ins Haus <strong>von</strong> Anna Tichu, der malenden<br />
Frau eines Wiener Augenarztes. «Freitags<br />
gab es Apfelstrudel mit Sahne und<br />
Kaffee, zwei Dutzend Intellektuelle<br />
waren da, ich war zu schüchtern, um<br />
auch nur etwas zu sagen», erklärt Appelfeld.<br />
Er zeigt die breiten Ledersessel,<br />
in denen sie damals sassen.<br />
Kandidat für den Nobelpreis<br />
Heute gehört das Haus der Museumsgesellschaft,<br />
Appelfeld kommt gern<br />
hierher, plaudert mit den Sicherheitsleuten<br />
am Eingang, und die Serviertöchter<br />
begegnen ihm mit einer Ehrfurcht,<br />
als wüssten sie, dass dieser Mann mit<br />
der blauen Schiebermütze auf dem kahlen<br />
Schädel immer wieder ein Kandidat<br />
für den Literaturnobelpreis ist.<br />
Sein neues, bei Rowohlt auf Deutsch<br />
erschienenes Buch «Der Mann, der<br />
nicht aufhörte zu schlafen» ist eine<br />
4 ❘ NZZ am Sonntag ❘ 29. Januar 2012<br />
Eloge auf das Leben, eine Danksagung<br />
an seine Eltern und ein Zeugnis da<strong>von</strong>,<br />
wie jemand sich eine neue Sprache erkämpfen<br />
muss. Zuhause in Czernowitz<br />
sprach man in der assimilierten jüdischen<br />
Familie Deutsch. Paul Celan<br />
wohnte in der gleichen Strasse. Damals<br />
war Czernowitz Schnittstelle zwischen<br />
Ost und West, heute liegt es vergessen<br />
im Südwesten der Ukraine, nahe der<br />
Grenze zu Rumänien.<br />
Träumt Appelfeld <strong>von</strong> seinen Eltern<br />
– die Mutter wurde <strong>von</strong> rumänischen<br />
Faschisten erschossen, der Vater überlebte<br />
den Holocaust und emigrierte<br />
nach Jahren in der Sowjetunion nach Israel<br />
–, dann spricht er das Deutsch eines<br />
8-Jährigen. Im Traum ist Aharon aber<br />
schon erwachsen, und der Vater macht<br />
sich lustig über dessen Kinderdeutsch.<br />
Zur Mutter sagt er: «Mama, ich habe<br />
eine neue Sprache.» Appelfeld teilt sein<br />
Aharon Appelfeld<br />
Geboren wurde Aharon Appelfeld am<br />
16.2.1932 in der Nähe <strong>von</strong> Czernowitz<br />
(damals Rumänien, heute Ukraine). Er<br />
wuchs in einem gut bürgerlichen Haushalt<br />
auf. Damals hiess er noch Erwin. Erst<br />
der Holocaust habe ihn zum Juden gemacht,<br />
sagt er. Er musste den Mord an<br />
seiner Mutter miterleben, wurde mit dem<br />
Vater zusammen ins Ghetto gesperrt und<br />
schlug sich später alleine bis nach Italien<br />
durch. Von dort gelang er 1946 nach Palästina.<br />
Diese traumatischen Erlebnisse<br />
sind die Triebfeder seines Schaffens.<br />
Seine Muttersprache war Deutsch, heute<br />
ist die für ihn wichtigste Sprache Hebräisch.<br />
Er arbeitete <strong>von</strong> 1975 bis 2001 als<br />
Literaturprofessor an der Ben Gurion<br />
Universität in Beerscheba. Zu seinen<br />
gros sen Romanen gehören: «Blumen der<br />
Finsternis», «Bis der Tag anbricht» und<br />
«Elternland». Für «Der eiserne Pfad»<br />
wurde er 1999 mit dem National Jewish<br />
Book Award ausgezeichnet.<br />
Croissant und strahlt zufrieden. Er<br />
trinkt koffeinfreien Kaffee, der aus<br />
einem altmodischen Tassenfilter tröpfelt.<br />
Dann bestellt er eine Gemüsesuppe,<br />
Osteuropäer liebten doch Suppen, obwohl<br />
diese hier längst nicht so gut sei,<br />
wie die im Café Sprüngli am Paradeplatz<br />
in Zürich.<br />
In «Der Mann, der nicht aufhörte zu<br />
schlafen» geht es um vieles. Um die<br />
Suche nach einer Melodie in der Sprache,<br />
um das Bewusstsein für die eigene<br />
Geschichte und die Bedeutung des Sich-<br />
Erinnerns, um die eigene Position in der<br />
Gegenwart zu bestimmen. Seit einigen<br />
Jahren bekommt Appelfeld Briefe <strong>von</strong><br />
israelischen Lesern, die schreiben, sie<br />
hätten ihre Eltern oder Grosseltern nie<br />
nach dem jüdischen Leben in Osteuropa<br />
und nach dem Holocaust gefragt.<br />
«Meine Bücher würden ihnen diese untergegangene<br />
Welt des Judentums, ihre<br />
Gerüche und Schönheit nahe bringen.»<br />
Liest er diese Briefe, zittert er manchmal<br />
vor Aufregung und Last. Ihm wird da<br />
eine Rolle zugedacht, die er gar nicht<br />
annehmen mag. Lange wurde Appelfeld<br />
vom literarischen Establishment gescholten,<br />
weil er keinen Agitprop<br />
schrieb, sondern die Geschichte jener<br />
erzählte, die nach dem Holocaust aus<br />
Europa nach Palästina gekommen<br />
waren. Das passte nicht nach Israel.<br />
Appelfeld hat damals festgestellt, dass<br />
«man als assimilierter Jude Weltbürger<br />
ist, während man als Israeli schnell provinziell<br />
wird».<br />
«Der Mann, der nicht aufhörte zu<br />
schlafen» ist ein autobiografischer<br />
Roman, wobei jedes seiner Bücher auch<br />
den Aharon Appelfeld zu enthalten<br />
scheint, der früher Erwin hiess. Aharon<br />
wurde in Czernowitz als Erwin geboren,<br />
als er mit ukrainischen Banditen<br />
umherzog, nannte er sich Janosch.<br />
Appelfeld ist überzeugt, dass jede Art<br />
<strong>von</strong> Äusserung eine Verstellung sei, die<br />
Literatur aber eine der am wenigsten<br />
verstellten Äusserungen. Es sind dies<br />
Erinnerungen, wie sie einige auch schon<br />
in seinem Buch «Die Geschichte eines