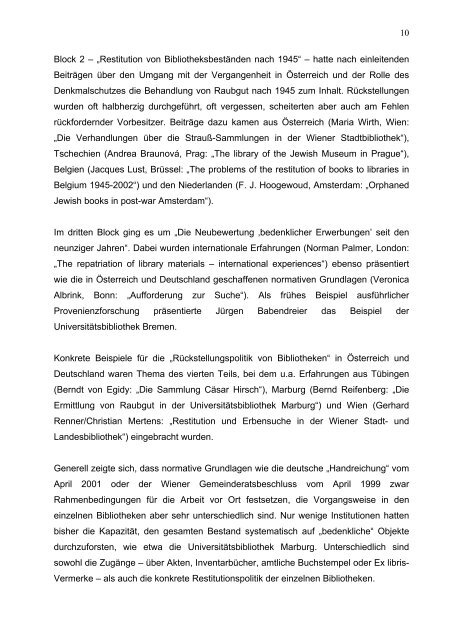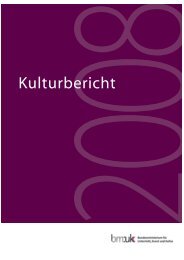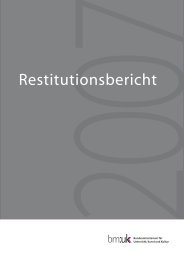Restitutionsbericht 2003 - Wien Museum
Restitutionsbericht 2003 - Wien Museum
Restitutionsbericht 2003 - Wien Museum
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
10Block 2 – „Restitution von Bibliotheksbeständen nach 1945“ – hatte nach einleitendenBeiträgen über den Umgang mit der Vergangenheit in Österreich und der Rolle desDenkmalschutzes die Behandlung von Raubgut nach 1945 zum Inhalt. Rückstellungenwurden oft halbherzig durchgeführt, oft vergessen, scheiterten aber auch am Fehlenrückfordernder Vorbesitzer. Beiträge dazu kamen aus Österreich (Maria Wirth, <strong>Wien</strong>:„Die Verhandlungen über die Strauß-Sammlungen in der <strong>Wien</strong>er Stadtbibliothek“),Tschechien (Andrea Braunová, Prag: „The library of the Jewish <strong>Museum</strong> in Prague“),Belgien (Jacques Lust, Brüssel: „The problems of the restitution of books to libraries inBelgium 1945-2002“) und den Niederlanden (F. J. Hoogewoud, Amsterdam: „OrphanedJewish books in post-war Amsterdam“).Im dritten Block ging es um „Die Neubewertung ‚bedenklicher Erwerbungen’ seit denneunziger Jahren“. Dabei wurden internationale Erfahrungen (Norman Palmer, London:„The repatriation of library materials – international experiences“) ebenso präsentiertwie die in Österreich und Deutschland geschaffenen normativen Grundlagen (VeronicaAlbrink, Bonn: „Aufforderung zur Suche“). Als frühes Beispiel ausführlicherProvenienzforschung präsentierte Jürgen Babendreier das Beispiel derUniversitätsbibliothek Bremen.Konkrete Beispiele für die „Rückstellungspolitik von Bibliotheken“ in Österreich undDeutschland waren Thema des vierten Teils, bei dem u.a. Erfahrungen aus Tübingen(Berndt von Egidy: „Die Sammlung Cäsar Hirsch“), Marburg (Bernd Reifenberg: „DieErmittlung von Raubgut in der Universitätsbibliothek Marburg“) und <strong>Wien</strong> (GerhardRenner/Christian Mertens: „Restitution und Erbensuche in der <strong>Wien</strong>er Stadt- undLandesbibliothek“) eingebracht wurden.Generell zeigte sich, dass normative Grundlagen wie die deutsche „Handreichung“ vomApril 2001 oder der <strong>Wien</strong>er Gemeinderatsbeschluss vom April 1999 zwarRahmenbedingungen für die Arbeit vor Ort festsetzen, die Vorgangsweise in deneinzelnen Bibliotheken aber sehr unterschiedlich sind. Nur wenige Institutionen hattenbisher die Kapazität, den gesamten Bestand systematisch auf „bedenkliche“ Objektedurchzuforsten, wie etwa die Universitätsbibliothek Marburg. Unterschiedlich sindsowohl die Zugänge – über Akten, Inventarbücher, amtliche Buchstempel oder Ex libris-Vermerke – als auch die konkrete Restitutionspolitik der einzelnen Bibliotheken.