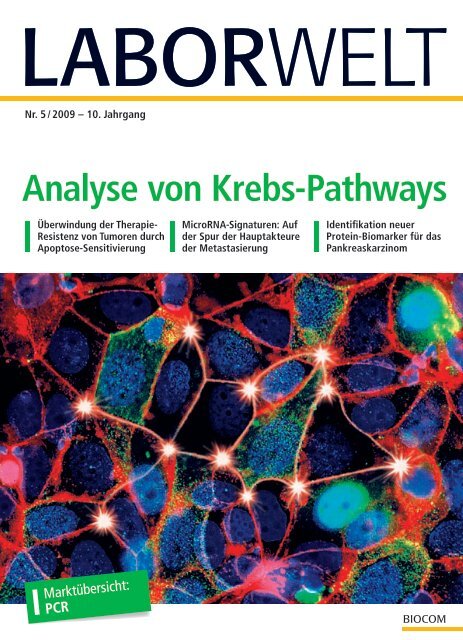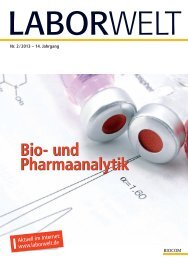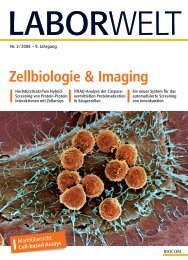PDF Download - Laborwelt
PDF Download - Laborwelt
PDF Download - Laborwelt
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
laborwelt<br />
Nr. 5 / 2009 – 10. Jahrgang<br />
Analyse von Krebs-Pathways<br />
Überwindung der Therapie-<br />
Resistenz von Tumoren durch<br />
Apoptose-Sensitivierung<br />
Marktübersicht:<br />
PCR<br />
MicroRNA-Signaturen: Auf<br />
der Spur der Haupt akteure<br />
der Metastasierung<br />
Identifikation neuer<br />
Protein-Biomarker für das<br />
Pankreaskarzinom
Normalized Cell Cell Index Cell Index Index<br />
5<br />
Cells in Real-Time!<br />
5<br />
4<br />
5<br />
4<br />
3<br />
4<br />
3<br />
2<br />
3 Seed<br />
2 Cells<br />
1 Seed<br />
2 Cells<br />
1 Seed<br />
0 Cells<br />
1<br />
0<br />
0<br />
Cells in Real-Time!<br />
Treatment<br />
Treatment<br />
Treatment<br />
20 40 60<br />
Control<br />
12.5 Control µM Etoposide<br />
12.5 Control 25 µM Etoposide<br />
12.5 25 µM Etoposide<br />
25 µM Etoposide<br />
50 µM Etoposide<br />
100 50 µM Etoposide<br />
100 50 µM Etoposide 80<br />
0<br />
0<br />
20 Time 40 (hours) 60 100 µM Etoposide 80<br />
0 20 Time 40 (hours)<br />
Time (hours)<br />
60 80<br />
www.roche-applied-science.com<br />
www.roche-applied-science.com<br />
www.roche-applied-science.com<br />
xCELLigence Real-Time<br />
xCELLigence Real-Time<br />
xCELLigence Cell Analyzer Real-Time System<br />
Cell Analyzer System<br />
Cell Analyzer System<br />
Discover<br />
what<br />
you’ve<br />
been<br />
missing<br />
Cells in Real-Time!<br />
Figure 1: Real-time monitoring of cytotoxicity<br />
Figure through 1: DNA Real-time damage. monitoring Etoposide of is cytotoxicity<br />
a DNA damaging<br />
Figure through agent which 1: DNA Real-time induces damage. apoptosis monitoring Etoposide in high of is cytotoxicity<br />
a concentrations,<br />
DNA damaging<br />
through agent while at which lower DNA induces concentrations damage. apoptosis Etoposide it in leads high is a to concentrations,<br />
DNA S-Phase damaging and/or<br />
agent while G2 arrest. at which lower induces concentrations apoptosis it in leads high to concentrations,<br />
S-Phase and/or<br />
while G2 arrest. at lower concentrations it leads to S-Phase and/or<br />
G2 arrest.<br />
XCELLIGENCE is a trademark of Roche.<br />
© 2009 Roche Diagnostics GmbH. All rights reserved.<br />
XCELLIGENCE is a trademark of Roche.<br />
© 2009 Roche Diagnostics GmbH. All rights reserved.<br />
XCELLIGENCE is a trademark of Roche.<br />
© 2009 Roche Diagnostics GmbH. All rights reserved.<br />
Besuchen Sie uns<br />
Besuchen Sie uns<br />
Besuchen Sie uns<br />
auf der Biotechnica<br />
auf der Biotechnica<br />
auf der Biotechnica<br />
vom 6.-8. Oktober 2009<br />
vom 6.-8. Oktober 2009<br />
vom 6.-8. Oktober 2009<br />
in Halle 9 am Stand C11<br />
in Halle 9 am Stand C11<br />
in Halle 9 am Stand C11<br />
Experience the power of dynamic, Real-Time, non-invasive cellular<br />
Experience analysis with the the power xCELLigence of dynamic, System Real-Time, from Roche non-invasive Applied cellular Science.<br />
Experience analysis with the the power xCELLigence of dynamic, System Real-Time, from Roche non-invasive Applied cellular Science.<br />
analysis Acquire with data that the xCELLigence end-point analysis System could from never Roche realize, Applied throughout Science.<br />
Acquire your entire data experiment. that end-point Choose analysis between could 3×16, never 96- realize, or 6×96 throughout well<br />
Acquire your data that end-point analysis could never realize, throughout<br />
microtiter entire plate experiment. formats. Choose between 3×16, 96- or 6×96 well<br />
your microtiter entire plate experiment. formats. Choose between 3×16, 96- or 6×96 well<br />
microtiter � Just add plate cells: formats. Obtain physiologically relevant data without labels and<br />
� Just<br />
�<br />
reporters.<br />
add cells: Obtain physiologically relevant data without labels and<br />
Just<br />
reporters.<br />
add cells: Obtain physiologically relevant data without labels and<br />
� reporters. Don’t miss any effect: Capture online data throughout the entire<br />
� Don’t miss any effect: Capture online data throughout the entire<br />
�<br />
experiment.<br />
Don’t<br />
experiment.<br />
miss any effect: Capture online data throughout the entire<br />
� experiment. Maximize versatility: Detect cells across a broad dynamic range and<br />
� Maximize versatility: Detect cells across a broad dynamic range and<br />
�<br />
perform a wide variety of applications.<br />
Maximize<br />
perform a wide<br />
versatility:<br />
variety of<br />
Detect<br />
applications.<br />
cells across a broad dynamic range and<br />
(e.g., proliferation and cytotoxicity, Figure 1)<br />
perform<br />
(e.g., proliferation<br />
a wide variety<br />
and cytotoxicity,<br />
of applications.<br />
Figure 1)<br />
� (e.g., Analyze proliferation Cell Migration and cytotoxicity, and Invasion Figure with 1) a special<br />
� Analyze Cell Migration and Invasion with a special NEW<br />
�<br />
chamber for the 3×16 well format<br />
Analyze<br />
chamber<br />
Cell<br />
for the<br />
Migration<br />
3×16 well<br />
and<br />
format<br />
Invasion with a special NEW<br />
NEW<br />
For chamber more information, for the 3×16 visit well format www.xcelligence.roche.com or<br />
For contact more your information, local Roche visit representative www.xcelligence.roche.com today!<br />
or<br />
For contact more your information, local Roche visit representative www.xcelligence.roche.com today!<br />
or<br />
contact your local Roche representative today!<br />
Roche Diagnostics GmbH<br />
Roche Diagnostics Applied Science GmbH<br />
Roche 68298 Mannheim, Diagnostics Applied Science Germany GmbH<br />
Roche 68298 Mannheim, Applied Science Germany<br />
68298 Mannheim, Germany
Krebs: Vielfalt der<br />
Signale...<br />
Statistisch gesehen erkrankt jeder dritte Erwachsene im Laufe seines<br />
Lebens an Krebs, 30% bis 40% werden nach heutiger Definition geheilt,<br />
sie überleben nach Operation und Chemo-, Strahlen-, Hormon- oder gezielter<br />
Therapie mehr als fünf Jahre. Allerdings sterben die meisten von<br />
ihnen trotzdem – nur später, denn 90% der Todesfälle sind nicht auf das<br />
Primärkarzinom oder -sarkom zurückzuführen, sondern kommen durch die<br />
Bildung von Metastasen zustande. Kaum ein Tag vergeht, an dem nicht eine<br />
Meldung über einen Durchbruch in der Krebstherapie verlautbart wird.<br />
Doch das höchst heterogen zusammengesetzte Tumorgewebe entzieht<br />
sich diversen Therapiestragegien, zum Beispiel durch Entwicklung von<br />
Therapieresistenzen, Immuntoleranz des Tumor-induzierenden Zellklons<br />
etc. In dieser LABORWELT-Themenausgabe „Krebs - Analyse von Signalwegen“<br />
stellen wir neue molekularbiologische Strategien zur Erforschung,<br />
Diagnose und Behandlung von Krebs vor, die in das Netzwerk deregulierter<br />
Apoptose-, Zellzyklus- und Wachstumshormon-Schalter eingreifen.<br />
Eine neue Strategie, die die Fähigkeit von Tumoren unterlaufen soll, nach<br />
mehrfacher Behandlung, Resistenzen gegen verschiedenste Therapieformen<br />
auszuprägen, hat die Arbeitsgruppe von Sebastian Wesselborg vom<br />
Universitätsklinikum Tübingen entwickelt (vgl. Seite 4). Mittels Sensitivierung<br />
des Tumors für den durch TRAIL (TNF-related apopoptosis-nducing<br />
ligand) vermittelten programmierten Zelltod erzielten sie erste Erfolge.<br />
microRNA-Schalter, die den todbringenden Prozess der Metastasierung<br />
steuern, beschreibt ein US-Team um Carlo Croce. Mit Hilfe von Microarray-<br />
Untersuchungen haben die Forscher von der Thomas Jefferson University<br />
durch Vergleich von Primärtumoren und Metastasen eine miRNA-Signatur<br />
aus differentiell exprimierten miRNA-Genen und Gewebemarkern<br />
entdeckt (vgl. Seite 12). Aus Sicht des Brustkrebs- und Signaltransduktionsspezialisten<br />
Ralf Hass von der MHH können allerdings Mono- und<br />
auch Kombinationstherapien den unterschiedlichen Ausprägungen der<br />
Metastasierung nur bedingt gerecht werden (vgl. Seite 15) – er nennt<br />
Argumente für eine Individualtherapie.<br />
Dies sind nur wenige Ausschnitte aus dem weiten Spektrum an Beiträgen<br />
dieser Themenausgabe. Übrigens, sind sie auf der Biotechnica? Dann<br />
freuen wir uns über Ihren Besuch an Stand E11 in Halle 9.<br />
In diesem Heft<br />
Marktübersicht: PCR<br />
Thomas Gabrielczyk<br />
Egal ob PCR-Entdecker Kary Mullis die Polymerase-Kettenreaktion nun<br />
nie ohne psychedelische Drogen entdeckt hätte, wie Journalisten berichten<br />
– sie ist aus keinem Labor wegzudenken.Derzeit entwickelt sie<br />
sich vom reinen Forschungstool zumWerkzeug der molekularen Diagnostik.<br />
Den aktuellen Stand präsentieren die Anbieter ab Seite 36.<br />
Inhalt<br />
Editorial | Inhalt<br />
Blitzlicht Apoptose-Sensitivierung<br />
4 Überwindung der Therapieresistenz durch Akt/PKB-Inhibition<br />
Sebastian Wesselborg et al., Universitätsklinikum Tübingen<br />
Blitzlicht Genomics<br />
8 Erworbene Änderungen der Kopienzahl in AML-Genomen<br />
Burkhard Ziebolz, Roche Applied Science, Penzberg<br />
Wissenschaft RNA-Interferenz<br />
12 MicroRNAs – Haupakteure der Metastasierung<br />
Carlo Croce et al., Comprehensive Cancer Center, Ohio State University<br />
Report Metastasierung<br />
15 Brustkrebs und Metastasierung – Vorteile einer Individualtherapie<br />
Ralf Hass, Medizinische Hochschule Hannover<br />
Blitzlicht Multikinase-Inhibitoren<br />
18 Experimentelle Therapie von Flt3-ITD-positiven AML-Patienten<br />
Andreas Burchert et al., Universität Marburg<br />
Blitzlicht DNA-Methylierungsanalyse<br />
23 BEAMing: Sensitive Plasmadiagnostik in der Onkologie<br />
Frank Diehl et al., Inostics GmbH, Hamburg<br />
Blitzlicht Proteomics<br />
26 Detektion neuer Tumor-assoziierter Biomarker des<br />
Pankreaskarzinoms<br />
Georg Martin Fiedler, Joachim Thiery et al., Universität Leipzig<br />
Blitzlicht Protein-Microarrays<br />
29 Sensitive, quantitative Analyse von Signalwegen<br />
Ulrike Korf et al., Deutsches Krebsforschungszentrum Heidelberg<br />
Blitzlicht Kongress<br />
33 Weltkongress der Stammzellforscher in Leipzig<br />
Blitzlicht Bibliometrie<br />
34 Leistungsmessung in der Forschung – Erfordernis oder<br />
Vermessenheit?<br />
Stefan Hornbostel, Markus von Ins,<br />
Institut für Forschungsinformation und Qualitätssicherung (iFQ), Bonn<br />
Service Marktübersicht<br />
36 Polymerase-Kettenreaktion<br />
46 Stellenmarkt<br />
50 Verbände<br />
51 Produktwelt<br />
53 Termine<br />
54 Ausblick/ Impressum<br />
Titel: Analyse von Krebssignalwegen<br />
Fluoreszenzmikroskopische Aufnahme eines in Kultur<br />
gewachsenen epithelialen Monolayers aus Brustkrebszellen<br />
Foto: © Roche<br />
www.laborwelt.de – jetzt online!<br />
LABORWElT 10. Jahrgang | Nr. 5/2009 | 3
Blitzlicht Apoptose-Sensitivierung<br />
Überwindung der<br />
Therapieresistenz durch<br />
Akt/PKB-Inhibition<br />
Dr. Björn Stork, Dipl.-Biochem. Alexandra Dieterle, Prof. Dr. Sebastian Wesselborg,<br />
Universitätsklinikum Tübingen<br />
Zahlreiche Tumore entwickeln nach mehrmaliger Behandlung Resistenzen gegen konventionelle<br />
Chemotherapie und Bestrahlung,aber auch gegen neuartige,zielgerichtete Agenzien wie denTNFrelated<br />
apoptosis-inducing ligand (TRAIL).Deshalb steht die Überwindung derTherapieresistenz im<br />
Fokus bei der Enwicklung neuer Therapiekonzepte. Der PI3K/Akt-Signalweg ist in vielen Tumoren<br />
konstitutivaktiviert undträgt zurVermittlungvonTherapieresistenzenbei.Dementsprechendzielen<br />
verschiedene therapeutische Strategien auf die Inhibition dieses Überlebenssignalweges.Der Akt-<br />
InhibitorTriciribin (TCN) sensitiviert Prostatakarzinomzellen für dieTRAIL-induzierte Apoptose.Die<br />
beobachtete Sensitivierung hängt entscheidend vom Akt-Aktivierungsszustand ab.Ausschließlich<br />
Prostatakrebszellen,die konstitutiv aktives Akt aufweisen,werden für dieTodesrezeptor-induzierte<br />
Apoptose sensitiviert. Sowohl TRAIL- als auch TCN-Derivate werden aktuell in klinischen Studien<br />
getestet. Ihre kombinierte Anwendung könnte einen möglichen Therapieansatz darstellen, um<br />
Hormon-refraktäre Prostatakarzinome zu eliminieren, welche häufig gegen konventionelle Chemotherapeutika<br />
und Bestrahlung resistent sind.<br />
A B<br />
Abb. 1: TCN verstärkt die TRAIL-induzierte Apoptose in PC-3-Zellen. A. PC-3-Zellen wurden mit<br />
10 µM TCN, 40 ng/mL TRAIL oder der Kombination der beiden Substanzen für 24 h behandelt.<br />
Die Apoptose wurde durch die Anfärbung hypodiploider Zellkerne mit Propidiumiodid<br />
und anschließender Durchflusszytometrie bestimmt. B. PC-3-Zellen wurden<br />
mit 0,1% DMSO (Lösungsmittelkontrolle; Bahn 1),TCN (10 µM; Bahn 2),TRAIL (40 ng/mL;<br />
Bahnen 3-6),TRAIL und TCN (TCN wurde für eine Stunde vorinkubiert; Bahnen 7-10) oder<br />
TRAIL,TCN und dem Caspase-Inhibitor QVD (10 µM; Bahn 11) für die angegebenen Zeiten<br />
behandelt. Die Immunoblots wurden mit anti-PARP- oder anti-Vinculin-Antikörpern<br />
durchgeführt.<br />
Ein Haupthemmnis, das der effektiven Behandlung<br />
maligner solider Tumoren entgegensteht,<br />
ist die Entwicklung von Resistenzen<br />
gegenüber Chemotherapeutika oder Bestrahlung.<br />
Verschiedene Mechanismen tragen zur<br />
Resistenzvermittlung bei – unter anderem<br />
sind auf molekularer Ebene die Inhibition von<br />
Zelltod-Signalwegen, die Inaktivierung von Seneszenzprogrammen,<br />
die Induktion protektiver<br />
Autophagie, epigenetische Veränderungen,<br />
die Vermehrung von Tumorstammzellen und<br />
die Aktivierung von Überlebenssignalwegen<br />
beteiligt. Das Verständnis und die Überwindung<br />
solcher Therapieresistenzen ist unser zentraler<br />
Forschungsschwerpunkt im Rahmen des Sonderforschungsbereiches<br />
773 der Universität<br />
Tübingen.<br />
Krebserkrankungen sind die zweithäufigste<br />
Todesursache weltweit, und das Prostatakarzinom<br />
eine Hauptursache der krebsbedingten<br />
Mortalität bei Männern. Gegenwärtige Therapien<br />
umfassen die Prostatektomie sowie die<br />
Chemo- und Radiotherapie 1 . Patienten mit rezidiver<br />
sowie metastasierender Krebserkrankung<br />
werden durch den Entzug androgener Hormone<br />
behandelt 1 . Dieses kann zu Androgen-unabhängigen<br />
Prostatakarzinomen führen, die eine ausgeprägte<br />
Resistenz gegenüber der Chemotherapie<br />
aufweisen, und die Lebenserwartung auf<br />
durchschnittlich 15 bis 20 Monate verkürzen 2 . Im<br />
Allgemeinen wirken Radio- und Chemotherapie<br />
DNA-schädigend und aktivieren den intrinsischen<br />
mitochondrialen Apoptose-Signalweg.<br />
Im vergangenen Jahrzehnt konnte gezeigt<br />
werden, das der extrinisische Todesrezeptorweg<br />
ebenfalls ein geeignetes Ziel für die Krebstherapie<br />
ist. Dabei zeigte sich, dass der TNF-related<br />
apoptosis-inducing ligand (TRAIL) in verschiedenen<br />
Tumorzellen die Apoptose induziert, nicht<br />
jedoch in normalen Zellen 3, 4 . Dementsprechend<br />
werden derzeit rekombinantes TRAIL, TRAIL-<br />
Varianten oder agonistische Antikörper in<br />
verschiedenen klinischen Studien getestet 5 .<br />
Viele Tumorzellen entwickeln jedoch im Verlauf<br />
der Therapie eine TRAIL-Resistenz. Ein aktueller<br />
Forschungsschwerpunkt besteht in der Analyse<br />
der Mechnismen, die zur TRAIL-Resistenz in<br />
Tumoren führen und eine Re-Sensitivierung<br />
von Tumorzellen für eine TRAIL-Behandlung ermöglichen.<br />
Verschiedene molekulare Faktoren,<br />
die Tumorzellen eine TRAIL-Resistenz verleihen,<br />
wurden bislang beschrieben, zum Beispiel.<br />
Decoy-Rezeptoren, cFLIP, nuclear factor (NF)-κB,<br />
oder anti-apoptotische Kinasen wie Akt (Proteinkinase<br />
B). Insgesamt könnte die kombinierte<br />
Verwendung von TRAIL oder TRAIL-Rezeptor-<br />
Agonisten mit Agenzien, die Tumorzellen für<br />
die TRAIL-induzierte Apoptose sensitivieren, die<br />
molekulare Basis für eine erfolgreiche Behandlung<br />
von Krebserkrankungen darstellen.<br />
Der Akt-Inhibitor Triciribin<br />
Neben der Inaktivierung von Apoptose-Signalwegen<br />
kann auch die übermäßige Aktivierung<br />
von Überlebenssignalwegen Therapieresistenzen<br />
von Tumorzellen bewirken. In Prostatakarzinomen<br />
konnten verschiedene Mechanismen<br />
identifiziert werden, durch die die Aktivität von<br />
Akt hochreguliert wird – unter anderem die<br />
Überexpression von Akt, der Verlust des negativen<br />
Akt-Regulators Phosphatase and tensin<br />
homolog deleted on chromosome 10 (PTEN)<br />
durch Deletion, Mutation oder epigenetische<br />
Veränderungen, Überexpression von Wachstumsfaktor-Rezeptoren<br />
oder Überexpression<br />
der PI3-Kinase 2 . Die Hälfte aller Prostatakarzinom-Patienten<br />
zeigt eine Inaktivierung von<br />
PTEN; dieser Anteil ist bei Patienten mit Metastasen<br />
oder Androgen-unabhängigen Formen<br />
sogar noch höher 2 . Aktiviertes Akt unterstützt<br />
das Überleben einer Zelle sowohl durch die<br />
Inhibition pro-apoptotischer Faktoren (Bad,<br />
Caspase-9, forkhead transcription factors, p53)<br />
als auch durch Aktivierung anti-apoptotischer<br />
Faktoren (Mcl-1, XIAP, NF-κB) 6 .<br />
Der Akt-Inhibitor Triciribin (TCN) unterdrückt<br />
die Phosphorylierung und dementsprechend<br />
die Kinaseaktivität aller drei Akt-Isoformen 7 .<br />
4 | 10. Jahrgang | Nr. 5/2009 LABORWElT
© 2009 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved.<br />
Microplate Reader - wir haben die Antwort!<br />
Photometrie, Fluorometrie, Luminometrie, TRF<br />
oder FP, Spezialgerät oder Multimode – wenn es<br />
um Microplate Reader geht, haben wir immer die<br />
richtige Antwort.<br />
Egal für welchen Bedarf oder für welche Anwendung -<br />
Thermo hat das passende Gerät für Sie. Mit einer<br />
umfangreichen Zusatzausstattung bieten unsere<br />
Reader Höchstleistung ohne Kompromisse sowie die<br />
Flexibilität, die Sie heute und in der Zukunft brauchen.<br />
Für jede Anwendung und für jeden Anwender - unter<br />
www.thermo.com/readingroom finden Sie den<br />
richtigen Reader.<br />
Besuchen Sie uns auf der Biotechnica 2009<br />
vom 6. – 9. Oktober 2009 in Hannover!<br />
Halle 9 / Stand F41<br />
Moving science forward<br />
Leistungsstarke<br />
Microplate Reader<br />
für Ihre individuellen<br />
Anforderungen
Blitzlicht Apoptose-Sensitivierung<br />
Abb. 2: Sensitivierung der Tumorzelle für die TRAIL-induzierte Apoptose durch Akt-Inhibition.<br />
Die konstitutive Aktivierung von Akt in Tumorzellen führt zur Inhibition der TRAILvermittelten<br />
Apoptose und dementsprechend zur Therapieresistenz (links). Die TCNvermittelte<br />
Inhibition von Akt ermöglicht die Sensitivierung von Tumorzellen für die<br />
TRAIL-induzierte Apoptose und damit die Eliminierung des Tumors.<br />
Es konnte gezeigt werden, dass TCN anti-<br />
Tumor-Aktivität gegenüber Zellen aufweist,<br />
die konstitutiv aktives Akt besitzen 8 . TCN ist<br />
spezifisch für Akt und zeigt keine inhibitorische<br />
Wirkung auf PI3K, PDK1, PKC, SGK, PKA, Stat3,<br />
Erk-1/2 oder JNK 7 . Darüber hinaus konnte in<br />
Xenograft-Modellen gezeigt werden, dass TCN<br />
das Tumorwachstum humaner Krebszellen<br />
inhibiert, die eine anomale Expression beziehungsweise<br />
Aktivierung von Akt aufweisen.<br />
Im Gegensatz dazu wurde das Wachstum von<br />
Tumorzellen, die eine normale Expression oder<br />
Aktivität von Akt zeigen, nicht beeinflusst 8 . TCN<br />
wird auch als Akt pathway inhibitor API-2 oder<br />
trizyklisches Nukleosid bezeichnet und wurde<br />
in den frühen achtziger Jahren als Inhibitor der<br />
DNA-Synthese identifiziert. Es konnte gezeigt<br />
werden, dass TCN präklinische Aktivität gegen<br />
Leukämien und Karzinome besitzt, und TCN<br />
wurde in verschiedenen klinischen Studien der<br />
Phase I und II eingesetzt 7 . Da als zytotoxisches<br />
Therapeutikum eingesetzt, wurden in der<br />
Mehrzahl der Studien hohe Triciribin-Dosen<br />
verwendet, um eine maximale klinische Wirksamkeit<br />
zu erzielen 7 . Dementsprechend zeigte<br />
TCN zwar antitumorale Eigenschaften in einigen<br />
Patienten, hatte aber Nebenwirkungen<br />
wie Hepatotoxizität, Hypertriglyceridämie,<br />
Thrombozytopenie oder Hyperglykämie 7 . Da<br />
TCN spezifisch Akt inhibiert, ist anzunehmen,<br />
dass Tumore mit hoher Akt-Aktivität auch auf<br />
geringere Dosierungen reagieren. Deshalb wird<br />
TCN momentan wieder in zwei klinischen Stu-<br />
www.laborwelt.de<br />
dien der Phase I eingesetzt (www.clinicaltrials.<br />
gov, NCT00363454 und NCT00642031). Bei einer<br />
der beiden Studien muss vor der Behandlung<br />
der Probanden eine erhöhte Akt-Aktivität per<br />
Immunhistochemie nachgewiesen werden.<br />
Triciribin sensitiviert für die<br />
TRAIL-induzierte Apoptose<br />
Verschiedene Arbeitsgruppen konnten zeigen,<br />
dass eine Inaktivierung des PI3K/Akt-Signalweges<br />
zu einer Sensitivierung von Prostatakarzinomzellen<br />
für die TRAIL-induzierte Apoptose<br />
führt 9-11 . Dementsprechend haben wir den<br />
Effekt von TCN auf die TRAIL-induzierte Apoptose<br />
in der Prostatakarzinomzelllinie PC-3<br />
untersucht. TCN inhibiert die Akt-Phosphorylierung<br />
und -Aktivität in PC-3-Zellen 12 . Des<br />
Weiteren konnten wir demonstrieren, dass<br />
TCN die Todesrezeptor-abhängige Apoptose<br />
verstärkt. In Abbildung 1 (vgl S. 4) ist gezeigt,<br />
dass die Inhibition des Akt-Signalweges zu<br />
einer erhöhten Empfindlichkeit gegenüber<br />
TRAIL führt. Apoptose wurde zum einen durch<br />
die durchflusszytometrische Messung hypodiploider<br />
apoptotischer Zellkerne (links), zum<br />
anderen durch den Nachweis der Spaltung<br />
des Caspase-Substrats PARP per Immunoblot<br />
detektiert (rechts). In weitergehenden Experimenten<br />
konnten wir bestätigen, dass diese<br />
TCN-vermittelte Sensitivierung kritisch von<br />
der Expression und Aktivität von Akt abhängt.<br />
So hatte TCN keinen sensitivierenden Effekt in<br />
PC-3-Zellen, in denen die Akt-Expression per<br />
siRNA herunterreguliert war, oder in der Prostatakarzinomzelllinie<br />
Du145, welche kein kon-<br />
stitutiv aktiviertes Akt besitzt 12 . Offensichtlich<br />
verstärkt TCN die TRAIL-induzierte Prozessierung<br />
und die damit verbundene Aktivierung<br />
des pro-apoptotischen Proteins Bid. Gegenwärtig<br />
werden weitere Studien durchgeführt,<br />
um den exakten molekularen Mechanismus<br />
der TCN-vemittelten Sensitivierung für die<br />
TRAIL-induzierte Apoptose zu entschlüsseln.<br />
Neben TCN werden momentan weitere Akt-<br />
Inhibitoren in klinischen Studien getestet,<br />
darunter Perifosin (Keryx), GSK690693 (GSK),<br />
VQD002 (Vioquest) oder MK2206 (Merck &<br />
Co.) 13 . In Abbildung 2 ist die TCN-vermittelte<br />
Sensitivierung für die TRAIL-induzierte Apoptose<br />
schematisch zusammengefasst. Da<br />
sowohl TCN- als auch TRAIL-Derivate klinisch<br />
getestet werden, könnte die kombinierte Anwendung<br />
einen vielversprechenden therapeutischen<br />
Ansatz für die Eliminierung Hormonrefraktärer<br />
Prostatakarzinome darstellen,<br />
welche resistent gegen die konventionellen,<br />
DNA-schädigenden Chemotherapeutika oder<br />
Bestrahlung sind.<br />
Literatur<br />
[1] Lee, J.T., Lehmann, B.D., Terrian, D.M., Chappell, W.H., Stivala,<br />
F., Libra, M., Martelli, A.M., Steelman, L.S., McCubrey, J.A., Cell<br />
Cycle 7 (2008), 1745-1762.<br />
[2] Nelson, E.C., Evans, C.P., Mack, P.C., Devere-White, R.W., Lara,<br />
P.N., Jr., Prostate Cancer Prostatic Dis 10 (2007), 331-339.<br />
[3] Ashkenazi, A., Pai, R.C., Fong, S., Leung, S., Lawrence, D.A.,<br />
Marsters, S.A., Blackie, C., Chang, L., McMurtrey, A.E., Hebert,<br />
A., DeForge, L., Koumenis, I.L., Lewis, D., Harris, L., Bussiere,<br />
J., Koeppen, H., Shahrokh, Z., Schwall, R.H., J Clin Invest 104<br />
(1999), 155-162.<br />
[4] Walczak, H., Miller, R.E., Ariail, K., Gliniak, B., Griffith, T.S.,<br />
Kubin, M., Chin, W., Jones, J., Woodward, A., Le, T., Smith, C.,<br />
Smolak, P., Goodwin, R.G., Rauch, C.T., Schuh, J.C., Lynch, D.H.,<br />
Nat Med 5 (1999), 157-163.<br />
[5] Mahalingam, D., Szegezdi, E., Keane, M., Jong, S., Samali, A.,<br />
Cancer Treat Rev 35 (2009), 280-288.<br />
[6] Duronio, V., Biochem J 415 (2008), 333-344.<br />
[7] Cheng, J.Q., Lindsley, C.W., Cheng, G.Z., Yang, H., Nicosia, S.V.,<br />
Oncogene 24 (2005), 7482-7492.<br />
[8] Yang, L., Dan, H.C., Sun, M., Liu, Q., Sun, X.M., Feldman, R.I.,<br />
Hamilton, A.D., Polokoff, M., Nicosia, S.V., Herlyn, M., Sebti,<br />
S.M., Cheng, J.Q., Cancer Res 64 (2004), 4394-4399.<br />
[9] Chen, X., Thakkar, H., Tyan, F., Gim, S., Robinson, H., Lee, C.,<br />
Pandey, S.K., Nwokorie, C., Onwudiwe, N., Srivastava, R.K.,<br />
Oncogene 20 (2001), 6073-6083.<br />
[10] DeFeo-Jones, D., Barnett, S.F., Fu, S., Hancock, P.J., Haskell, K.M.,<br />
Leander, K.R., McAvoy, E., Robinson, R.G., Duggan, M.E., Lindsley,<br />
C.W., Zhao, Z., Huber, H.E., Jones, R.E., Mol Cancer Ther 4<br />
(2005), 271-279.<br />
[11] Whang, Y.E., Yuan, X.J., Liu, Y., Majumder, S., Lewis, T.D., Vitam<br />
Horm 67 (2004), 409-426.<br />
[12] Dieterle, A., Orth, R., Daubrawa, M., Grotemeier, A., Alers, S.,<br />
Ullrich, S., Lammers, R., Wesselborg, S., Stork, B., Int J Cancer<br />
125 (2009), 932-941.<br />
[13] Engelman, J.A., Nat Rev Cancer 9 (2009), 550-562.<br />
Korrespondenzadresse<br />
Prof. Dr. Sebastian Wesselborg<br />
Innere Medizin I<br />
Medizinische Klinik<br />
Universitätsklinikum Tübingen<br />
Otfried-Müller-Str. 10<br />
72076 Tübingen<br />
Tel.: +49-(0)7071-29-84113<br />
Fax: +49-(0)7071-29-5865<br />
sebastian.wesselborg@uni-tuebingen.de<br />
6 | 10. Jahrgang | Nr. 5/2009 LABORWElT
Für höchste Effizienz muss man nicht groß sein<br />
Für höchste Effizienz muss man nicht groß sein<br />
QuickGene-Mini 80: Zuverlässige Nukleinsäure-Aufreinigung –<br />
QuickGene-Mini unerlässlich für die 80: Zuverlässige Präzision in der Nukleinsäure-Aufreinigung molekularen Diagnostik–<br />
unerlässlich für die Präzision in der molekularen Diagnostik<br />
Besuchen Sie uns!<br />
6. Besuchen Jahrestagung Sie uns! DGKL<br />
6. 7.-10.10.09 Jahrestagung iN LEiPZiG DGKL<br />
7.-10.10.09 im Foyer, iN Stand LEiPZiG 39<br />
im Foyer, Stand 39<br />
www.fujifilm.de/quickgene<br />
www.fujifilm.de/quickgene<br />
QuickGene-Mini80 CE IVD<br />
QuickGene-Mini80 CE IVD<br />
Klein: 28 x18 cm und 3 kg leicht<br />
Schnell: Klein: 28 gDNA x18 cm aus und Vollblut 3 kg in leicht 6 min<br />
Schnell: Effizient: gDNA bis zu aus 8 Proben Vollblut gleichzeitig in 6 min<br />
Effizient: Zuverlässig: bis zu hohe 8 Proben Ausbeute, gleichzeitig<br />
Zuverlässig: hervorragende hohe Reinheit Ausbeute,<br />
hervorragende Einfach: Aufreinigung Reinheit<br />
Einfach: ohne Zentrifugation Aufreinigung<br />
ohne Günstig: Zentrifugation Dieser Preis kann<br />
Günstig: sich sehen Dieser lassen Preis kann<br />
sich sehen lassen
Blitzlicht Genomforschung<br />
Erworbene Veränderungen<br />
der Kopienzahl in AML-<br />
Genomen<br />
Dr. Burkhard Ziebolz, Roche Applied Science GmbH, Penzberg<br />
Zytogenetische Analysen der Akuten Myeloischen Leukämie (AML) haben die Identifikation von<br />
Genen beschleunigt, die mit der AML-Pathogenese verknüpft sind. Um die von der Auflösung her<br />
limitierten zytogenetischen Studien zu komplementieren und zusätzliche bei AML veränderte<br />
Gene aufzuspüren, wurde eine genomweite Kopienzahl-Analyse durchgeführt. Es wurde dazu<br />
paarweise an verschiedenen Stellen entnommene normale sowieTumor-DNA eingesetzt,die von 86<br />
erwachsenen Patienten mit de novo-AML stammten,und mit SNP-Arrays mit 1,85 Millionen Features<br />
untersucht 1 .Die erworbenenen Änderungen der Kopienzahl (engl.Copy number alterations,CNAs),<br />
dieaufüblichenPlattformenmit einerhohenRatefalsch-positiverErgebnissebehaftet sind,wurden<br />
mittels einer ultradichten, Array-gestützten komparativen Genom-Hybridierungs-(CGH)Plattform<br />
validiert (Roche/NimbleGen CGH 12x135K-Array, Roche Applied Science, Penzberg).<br />
Es fanden sich insgesamt 201 somatische CNAs<br />
in den 86 AML-Genomen (Median: 2,34 CNAs<br />
pro Genom), wobei die nach Französisch-amerikanisch-britischem<br />
(FAB) System klassifizierten<br />
M6- und M7-Genome die meisten Veränderungen<br />
enthielten (10-29 CNAs per Genom). 24% der<br />
AML-Patienten mit normaler Zytogenetik – also<br />
ohne jede Chromosomenaberration – zeigten<br />
CNAs. Zusätzlich wiesen 40% der Patienten mit<br />
anomalem Karyotyp CNAs auf, wie SNP-Analysen<br />
ergaben – davon einige in wiederkehrenden<br />
CNA-Regionen. In 27 der 50 wiederauftretenden<br />
Regionen unter 50 Mb Größe waren die exprimierten<br />
mRNA-Mengen signifikant verändert.<br />
In den 86 Genomen wurden zudem acht DNA-<br />
Abschnitte identifiziert, bei denen beide Kopien<br />
von einem Elternteil stammten (uniparentale<br />
Disomie, UPD); sechs dieser UPDs traten in<br />
Proben mit normalem Karyotyp auf. Zusammengenommen<br />
enthielten 34 der 86 untersuchten<br />
AML-Genome (40%) Veränderungen, die mittels<br />
zytogenetischer Analyse nicht erfasst worden<br />
waren, davon enthielten 98% Gene. Von den<br />
86 Genomen zeigten bei dieser Auflösung 43<br />
Abb. 1: Roche/NimbleGens Array-CGH, der zur Validierung der ansonsten oft falsch-positiv<br />
ermittelten kleinen CNAs in AML-Patientenmaterial eingesetzt wurde<br />
(entsprechend 50%) keine CNAs oder UPDs. Mit<br />
Hilfe des hier vorgestellten wertungsneutralen<br />
hochaufgelösten Genom-Screenings konnten<br />
zahlreiche Gene identifiziert werden, die zuvor<br />
nicht mit AML in Zusammenhang gebracht<br />
wurden, die aber – im Zusammenspiel mit<br />
bereits bekannten Onkogenen und Tumorsuppressorgenen<br />
– möglicherweise relevant für die<br />
Krankheitsentstehung sind.<br />
Akute myeloische Leukämie<br />
Die akute myeloische Leukämie (AML) ist eine<br />
heterogene Gruppe von Krankheiten, die derzeit<br />
anhand von Anomalien der Knochenmark-<br />
Morphologie, des Karyotyps, erworbener Mutationen<br />
und Veränderungen der Genexpression<br />
klassifiziert werden 1-3 . Obgleich die Identifikation<br />
spezifischer Genmutationen verbesserte Behandlungsergebnisse<br />
für einige AML-Patienten 4<br />
erbracht hat, existiert eine enorme klinische<br />
Heterogenität, die möglicherweise die Anwesenheit<br />
bislang unerkannter, initiierender und zusammenwirkender<br />
Mutationen widerspiegelt.<br />
Die Entdeckung somatischer Mutationen im<br />
Erbgut von AML-Patienten mit normalem und<br />
anomalen Karyotyp verspricht daher, das Verständnis<br />
der AML zugrundeliegenden Genetik<br />
voranzubringen und kann zu einer verbesserten<br />
Patientenklassifikation und Therapie beitragen.<br />
Die Entdeckung zuvor uncharakterisierter<br />
mutierter Gene durch Kopienzahl-Analyse mittels<br />
SNP-Arrays wurde unlängst für die Akute<br />
Lymphoblastische Leukämie (ALL) beschrieben 5 .<br />
Mit den eingesetzten SNP-Array-Plattformen lassen<br />
sich in Krebszellen Genomamplifikationen,<br />
Deletionen und der SNP-bedingte Verlust der<br />
Heterozygotie (loss of heterozygosity, LOH) detektieren<br />
sowie Regionen uniparentaler Disomie<br />
(UPD), also Kopienzahl-neutrale LOH-Ereignisse.<br />
Anfängliche Studien mit SNP-Arrays und Chipgestützter<br />
komparativer Genom-Hybridisierung<br />
(CGH) legten nahe, dass sowohl Änderungen<br />
der Kopienzahl als auch der UPD verbreitet in<br />
AML-Genomen auftreten 6-12 . Allerdings wurden<br />
in diesen Studien niedrig-auflösende Arrays<br />
eingesetzt, oft stammte die Referenz-DNA nicht<br />
von normalen Zellen desselben Patienten, und<br />
die Änderungen der Kopienzahl wurde nicht<br />
mit einer unabhängigen Plattform validiert.<br />
Dies limitiert die Unterscheidung zwischen<br />
erworbenen (somatischen) CNAs und erblichen<br />
Kopienzahl-Variationen (CNVs), die in allen<br />
Individuen auftreten. Des weiteren werden<br />
zusätzliche Validierungsverfahren benötigt, um<br />
zwischen tatsächlichen Ereignissen und falschpositiven<br />
Signalen zu unterscheiden, welche<br />
extrem häufig bei Verwendung der verbreiteten<br />
Plattformen auftreten. Um diese Limitationen<br />
zu überwinden und Gene sicher zu identifizieren,<br />
die in AML-Genomen somatisch verändert<br />
sind, wurde die Genome-weite Human-SNP-<br />
Array-Plattform 6.0 (Affymetrix) eingesetzt, um<br />
paarweise entnommene Tumor-DNA- sowie<br />
normale DNA-Proben von 86 erwachsenen de<br />
8 | 10. Jahrgang | Nr. 5/2009 LABORWElT
novo-AML-Patienten zu screenen. Ein zur Validierung<br />
eingesetzter hochdicht gespotteter,<br />
maßgeschneiderter Roche/NimbleGen CGH<br />
12x135K-Array (medianer Sondenabstand 245<br />
Bp) (vgl. Abb. 1) ermöglichte es, die ansonsten<br />
hohe Rate an Falsch-positiven signifikant zu<br />
vermindern.<br />
Es wurden im Mittel 2,34 CNAs pro Genom<br />
identifiziert, von denen 76% ein bekanntes<br />
Krebsgen betrafen. Insgesamt 50 wiederholt<br />
auftretende CNAs unter 50Mb konnten in den<br />
86 Genomen aufgespürt werden, und 32 davon<br />
enthielten Gene, die zuvor nicht in Zusammenhang<br />
mit AML gebracht wurden. UPDs waren<br />
eher in Proben mit normalem Karyotyp anzutreffen.<br />
Die Hälfte der im Rahmen der Studie<br />
getesteten AML-Genome wiesen weder CNAs<br />
noch UPDs auf – ein Hinweis darauf, dass möglicherweise<br />
andere Methoden, wie etwa schnelle<br />
Genomsequenzierungs-Verfahren, eingesetzt<br />
werden müssen, um die verbleibenden genetischen<br />
Veränderungen zu entdecken, die an der<br />
AML-Pathogenese beteiligt sind.<br />
Patientenkollektiv<br />
86 erwachsene Patienten mit de novo-AML,<br />
für die ausreichend DNA-Proben aus der Haut<br />
(gesund) oder zwei voneinander unabhängigen<br />
Punktionen an verschiedenen Stellen des<br />
Knochenmarks (Tumor) vorlagen, wurden für<br />
die Studie ausgewählt. Die „paarweisen“ Proben<br />
gestatten es, erworbene CNAs von erblichen<br />
CNVs zu unterscheiden. Die Fälle wurden nach<br />
Diagnose und Knochenmark-Banking gemäß<br />
FAB-System klassifiziert. Die Patienten hatten<br />
unterschiedlich ausgeprägte zytogenetische<br />
Veränderungen (FAB-Klassen M0-M7), und<br />
zeigten im Mittel 64% unreife Myeloblasten<br />
(Spanne: von 30% bis 100%), jene Unterklasse<br />
von Leukozyten, deren Reifungsstörung der AML<br />
zugrunde liegt.<br />
Erworbene CNAs<br />
Mittels SNP-Arrays wurden 201 erworbene<br />
Änderungen der Kopienzahl (CNAs) in 38 der 86<br />
AML-Genome gefunden, die jedes Chromosom<br />
mindestens einmal, und Bereiche zwischen 35<br />
Kb (34 Sonden) und 250 Mb (146.524 Sonden)<br />
betrafen. Im Mittel traten 2,34 CNAs pro AML-<br />
Genom auf (Spanne 0-30), wobei Deletionen<br />
häufiger waren als Amplifikationen Die 201<br />
CNAs umfassten alle FAB-Sybtypen, allerdings<br />
zeigten M6- und M7-Subtypen signifikant mehr<br />
CNAs pro Genom als alle anderen Klassen.<br />
Von den 201 CNAs korrespondierten 125<br />
(62%) mit Änderungen, die bereits zytogenetisch<br />
detektiert worden waren, 76 (38%) wurden<br />
ausschließlich mit SNP-Arrays detektiert.<br />
Davon waren 32 größer als 1 Mb. 26 davon<br />
wurden mittels des unabhängigen Custom-<br />
NimbleGen-CGH 12x135K-Arrays (Roche NimbleGen)<br />
validiert. Zwei der 32 CNAs mit einer<br />
Größe von 1 Mb traten an einer bekannten<br />
Translokationsbruchstelle auf.<br />
198 der 201 analysierten Loci enthielten<br />
bekannte Gene, 154 zumindest ein Gen, das<br />
zuvor in Zusammenhang mit Krebs oder AML<br />
bzw. Störungen der Myeloztendifferenzierung<br />
(„Myelodysplasien“, MDS) gebracht wurden 13 .<br />
38% der CNAs mit einer Größe an der Nachweisgrenze<br />
zytogenetischer Untersuchungen<br />
(5Mb) enthielten mindestens ein Krebs- oder<br />
AML/MDS-assoziiertes Gen – deutlich mehr<br />
als erwartet. Im Gegensatz zu akkumulierten<br />
Krebs-, AML/MDS- und annotierten Genen<br />
war in CNAs einer Größe von 1 bzw. 5 MB keinerlei<br />
Anreicherung von microRNA-Genen zu<br />
beobachten.<br />
Insgesamt wurden mit Hilfe des GISTIC-<br />
Algorithmus 14 in den 201 CNAs 12 chromosomale<br />
Regionen identifiziert, die in mehreren<br />
AML-Genomen signifikant verändert waren.<br />
Dabei zeigten sich acht Deletionen von Genen,<br />
die mit Krebs und/oder AML/MDS assoziert<br />
sind (3p14.1: FHIT, 5q31.1: CTNNA1, 12p12.3: ETV6,<br />
16q22.1: CBFB, 17p13.1: TP53, 17q11.2: NF1) sowie<br />
vier Amplifikationen (8q23.2: MYC, 11q23.3: MLL<br />
und 21q22.2: ETS2), die alle eine entsprechend<br />
der Gen-Dosis veränderte Expression zeigten.<br />
In fünf Patienten fanden sich zwei veränderte<br />
Regionen (17q11.2 und 21q22.2), die mit einer<br />
Verschlechterung des Gesamtüberlebens<br />
assoziiert waren.<br />
Zusätzlich wurden 32 wiederholt auftretende<br />
CNA-Regionen identifiziert (19 Deletionen und<br />
13 Amplifikationen). Von diesen enthielten<br />
sechs Gene, die zuvor nicht in Zusammenhang<br />
mit Krebs oder AML/MDS gebracht wurden. Bei<br />
43 der in 15 der 32 CNA-Regionen identifizierten<br />
Genen zeigte sich gegenüber nicht veränderten<br />
Zellen eine signifikante Änderung der mRNA-<br />
Expression, deren Beteiligung an der AML-<br />
Pathogenese nun geklärt werden kann.<br />
Eine Klassifikation in vorteilhafte, neutrale<br />
und nachteilige zytogenetische Kategorien<br />
nach CALGB 1 ermöglichte erwartungsgemäß<br />
eine Prognose hinsichtlich des Gesamt- und<br />
progressionsfreien Überlebens. In Patienten<br />
mit normaler Cytogenetik ermöglichte die<br />
Gesamtzahl an CNAs dagegen keine entsprechende<br />
Aussage.<br />
Identifikation von Translokationen<br />
und Genmutationen<br />
Blitzlicht Genomforschung<br />
Besuchen Sie uns auf der<br />
Halle 009 / Stand C59<br />
www.laborwelt.de<br />
Es wurden 23 zytogenetisch definierte balancierte<br />
Rearrangements identifiziert, die in einem<br />
Viertel der Metaphasechromosomen von 22<br />
Patienten mit nicht-komplexen Karyotypen<br />
auftraten. Mit Hilfe der SNP-Arrays wurden<br />
die CNA-Regionen identifiziert, die an den<br />
Bruchstellen der Rearrangements liegen. Diese<br />
(t(15;17) (q22;q21), und eine mit inv(16) (p13q22)<br />
Microsynth AG<br />
LABORWElT Schützenstr. 15 J CH-9436 10. Jahrgang Balgach | Nr. 5/2009 | 9<br />
Tel. +41 71 722 83 33 J www.microsynth.ch
Blitzlicht Genomforschung<br />
+CNA<br />
+UPD<br />
10% (8)<br />
Normaler Karyotyp Anomaler Karyotyp<br />
+CNA<br />
+UPD<br />
1% (1) -CNA<br />
+UPD<br />
5% (4)<br />
-CNA<br />
-UPD<br />
27% (23)<br />
-CNA +CNA<br />
+UPD +UPD<br />
1% (1) 1% (1)<br />
deuten darauf hin, dass die Rearrangements<br />
im Gegensatz zu zytogenetischen Befunden<br />
nicht balanciert zu sein scheinen. Zudem wurde<br />
ein Deletionsendpunkt identifiziert, der sich an<br />
einer verbreiteten Translokations-Bruchstelle<br />
im NUP98-Gen auf Chromosom 11p15 befand,<br />
obgleich bei dem betroffenen Patienten keine<br />
zytogenetischen Translokationen gefunden<br />
worden waren. Kryptische Translokationen des<br />
NUP98- und NSD1-Gens (5q35.3) wurden bereits<br />
zuvor für AML beschrieben, diese können bei<br />
zytogenetischen Untersuchungen übersehen<br />
werden 16-17 . Daher screenten wir in der Probe<br />
nach solchen Translokationen und fanden mittels<br />
RT-PCR ein NUP98-NSD1-Fusionstranskript<br />
der Exons 12 bzw. 6, aber nicht sein reziprokes<br />
Gegenstück. Beim Screening zusätzlicher 179<br />
AML-Proben fanden sich zwei weitere Proben<br />
mit kryptischen Fusionstrans kripten.<br />
Wiederauftretende CNA-Region in ALL-Genomen<br />
enthalten oft mutierte Gene, die auch<br />
in Proben ohne Veränderungen der Kopienzahl<br />
verändert sind. Um zu überprüfen, ob dieses<br />
Phänomen auch bei AML auftritt, wurde eine<br />
fokale CNA auf Chromosom 12p12.3 untersucht,<br />
die in drei AML-Patienten auftrat. Dieser Chromosomenbereich<br />
enthält das ETV6-Gen, das<br />
in AML-Patietenen oft mutiert und transloziert<br />
vorliegt 19-20 . Tatsächlich enthielten drei von 180<br />
Proben nicht-synonyme SNP-Varianten des<br />
Gens (P4A, R105Q, and R202Q) in Abwesenheit<br />
einer CNA. Die Analyse gesunder Haut-DNA,<br />
für die allerdings nur Probenmaterial eines<br />
Patienten zur Verfügung stand, bestätigte, dass<br />
R105Q eine erworbene, zuvor nicht beschriebene<br />
Mutation ist.<br />
+CNA<br />
-UPD<br />
22% (19)<br />
-CNA<br />
-UPD<br />
23% (20)<br />
Partielle uniparentale Disomie<br />
+CNA<br />
-UPD<br />
10% (9)<br />
Abb. 2: Genetische Veränderungen in AML-Genomen. Die Grafik (aus [1]) zeigt den relativen<br />
Anteil von AML-Proben mit anomalem (rot, n=20) und normalem (weiß, n=36) Karyotyp<br />
mit (+) sowie ohne (–) CNAs und UPDs, Details siehe Text.<br />
Mit Hilfe unabhängig voneinander, an unterschiedlichen<br />
Stellen vom selben Patienten<br />
entnommener (paarweiser) normaler und<br />
Tumor-DNA konnten in Tumor-Proben mit<br />
SNP-LOH (loss of heterogosity – eine Allel-<br />
Imbalance, die auf den Verlust eines der Allele<br />
oder die erhöhte Kopienzahl eines der Allele<br />
zurückgeht) identifiziert werden. Ein LOH in<br />
Abwesenheit einer CNA entspricht dabei einer<br />
UPD. Es wurden in sieben der untersuchten<br />
86 Proben acht UPD-Regionen identifiziert.<br />
Diese traten gehäuft in zytogenetisch normalen<br />
AML-Genomen auf (15% vs. 3.8%). Alle<br />
UPD-Regionen dehnten sich bis zum Ende des<br />
betroffenen Genoms aus und variierten in der<br />
Größe (11-95 Mb).<br />
Fazit<br />
Zusammengenommen zeigen die ermittelten<br />
Ergebnisse, dass AML-Genome – zumindest<br />
bei der hier erzielten Auflösung von 35K – nicht<br />
inherent instabil zu sein scheinen. Auch zeigte<br />
sich eine bemerkenswerte Heterogenität der<br />
in jedem AML-Genom mutierten Gene, wobei<br />
in dieser Studie nicht die für die Pathogenese<br />
ebenfalls potentiell relevante DNA-Methylierung<br />
erfasst wurde. Da sich in den meisten<br />
der untersuchten AML-Genome nur eine<br />
geringe Zahl erworbener CNAs zeigte, steht<br />
zu vermuten, dass mutierte Gene in diesen<br />
Regionen eine wichtige Rolle bei der AML-<br />
Pathogenese spielen. Die in sehr kleinen CNAs<br />
auftretenden Gene wie etwa STAG2, PRMT2,<br />
USP10 oder C8orf4 eignen sich hervorragend,<br />
um diese Arbeitshypothese zu überprüfen.<br />
Denn bisher wurde keines dieser mittels des<br />
hier vorgestellten Genom-weiten hochaufgelösten<br />
Genom-Screening identifizierten Gene<br />
mit der AML-Pathogenese in Zusammenhang<br />
gebracht. AML-Genome die in Folgestudien<br />
mit der hier präsentierten Identifizierungs/<br />
Validierungsstrategie untersucht werden,<br />
dürften zur Etablierung eines umfassenden<br />
Kataloges von Genkandidaten führen, die potentiell<br />
zur AML-Pathogenese beitragen.<br />
Obgleich in der vorliegenden Studie zahlreiche<br />
in anderen Studien 6, 8, 10-12 entdeckte große<br />
CNA-Regionen bestätigt werden konnten,<br />
gibt es auch zahlreiche Diskrepanzen, die<br />
sich im Wesentlichen auf drei grundlegende<br />
Unterschiede im experimentellen Design<br />
zurückführen lassen. Erstens, der eingesetzte<br />
SNP-Array hat eine vier- bis zehnfach höhere<br />
Auflösung als die in früheren Studien eingesetzten<br />
Plattformen. Es wurden durchgehend<br />
paarweise Tumor- und Kontrollproben desselben<br />
Patienten eingesetzt. Drittens: Alle identifizierten<br />
kleinen CNAs, die naturgemäß eine<br />
außerordentlich hohe Rate an Falsch-positiven<br />
aufweisen, wurden mit einer unabhängigen,<br />
orthogonalen Plattform (RocheNimbleGen)<br />
validiert. Dies erlaubte es eindeutig die erworbenen<br />
somatischen CNA und UPD-Regionen<br />
in AML-Genomen von erblichen CMVs zu unterscheiden,<br />
was zuvor ohne Validierung und<br />
Einsatz paarweiser Proben nicht möglich war.<br />
CNAs und UPD sind danach – im Gegensatz<br />
zu früher publizierten Ergebnissen – bei der<br />
AML nicht so häufig wie bei ALL, ein starkes<br />
Argument, noch höherauflösende genomische<br />
Studien durchzuführen, um die an der<br />
AML-Pathogenese beteiligten Genmutationen<br />
systematisch zu katalogisieren und funktionell<br />
zu charakterisieren. Dafür empfiehlt sich<br />
eine Kombination existierender Plattformen<br />
wie die traditionelle Zytogenetik mit FISH,<br />
SNP-Arrays, Array-CGH und gezielten Next-<br />
Generation-Sequencing-Verfahren.<br />
Literatur<br />
[1] Walter MJ, Payton JE, Ries RE, Shannon WD, Deshmukh H,<br />
Zhao Y, Baty J, Heath S, Westervelt P, Watson MA, Tomasson<br />
MH, Nagarajan R, O‘Gara BP, Bloomfield CD, Mrózek K, Selzer<br />
RR, Richmond TA, Kitzman J, Geoghegan J, Eis PS, Maupin R,<br />
Fulton RS, McLellan M, Wilson RK, Mardis ER, Link DC, Graubert<br />
TA, DiPersio JF, Ley TJ. Proc Natl Acad Sci U S A. 2009 Aug<br />
4;106(31):12950-5<br />
Eine umfassende Literaturliste kann beim Autor angefordert werden<br />
Korrespondenzadresse<br />
Dr. Burkhard Ziebolz<br />
Roche Applied Science<br />
82377 Penzberg<br />
burkhard.ziebolz@roche.com<br />
10 | 10. Jahrgang | Nr. 5/2009 LABORWElT
P.O.S. KRESIN DESIGN GmbH · P0908-014<br />
20 Years<br />
Thermocyclers<br />
Setting Standards<br />
www.biometra.com<br />
+49 551 50686-0 · info@biometra.com<br />
Top performance for highest demands.<br />
Consistent and permanent further enhancements of<br />
hard- and software and a practical and tailored to the<br />
market needs portfolio make biometra Thermocyclers to<br />
a success story and an essential laboratory equipment.<br />
Innovation · Advancement · Development<br />
Quality Products Made in Germany<br />
Purchase of a Biometra Thermocycler conveys a limited non-transferable immunity from suit for the purchaser’s own internal research and development and applied fi elds other than human in vitro diagnostics under one or more of US<br />
Patents Nos. 5,038,852, 5,656,493, 5,333,675, 5,475,610, and 6,703,236, or corresponding claims in their non-US counterparts, owned by Applera Corporation. No right is conveyed expressly, by implication or by estoppel under any<br />
patent claim, reagents, kits, or methods such as 5´ nuclease methods, or under any other apparatus or system claim, including but not limited to US Patent No. 6,814,934 and its non-US counterparts, which describe and claim thermal<br />
cyclers capable of realtime detection. Further information on purchasing licenses may be obtained by contacting the Director of Licensing, Applied Biosystems, 850 Lincoln Centre Drive,Foster City, California 94404, USA.
Wissenschaft RNA-Interferenz<br />
MicroRNAs: Hauptakteure<br />
in der Metastasierung<br />
Raffaele Baffa MD 1,5 , Matteo Fassan MD 2 , Anne Rosenberg MD 3 , Carlo M. Croce MD 4 , 1 Thomas Jefferson<br />
University, Kimmel Cancer Center, Philadelphia, 2 University of Padova, 3 Thomas Jefferson<br />
University, Kimmel Cancer Center, Philadelphia, PA, 4 Comprehensive Cancer Center, Ohio State<br />
University, Columbus OH. 5 aktuelle Anschrift: Medimmune, Gaithersburg, MD.<br />
Metastasierender Krebs ist das Ergebnis einer Reihe komplexer Prozesse, die zahlreiche Veränderungen<br />
auf molekularer Ebene umfassen.Die Entdeckung nicht-codierender microRNAs (miRNAs),<br />
die die Genexpression durch mRNA-Abbau oder Translationshemmung modulieren, hat das<br />
Verständnis dieser Komplexität ein gutes Stück vorangebracht. Verschiedenen Studien zufolge<br />
können miRNAs als Tumorsuppressoren und auch als Onkogene wirken,und ihr Nachweis könnte<br />
von diagnostischer und prognostischer Relevanz sein.Die Ergebnisse aktueller in vitro- und Expressionsprofilierungsstudien<br />
zeigen, dass spezifische miRNAs direkt an der Metastasierung beteiligt<br />
sind und sowohl als Diagnose-Werkzeug zur Charakterisierung metastasierenderTumore als auch<br />
als Biomarker für das Therapiemonitoring geeignet erscheinen. Daneben könnten sie künftig als<br />
neuartige und gezielte Arzneimittel eingesetzt werden.<br />
Trotz jahrelanger Anstrengungen, Biomarker<br />
für Krebs beim Menschen zu identifizieren, hat<br />
kein Biomarker solch ein Aufsehen erregt wie<br />
die microRNAs. microRNAs (oder miRNAs) sind<br />
eine Familie endogener, 19 bis 25 Nucleotide<br />
kleiner, nicht-codierender RNA-Genprodukte,<br />
die die Genexpression modulieren, indem sie<br />
gezielt an mRNA binden 1,2 . Im Menschen ist<br />
miRNA-Aberration ein Kennzeichen von Krankheit,<br />
auch für Krebs. Tatsächlich werden miRNAs<br />
gewebespezifisch exprimiert, und Änderungen<br />
der miRNA-Expression in einem Gewebe kann<br />
mit Krankheitszuständen korreliert werden.<br />
Die in der Evolution konservierten miRNAs<br />
sind an grundlegenden biologischen Vorgängen<br />
beteiligt, unter anderem dem Zellzyklus, der<br />
Differenzierung, Entwicklung, dem Stoffwechsel<br />
und der Alterung 1,2 . Das menschliche Genom<br />
enthält schätzungsweise 1.000 miRNA-Gene,<br />
von denen angenommen wird, dass sie ein<br />
Drittel aller Gene regulieren 1,2 . Oft befinden sich<br />
miRNA-Gene in mit Krebs assoziierten genomischen<br />
Regionen, wie etwa Minimal regions<br />
of amplification (MAR), Loss of heterozygosity<br />
(LOH), fragilen Stellen und üblichen Bruchstell-<br />
Regionen in oder in der Nähe von Onkogenen<br />
oder Tumorsuppressorgenen 3 .<br />
MiRNAs werden zunächst von der RNA-Polymerase<br />
II als lange, primäre Transkripte synthetisiert,<br />
die nachfolgend mit Caps versehen und<br />
polyadenlyliert werden. Diese Transkripte werden<br />
von der Drosha RNase III-Endonuclease in<br />
ca. 70 Nucleotide lange Haarnadel-prä-miRNAs<br />
prozessiert und durch Ran-GTP/Exportin aus<br />
dem Zellkern transportiert 5 . Prä-miRNAs werden<br />
im Zytoplasma von Dicer weiterbearbeitet, bis<br />
ein 19 bis 25 Nucleotide langer Doppelstrang entstanden<br />
ist. Ein Strang davon wird in den RNAinduced<br />
silencing complex (RISC) aufgenommen<br />
und verwendet, um die Expression von Zielgenen<br />
zu regulieren. Die Bindung von miRNAs an die<br />
3’-untranslatierte Region (UTR) der mRNA mit<br />
perfekter oder fast-perfekter Sequenzkomplementarität<br />
induziert den mRNA-Abbau. Dagegen<br />
führt eine nicht-perfekte Komplementarität<br />
oft zur Translationshemmung. Der aus sieben<br />
Tab. 1: Repräsentative miRNAs, die in metastatischem Krebs abberrant exprimiert werden,<br />
und ihre bedeutendsten putativen Gene<br />
miRNA Locus Expression in Metastasen Targetgene Referenzen<br />
miR-10b 2q31.1 Hochreguliert HOXD10 [4, 14]<br />
miR-21 17q23.1 Hochreguliert<br />
PDCD4, PTEN, RECK,<br />
TPM1, MASPIN<br />
miR-373 19q13.41 Hochreguliert CD44 [12]<br />
miR-520c 19q13.41 Hochreguliert CD44 [12]<br />
miR-520c 19q13.41 Hochreguliert CD44 [12]<br />
miR-34c 11q23.1 Herunterreguliert E2F3 [13]<br />
miR-148a 7p15.2 Herunterreguliert TGIF2 [13]<br />
miR-200 family 1p36.33 12p13.31 Herunterreguliert ZEB1, SIP1 [11]<br />
miR-205 1q32.2 Herunterreguliert ZEB1, SIP1 [11]<br />
miR-335 7q32.2 Herunterreguliert SOX4, TNC [10]<br />
bis acht Nucleotiden bestehende Seed-Strang<br />
von miRNAs am 5’-Ende ist entscheidend für<br />
die wirksame Zielsteuerung, und miRNAs mit<br />
ähnlicher Seed-Sequenz können – zumindest<br />
theoretisch – die Expression einer ähnlichen<br />
Untergruppe von Genen regulieren 1-3 .<br />
In in vitro-Studien konnte gezeigt werden,<br />
dass eine aberrante Expression von miRNAs zur<br />
Karzinogenese beiträgt, indem die Expression<br />
von Proto-Onkogenen angekurbelt und jene<br />
von Tumorsuppressorgenen gehemmt wird.<br />
Die Deregulierung solcher “Oncomirs” ist bei<br />
verschiedensten Krebserkrankungen beobachtet<br />
worden, und die miRNA-Expression wurde<br />
mit molekularbiologischen Charakteristika<br />
korreliert, was belegt, dass miRNA-Signaturen<br />
dazu dienen können, die biologischen und klinischen<br />
Eigenschaften von Krebs zu beschreiben 1-3 .<br />
Zudem zeigte sich in vivo auch ein Zusammenhang<br />
zwischen der miRNA-Expression und der<br />
Entstehung experimenteller Tumore 1-3 . Obgleich<br />
miRNAs aber eine klare Rolle bei der Onkogenese<br />
spielen, ist der Beitrag, den miRNAs zur<br />
bösartigen Entartung humaner Tumore leisten,<br />
erst unlängst untersucht und charakterisiert<br />
worden 4-14 .<br />
miRNAs und Metastasierung<br />
Metastasierender Krebs ist die Haupttodesursache<br />
bei Patienten mit soliden Tumoren. Die<br />
Ausprägung des metastatischen Phänotyps ist<br />
ein multifaktorieller Prozess und das Ergebnis<br />
der unerklärten Wechselwirkung molekularer<br />
Faktoren wie dem epigenetischen Silencing,<br />
von Transkriptionsfaktoren, Signalwegen und<br />
Wachstumsfaktoren. Bislang wurde die Rolle<br />
des metastatischen Ausstreuens falsch eingeschätzt.<br />
Tatsächlich sind bereits kleine Tumore in<br />
frühem Stadium in der Lage, Mikrometastasen<br />
zu bilden, die sich über den ganzen Körper ausbreiten<br />
können, aber selten zu soliden, klinisch<br />
relevanten Sekundärtumoren führen.<br />
Während der vergangenen Jahrzehnte wurden<br />
molekulargenetische Studien durchgeführt,<br />
um Gene und Genprodukte zu untersuchen, die<br />
den Metastasierungsprozess antreiben. Gleichwohl<br />
ist der prognostische und diagnostische<br />
Wert dieser Genveränderungen angesichts der<br />
Heterogenität des Metastasierungsprozesses<br />
und der fokalen Natur der Veränderung von<br />
Onkogenen und Tumorsuppressorgenen bislang<br />
begrenzt. In jüngerer Zeit häuft sich die Zahl<br />
der Berichte, die miRNAs eine wichtige Rolle als<br />
Promotoren und Suppressoren der Krebsprogression<br />
und der Metastasierung zusprechen<br />
(vgl. Tabelle). Dies ist nicht nur beachtenswert,<br />
weil sie ein neues Untersuchungsfeld eröffnen,<br />
sondern auch weil mit ihnen neue Pathways<br />
offengelegt wurden, die in die Metastasierung<br />
involviert sind.<br />
Der erste dazu von Ma et al. veröffentlichte<br />
Bericht 4 beschrieb die unterstützende Rolle<br />
von miR-10b bei der Invasion und Metastasierung<br />
von Brustkrebs. Während miR-10b in<br />
12 | 10. Jahrgang | Nr. 5/2009 LABORWElT<br />
[6-9, 14]
den meisten Fällen von Brustkrebs gegenüber normalem Brustgewebe<br />
herunterreguliert war, wurde die microRNA in rund 50% aller Fälle von<br />
metastasierendem Brustkrebs überexprimiert. In vitro hatte die ektopische<br />
Expression von miR-10b keinen Effekt auf die Zellproliferation, vergrößerte<br />
aber die Fähigkeit zur Migration und Invasivität. Darüber hinaus zeigten<br />
in vivo-Studien, dass miR-10b-überexprimierende Tumore sich invasiv<br />
verhielten und eine hochgradige Vaskularisierung zeigten. Das hochregulierte<br />
miR-10b hemmt den Translationsprozess der mRNA, die das<br />
Homöobox-D10-Protein (HOXD10) codiert, was zur verstärkten Expression<br />
des wohlbekannten und gut charakterisierten pro-metastatischen<br />
Gens RHOC führt. Weiter gestützt wurden diese Daten dadurch, dass die<br />
HOXD10-Expression in Brusttumoren zunehmender Malignizität immer<br />
mehr verschwindet. Allerdings konnte die Assoziation von miR-10b mit der<br />
Brustkrebs-Metastasierung in einer großen Zahl von Fällen von Brustkrebs<br />
im Frühstadium nicht bestätigt werden 5 .<br />
Deregulierung der miRNA-Expression<br />
Der intiale Befund der Deregulation der miRNA-Expression bei metastasierendem<br />
Krebs konnte auch in weiteren Fällen demonstriert werden. Zum<br />
Beispiel zeigte sich, dass die weitverbreitete, bei Krebs überexprimierte<br />
miRNA miR-21 am Erwerb der invasiven und metastatischen Eigenschaften<br />
von Darmkrebs- und Brustkrebs-Zelllinien beteiligt ist, indem diese gezielt<br />
auf zahlreiche Tumorsuppressorgene wirkt, wie etwa PTEN, PDCD4,<br />
RECK, TPM1 und MASPIN 6,7,14 . Zudem wurde die miR-21-Überexpression<br />
in Zusammenhang mit fortgeschrittenen klinischen Stadien und der<br />
Lymphknoten-Metastasierung bei Brustkrebs und dem hepatozellulären<br />
Karzinom gebracht 8,9 . Ähnlich wie miR-10b beeinträchtigten auch miR-373<br />
und miR-520c nicht die Zellproliferation, aber unterstützten in vitro die<br />
Migration und Invasion von Krebs-abgeleiteten Zelllinien 12 . Diese beiden<br />
miRNAs besitzen ähnliche Seed-Sequenzen, was nahelegt, dass sie einen<br />
überlappenden Satz von Gen-Targets regulieren könnten. Tatsächlich<br />
erwies sich CD44 – das einen Zelloberflächenrezeptor für Hyaluronsäure<br />
(Hyluronan) codiert – unter neun gemeinsamen potentiellen Gentargets<br />
als direktes Ziel beider miRNAs. In Krebsproben war miR373 hochreguliert,<br />
wenn die Tumoren Lymphknoten-Metastasen aufwiesen, und die miR-<br />
373-Expression zeigte eine inverse Korrelation zur CD44-Expression.<br />
Im Gegensatz zu anderen Studien, identifizierten Tavazoie et al. 10 erstmals<br />
miRNAs mit Metastasen-supprimierenden Eigenschaften. Beim<br />
Vergleich metastatischer Absiedlungen mit unselektierten parentalen<br />
Brustkrebszellen fanden sie, dass miR-335, miR-126 und miR-206 in den<br />
metastatischen Proben durchgehend herunterreguliert. Untermauert<br />
werden diese Daten dadurch, dass eine niedrige Expression von miR-335<br />
und miR-126 mit einem geringen Metastasen-freien Überleben in klinischen<br />
Proben korrelierte. In vitro-Analysen zeigten, dass miR-335 durch<br />
Abzielen auf die Transkriptionsfaktoren SOX4 und TNC (TCN codiert<br />
Tenascin, eine Komponente der extrazellulären Matrix) als Metastasen-<br />
Suppressor wirkt.<br />
Gregory und Mitarbeiter 11 fanden, dass alle fünf Mitglieder der miRNA-<br />
200-Familie (miR-200a, miR-200b, miR-200c, miR-141 and miR-429)<br />
sowie miR-205 auf die E-Cadherin-Repressoren ZEB1 und SIP1 zielen.<br />
Außerdem wurde gezeigt, dass diese miRNAs in solchen Zellen merklich<br />
herunterreguliert waren 11 , die eine epitheliale-mesenchymale Transition<br />
(EMT) durchlaufen hatten, der offenbar eine frühe Beteiligung der<br />
miRNA-Deregulierung beim Annehmen des metastatischen Phänotyps<br />
zugrundeliegt. Eigentlich ist die EMT ein Prozess, bei dem epitheliale<br />
Tumorzellen durch extrazelluläre Zytokine wie TGF-b oder intrazelluläre<br />
Regiesignale, wie etwa onkogenes Ras, stimuliert werden, ihre epitheliale<br />
Polarität zu verlieren und stattdessen mesenchymale Phänotypen mit<br />
stärkeren Migrations- und Invasions-Eigenschaften anzunehmen. Aus<br />
diesem Grund wird EMT als der initiierende und entscheidende Schritt<br />
im Metastasierungsprozess betrachtet. Diese Befunde wurden durch vier<br />
andere unabhängige Studien bestätigt 15 .<br />
Interessanterweise wird die Expression von miRNA-Genen, genau<br />
wie bei Protein-codierenden Genen, von der epigenetischen Regulation<br />
Wissenschaft RNA-Interferenz<br />
Porvair rose ad <strong>Laborwelt</strong> DE exb:Layout 1 11/2/09 11:07<br />
Weißer als weiß?<br />
Selbst die weißesten Mikroplatten wurden unter Umständen mithilfe von<br />
Fremdstoffen hergestellt, was Auswirkungen auf die Genauigkeit von<br />
Analyseergebnissen haben kann – bei den Mikroplatten von Porvair<br />
Sciences ist dies nicht der Fall. Rufen Sie uns an, senden Sie eine E-Mail<br />
oder besuchen Sie uns unter<br />
www.porvair-sciences.com/download_request.php und fordern Sie Ihre<br />
Kopie eines unabhängigen Artikels und eine Probe unserer Mikroplatten<br />
an, um die Ergebnisse mit Ihrer aktuellen Marke vergleichen zu können.<br />
Porvair Sciences Ltd<br />
Telephone +44 (0)1372 824290 Email: int.sales@porvair-sciences.com<br />
LABORWElT 10. Jahrgang | Nr. 5/2009 | 13
Wissenschaft RNA-Interferenz<br />
Abb. 1: Im Zuge der Metastasierung veränderte microRNAs, die als spezifische therapeutische<br />
Targets dienen könnten<br />
beeinflusst. Lujambio et al. 13 identifizierten<br />
bei der Untersuchung der Rolle des mit der<br />
DNA-Methylierung assoziierten Silencings von<br />
Tumorsuppressor-miRNAs in Metastasen ein<br />
spezifisches metastatisches miRNA-Hypermethylierungsprofil.<br />
Schließlich fanden wir auf der Suche nach<br />
einer spezifischen miRNA-Expressions-Signatur<br />
für den metastatischen Phänotyp solider Tumore<br />
mit Hilfe vergleichender Microarray-Analysen<br />
von Primärtumoren und davon abgeleiteten<br />
Metastasen eine umfassende miRNA-Signatur.<br />
Diese besteht aus 15 über- und 17 unterexprimierten<br />
miRNAs und vier verschiedenen organspezifischen<br />
miRNA-Signaturen 14 .<br />
Einige andere Hauptaspekte müssen noch<br />
untersucht werden, darunter der Einfluss<br />
der metastatischen Mikroumgebung auf die<br />
miRNA-Expression der Tumorzelle. Gleichwohl<br />
bestätigen die Berichte, dass spezifische mi-<br />
RNA-Gene direkt an der Krebsmetastasierung<br />
beteiligt sind – und unterstreichen damit die Bedeutung<br />
dieser neuen Klasse nicht-codierender<br />
RNAs bei der Translation von Biomarkern zur<br />
Diagnose, Prognose und für die Einschätzung<br />
des Therapieansprechens bei metastatischem<br />
Krebs.<br />
miRNAs – von der Laborbank<br />
zum Krankenbett<br />
Das miRNA-Profiling eröffnet die Unterscheidung<br />
normaler und pathologischer Läsionen<br />
und die Identifikation von Genexpressionssignaturen,<br />
die mit bestimmten Krebsphänotypen<br />
(wie dem metastatischen) assoziiert sind 3 . Es<br />
wurde bereits gezeigt, dass aberrante miRNA-<br />
Expressions-Signaturen in metastatischen<br />
Krebs involviert sind 9,14 , und eine einfache<br />
Profilierungsmethode könnte helfen, Krebspatienten<br />
zu identifizieren, die wahrscheinlich<br />
Metastasen oder Rückfälle entwickeln.<br />
Weil von diversen Organen abgeleitete<br />
Metastasen besondere organspezifische<br />
miRNA-Signaturen zeigen 14 , könnte die miRNA-<br />
Expressionsanalyse auch als neuartige, einfache<br />
Profilierungsmethode eingesetzt werden, um<br />
das Ausgangsorgan zu identifizieren, zum Beispiel<br />
bei Metastasen unbekannten Ursprungs.<br />
Auf diese Art und Weise repräsentieren genomweite<br />
Profilierungsansätze – ergänzt durch<br />
Funktionsstudien, die die Über- bzw. Unterexpression<br />
von miRNAs beinhalten – den Ansatz,<br />
der am wahrscheinlichsten zu Fortschritten im<br />
jungen Forschungsfeld der nicht-codierenden<br />
RNAs führen wird 1-3 . Dazu kommt, dass miRNAs<br />
– im Gegensatz zu mRNAs – in vivo langlebig<br />
und in vitro stabil sind, was ein entscheidender<br />
Vorteil im klinischen Rahmen sein könnte und<br />
die Analyse Formalin-fixierter, Paraffin-eingebetteter<br />
(FFPE) Proben gestattet 14 . Diverse Berichte<br />
haben bereits eine hohe Reproduzierbarkeit und<br />
Genauigkeit des miRNA-Expressions-Profilings<br />
in archivierten FFPE-Proben des Menschen belegt.<br />
In diesem Zusammenhang muss allerdings<br />
betont werden, dass auch wenn FFPE-Proben als<br />
unverzichtbares Werkzeug für die Biomarker-<br />
Entdeckung und – Validierung betrachtet<br />
werden, diese andererseits nicht immer kompatibel<br />
mit modernen Genomics-Technologien<br />
sind wie etwa Genexpressions-Arrays, weil die<br />
mRNA während der Fixierung und Bearbeitung<br />
abgebaut wird. Das Öffnen der Histopathologie-<br />
Archive gut annotierter FFPE-Proben für die<br />
miRNA-Expressionsprofilierung verspricht eine<br />
neue Ära der systematischen molekularen Begutachtung,<br />
die sich durch eine fortgeschrittene<br />
histopathologische und klinische Charakterisierung<br />
der Proben auszeichnet.<br />
Aus therapeutischer Sicht wird ein zunehmendes<br />
Verständnis der molekularen Rolle von<br />
miRNAs im Metastasierungsprozess maßgeblich<br />
zur Identifikation alternativer, therapeutisch<br />
interessanter molekularer Pathways beitragen.<br />
Darüber hinaus empfehlen sich miRNAs per se<br />
durch ihre Stabilität als neue attraktive Therapeutika.<br />
Dazu kommt, dass miRNA-basierte<br />
shRNAs die Genexpression starker inhibieren<br />
als traditionelle Haarnadel-shRNAs 1-3 .<br />
Eine Sequenz-spezifische Hemmung der<br />
miRNAs kann mit chemisch stabilisierten<br />
und optimierten Antisense-Oligonucleotiden<br />
erzielt werden. Außerdem wurde die Funktion<br />
einer neuen Klasse chemisch modifizierter, mit<br />
Cholersterin konjugierter Antisense-RNAs, der<br />
„Antagomirs“, als spezifische und wirksame<br />
Silencer endogener miRNAs in Mäusen nachgewiesen<br />
1-3 .<br />
Obgleich spannend, muss eine miRNAbasierte<br />
Gentherapie von metastasierendem<br />
Krebs erst den Nachweis erbringen, dass<br />
Targets hochwirksam gehemmt und das<br />
Patientenüberleben bei minimaler Toxizität<br />
signifikant verlängert werden. Darüber hinaus<br />
erfordert die Entwicklung miRNA-basierter<br />
Therapien einen wirksamen Transport zum<br />
Wirkort.<br />
Weitere Funktionsstudien sind essentiell,<br />
um die Bedeutung der miRNA-Expression in<br />
Metastasen weiter aufzuklären. Nichtsdestotrotz<br />
hat die miRNA-Revolution begonnen<br />
und wird zweifellos die künftige Behandlung<br />
metastatischer Patienten beeinflussen.<br />
Literatur<br />
[1] Croce, C.M., Calin, G.A., Cell 122 (2005), 6-7.<br />
[2] Esquela-Kerscher, A., Slack, F.J., Nature Rev Cancer 6 (2006),<br />
857-866.<br />
[3] Calin, G.A., Croce, C.M., Nat Rev Cancer 6 (2006), 857-866.<br />
[4] Ma, L., Teruya-Feldstein, J., Weinberg, R.A., Nature 449 (2007),<br />
682-689.<br />
[5] Gee, H.E., Camps, C., Buffa, F.M., Colella, S., Sheldon, H.,<br />
Gleadle, J.M., Ragoussis, J., Harris, A.L., Nature 455 (2008),<br />
E8-9.<br />
[6] Asangani, I., Rasheed, S.A.K., Nikolova, D.A., Leupold, J.H.,<br />
Colburn, N.H., Post, S., Allgayer, H., Oncogene 27 (2008),<br />
2128-2136.<br />
[7] Zhu, S., Wu, H., Wu, F., Nie, D., Sheng, S., Mo, Y.Y., Cell Res 18<br />
(2008), 350-359.<br />
[8] Yan, L.X., Huang, X.F., Shao, Q., Huang, M.Y., Deng, L., Wu,<br />
Q.L., Zeng, Y.X., Shao, J.Y., RNA 14 (2008), 2348-2360.<br />
[9] Budhu, A., Jia, H.L., Forgues, M., Liu, C.G., Goldstein, D., Lam,<br />
A., Zanetti, K.A., Ye, Q.H., Croce, C.M., Tang, Z.Y., Wang, X.W.,<br />
Hepatology 47 (2008), 897-907.<br />
[10] Tavazoie, S.F., Alarcon, C., Oskarsson, T., Padua, D., Wang,<br />
Q., Bos, P.D., Gerald, W.L., Massague, J., Nature 451 (2008),<br />
147-152.<br />
[11] Gregory, P.A., Bert, A.G., Paterson, E.L., Barry, S.C., Tsykin,<br />
A., Farshid, G., Vadas, M.A., Khew-Goodall, Y., Goodall, G.J.,<br />
Nature Cell Biol 10 (2008), 593-601.<br />
[12] Huang, Q., Gumireddy, K., Schrier, M., Le Sage, C., Nagel,<br />
R., Nair, S., Egan, D.A., Li, A., Huang, G., Klein-Szanto,<br />
A.J., Gimotty, P.A., Katsaros, D., Coukos, G., Zhang, L., Pure,<br />
E., Agami, R., Nat Cell Biol 10 (2008), 292-310.<br />
[13] Lujambio, A., Calin, G.A., Villanueva, A., Ropero, S., Sanchez-<br />
Cespedes, M., Blanco, D., Montuenga, L.M., Rossi, S.,<br />
Nicoloso, M.S., Faller, W.J., Gallagher, W.M., Eccles, S.A.,<br />
Croce, C.M., Esteller, M., Proc Natl Acad Sci USA 105 (2008),<br />
13556-13561.<br />
[14] Baffa, R., Fassan, M., Volinia, S., O‘Hara, B., Liu, C.G., Palazzo,<br />
J.P., Gardiman, M., Rugge, M., Gomella, L.G., Croce, C.M.,<br />
Rosenberg, A., J Pathol. 219(2):214-221 (2009).<br />
[15] Korpal, M., Kang, Y., RNA Biol 5 (2008), 115-119.<br />
Korrespondenzadresse<br />
Prof. Carlo M Croce<br />
Ohio State University<br />
1082 Biomedical Research Tower<br />
460 W. 12 th Avenue, Columbus, OH 43210<br />
Tel.: +1-(0)614-292-4930<br />
Fax: +1-(0)614-292-3558<br />
carlo.croce@osumc.edu.<br />
14 | 10. Jahrgang | Nr. 5/2009 LABORWElT
Report Metastasierung<br />
Brustkrebs und<br />
Metastasierung – Vorteile<br />
einer Individualtherapie<br />
Ralf Hass, AG Biochemie und Tumorbiologie, Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe, MHH<br />
Brustkrebs als primär maligne Entartung im Brustdrüsengewebe ist bei Frauen die nach wie vor<br />
häufigste Tumorerkrankung und auch krankheitsbedingte Todesursache. Sehr viel seltener wird<br />
Brustkrebs auch bei Männern diagnostiziert. Bei den histopathologisch unterschiedlichen Brustkrebsarten<br />
(etwa ductal, lobulär, medullär, tubulär) und der Identifizierung des Rezeptorstatus<br />
(Östrogen- und Progesteronrezeptor sowie Her2/neu) auf den Tumorzellen gibt es derzeit eine<br />
entsprechende Auswahl an therapeutischen Ansatzformen wie Chemo-, Hormon-, Antikörperund<br />
Strahlentherapie. Neben diesen relativ unspezifischen Mitteln stellt die Entwicklung und<br />
der zunehmende Einsatz kleiner inhibitorischer Moleküle – etwa zum Blockieren wachstumsstimulatorischer<br />
intrazellulärer Signalkaskaden – einen deutlich fokussierteren molekularen Therapieansatz<br />
dar. Allerdings sind diese Signalwege nicht unbedingt spezifisch für Brustkrebszellen,<br />
sondern eher präsent in allen hochproliferativen Geweben im Körper, wie in den verschiedenen<br />
Epithelien. Aufgrund der Heterogenität von Brustkrebserkrankungen sind diese pauschalen<br />
Therapieschemata daher nicht immer erfolgreich und verfehlen teilweise gänzlich die erhoffte<br />
Wirkung. Durch eine generelle Proliferationsinhibition wird natürlich auch die Regenerationsfähigkeit<br />
wichtiger Gewebe stark eingeschränkt, was die Gewebshomoöstase und das notwendige<br />
metabolische Gleichgewicht stört und somit zu extrem unangenehmen Nebenwirkungen bis hin<br />
zur ungewollten Generation von Kollateralerkrankungen führen kann.<br />
Hier ließen sich – durch die ausgedehnte Testung<br />
patientenspezifischer Tumorzellen aus<br />
Tumorbiopsien ex vivo mit Hilfe standardisierter<br />
zellbasierter Assays – gezieltere Therapieansätze<br />
eher auf individueller Basis entwickeln<br />
um damit ein optimiertes Therapieschema für<br />
jeden einzelnen Brustkrebs zusammenstellen<br />
zu können. Für einen derart individualisierten<br />
Ansatz ist es gelungen, eine Technologie zur<br />
Anzüchtung von Brustkrebsprimärkulturen zu<br />
entwickeln1 , wobei Brustkrebszellen mittlerweile<br />
länger als zwei bis drei Jahre permanent<br />
aus einem Tumorgewebe gewonnen werden<br />
können. Um die Reproduzierbarkeit dieser<br />
individuellen Brustkrebsprimärkultur-Technologie<br />
zu gewährleisten, haben eine Reihe von<br />
molekularen Untersuchung zur Expression bestimmter<br />
Zelloberflächenrezeptoren und etwa<br />
zur Expression des Alterungsmarkers Senezenzassoziierte-b-Galactosidase<br />
(SA b-gal) und<br />
zur Telomeraseaktivität gezeigt, dass die aus<br />
dem Tumorgewebe ständig proliferierenden<br />
„human breast cancer-derived epithelial cells“<br />
185x32mm_SW_dt_oR 30.01.2008 19:41 Uhr Seite 1<br />
(HBCEC) im Lauf der Jahre ihre ursprünglichen<br />
zellbiologischen und funktionellen Eigenschaften<br />
nicht signifikant verändern, sofern<br />
nicht metastasenähnliche Aktivierungen wie<br />
die epithelial-mesenchymale Transition (EMT)<br />
auftreten2 . Darüber hinaus zeigen die Primärkulturen<br />
aus Brustkrebsgewebe verschiedener<br />
Patienten erwartungsgemäß Unterschiede in<br />
der Reaktion auf diverse chemotherapeutische<br />
Agenzien, und zwar nicht nur zwischen den individuellen<br />
HBCEC-Populationen von verschiedenen<br />
Spendern, sondern auch gegenüber einer<br />
Primärzellkultur aus nicht-tumorigenem – also<br />
normalem Brustgewebe2 . Diese Technologie zur<br />
Anzucht individueller Brustkrebsprimärkulturen<br />
könnte daher einerseits dazu dienen, individuelle<br />
patientenorientierte Therapieschemata zu<br />
entwickeln und zu optimieren. Andererseits<br />
könnte sie im pharmazeutischen Bereich eine<br />
primärkulturbasierte Screening-Plattform zur<br />
Identifizierung von brustkrebsspezifischen<br />
Biomarkern und zum Testen neuer Therapeutikagruppen<br />
bieten.<br />
KRAEBER GMBH & CO<br />
P H A R M A Z E U T I S C H E R O H S T O F F E<br />
WIR SIND DER SPEZIALIST FÜR BLUTFRAKTIONIERUNGEN<br />
Da eine Individualtherapie aber noch nicht<br />
etabliert ist, bleiben die bislang anwendbaren,<br />
relativ unspezifischen Brustkrebstherapien<br />
mit entsprechenden Nebenwirkungen<br />
zunächst das Mittel der Wahl. Dabei ist der<br />
nach wie vor empfehlenswerteste Ansatz die<br />
frühestmögliche Diagnose von Brustkrebs mit<br />
unmittelbarer operativer Tumorentfernung<br />
und nachfolgender Therapie. Allerdings ist der<br />
Erfolg eines therapeutischen Ansatzes neben<br />
der Patientenverträglichkeit auch limitiert<br />
durch die Art des Tumors und eine mögliche<br />
Infiltration von Lymphknoten. Doch auch ohne<br />
diagnostizierbare Lymphknotenmetastasen<br />
ergeben sich Risiken eines möglichen und nach<br />
heutigen Standards schwer oder nicht mehr<br />
therapierbaren Tumorrezidivs.<br />
Disseminierte Tumorzellen<br />
Neben Mikrometastasen können teilweise parallel<br />
zu einem Brustprimärtumor sogenannte<br />
disseminierte Tumorzellen (DTCs) identifiziert<br />
werden, die z.B. im Knochmark, aber auch in<br />
anderen Geweben wie dem peripheren Blut oder<br />
den Lymphknoten assoziiert sind. Diese DTCs<br />
bleiben nach einer operativen Entfernung des<br />
Primärtumors im Körper erhalten und werden<br />
für ein Wiederauftreten, also ein Rezidiv der<br />
Tumorerkrankung in Form von Gewebsmetastasen<br />
verantwortlich gemacht 3 . Wieso dauert<br />
es dann aber eine lange Zeit – teilweise Jahre<br />
, oder bei östrogenrezeptor-positiven Brusttumoren<br />
auch Jahrzehnte, bis sich aus solchen<br />
DTCs möglicherweise Organmetastasen bilden?<br />
Offensichtlich ist die Metastasierung ein aus<br />
mehreren Entwicklungsschritten bestehender<br />
zellbiologischer Prozess, der in unterschiedlichen<br />
Tumoren (z. B. Kolonkarzinom im Gegensatz zum<br />
Mammakarzinom) mit unterschiedlicher Kinetik<br />
abläuft, wobei möglicherweise auch „schlafende“<br />
Tumorzellen auf entsprechende Trigger hin<br />
erst aktiviert werden. Ebenso kann eine Tumorgenese<br />
oder die Generation metastatisch aktiver<br />
Tumorzellen auch im Rahmen von Fehlsteuerungen<br />
eines reversiblen Entwicklungsprozesses,<br />
also einer Retrodifferenzierung oder Verjüngung<br />
eines Entwicklungsstands entstehen 4 .<br />
Das Potential für DTCs zur Metastasierung<br />
kann initial verstärkt werden durch Signale, die<br />
auch eine epithelial-mesenchymale Transition<br />
(EMT) induzieren. Diese zellbiologische Veränderungen<br />
von einem Zelltyp in einen anderen<br />
mit völlig neuen metabolischen Eigenschaften<br />
>> www.kraeber.de >> e-mail: info@kraeber.de<br />
Wir fraktionieren von 16 Tierspezies für die: Pharmazie, Biotechnologie, Diagnostika, Kosmetik<br />
Serum, Plasma, Albumin, Hemoglobin, Hemin, Hematoporphyrin, Thrombin und Lohnherstellung.
Report Metastasierung<br />
wird u.a. kontrolliert durch aberrante Aktivität<br />
bestimmter Transkriptionsfaktoren wie TWIST1,<br />
SNAI1 und SNAI2. Ebenso favorisieren Modulatoren<br />
von Wachstumsfaktorrezeptor-Signalen<br />
wie Metadherin eine EMT. Auf transkriptioneller<br />
Ebene wird eine Suppression der beiden miR-126<br />
und miR-335, zwei nicht kodierende RNAs, mit<br />
EMT und der Initiation von metastatischem<br />
Wachstum in Verbindung gebracht. Für eine<br />
derartige zellbiologische Veränderung wie der<br />
EMT, aber auch für eine Adaptation an metastatische<br />
Bedingungen müssen die Tumorzellen<br />
entsprechend flexible Differenzierungsfähigkeiten<br />
entwickeln – also Eigenschaften, die üblicherweise<br />
Vorläufer- oder Stammzellen besitzen.<br />
Obwohl es Hinweise auf Zellpopulationen mit<br />
stammzellähnlichen Eigenschaften in Brustkrebsgewebe<br />
und -primärkulturen gibt 2 und<br />
auch eine Retrodifferenzierung reifer Brustepithelzellen<br />
zurück in Vorläuferstadien denkbar<br />
ist 4 , fehlen bislang ausreichend experimentelle<br />
Nachweise auf Einzelzellebene, um eine Beteiligung<br />
von Tumorstammzellen an einer EMT<br />
oder Metastasierung durch Differenzierung<br />
zu belegen. EMT kann in Langzeitkulturen von<br />
Brustkrebsbiopsien beobachtet werden und<br />
zeigt eindrucksvoll, wie sich die Morphologie<br />
und parallel dazu natürlich die Funktionalität der<br />
Tumorzellen durch die Expression völlig neuer<br />
Zellmarker verändert (Abb. 1).<br />
Von Primärzellen zu Metastasen<br />
Für eine erfolgreiche Metastasierung müssen<br />
die DTCs nach Verlassen des Primärtumorverbandes<br />
zunächst in der Zirkulation überleben,<br />
um dann an einem Zielorgan anzudocken.<br />
Bei disseminierten Brustkrebszellen ist diese<br />
sogenannte Latenzperiode sehr lang. Das<br />
heißt, dass die DTCs ihr Zielorgan erst finden<br />
müssen, um sich zunächst langsam an die neue<br />
Mikroumgebung des Zielorgans adaptieren zu<br />
können. Nachdem die DTCs ihren Stoffwechsel<br />
angepasst und sich dort eine neue lebensfähige<br />
Umgebung geschaffen haben, kann die<br />
Abb. 1: Lichtmikroskopische Vergrößerung einer epithelial-mesenchymalen Transition (EMT)<br />
von Primärkulturen während der Langzeitkultur nach 241 Tagen aus einer Gewebsbiopsie<br />
eines ductalen Mammakarzinoms. Auf der linken Seite des Tumorgewebes wachsen<br />
epitheliale Tumorzellen aus, mit der Morphologie von tumorigenen HBCEC (morphologisch<br />
lassen sich HBCEC und HMEC nicht differenzieren). Im Gegensatz dazu wachsen<br />
nach 241 Tagen bei diesem Tumor plötzlich auf der entgegengesetzten Seite des Tumorgewebes<br />
langgezogene stromaähnliche Zellen aus, was tumorspezifisch auftritt, da dieses<br />
Phänomen bei Brusttumoren anderer Patienten zu anderen Zeitpunkten auftreten<br />
kann. Charakterisierungsexperimente haben ergeben, dass die HBCEC auf der linken<br />
Seite zu 99% Cytokeratine exprimieren sowie den Oberflächenrezeptor CD44, wogegen<br />
diese Population CD90-negativ ist. Im Gegensatz dazu zeigen die auf der rechten Seite<br />
aus dem Tumorgewebe jetzt auswachsenden stromaähnlichen Zellen keine Expression<br />
von Cytokeratinen mehr, und die Expression von CD44 ist reduziert. Dafür exprimiert<br />
diese Population signifikant den Marker CD90. Diese Ergebnisse deuten daraufhin, dass<br />
während der Langzeitkultur des Brusttumorgewebes innerhalb einer Subkultur ein Teil<br />
des Gewebes funktionell verändert wird, wobei die vorher auswachsenden epithelialen<br />
Zellen jetzt mit einer mesenchymal-stromaartigen Morphologie und Funktionalität<br />
auswachsen. In der nachfolgenden Weiterkultur dieses Tumorgewebestückes setzte sich<br />
diese EMT fort und zeigte dann innerhalb kürzester Zeit (2 bis 3 Subkulturen) wenig bis<br />
keine HBCEC mehr und nur noch das Auswachsen der stromaähnlichen Zellpopulation.<br />
Proliferationsmaschinerie der organassoziierten<br />
Tumorzellen aktiviert werden, und es kommt zur<br />
Koloniebildung und zur Bildung von Mikrometastasen.<br />
Aufgrund ihres invasiven Wachstums<br />
infiltrieren diese Tumorzellkolonien dann das<br />
Wirtsorgan und bilden entsprechende Metastasen<br />
aus. Durch diese mehrstufigen Veränderungen<br />
der ursprünglichen Primärtumorzellen<br />
während der Adaptation ihres Stoffwechsels<br />
an die Mikroumgebung des zu infiltrierenden<br />
Organs verändern sich natürlich auch ihre zellbiologischen<br />
Eigenschaften, wodurch sich auch<br />
Modifikationen in der Sensitivität gegenüber<br />
Therapieansätzen im Gegensatz zum Primärtumor<br />
ergeben. Dies bedeutet, dass einerseits mit<br />
einer Chemo-, Hormon- oder Antikörpertherapie<br />
erfolgreich ein Primärtumor behandelt werden<br />
kann, diese Strategie bei Tumormetastasen aber<br />
vollkommen versagen kann, weil diese Zellen<br />
im Rahmen ihrer zellbiologischen Adaptation<br />
nicht mehr entsprechende Rezeptoren exprimieren<br />
oder sogar entsprechende Resistenzen<br />
entwickelt haben. Ein denkbarer Lösungsansatz<br />
solcher schwer oder mit derzeitigen<br />
Standardmethoden nicht mehr therapierbarer<br />
Metastasen wäre auch hier die Entwicklung<br />
eines individuellen Therapieschemas durch die<br />
Charakterisierung von metastatischen Primärkulturen<br />
und der Identifizierung potentieller<br />
metastatischer Biomarker.<br />
Bildung von DCTs<br />
Für die Metastasierung von Brustkrebszellen<br />
sind einige wichtige Faktoren und molekulare<br />
Prozesse identifiziert worden, die die Voraussetzungen<br />
zur möglichen Bildung von DTCs<br />
schaffen. Hierzu gehören u.a. die verstärkte<br />
Expression von Matrixmetalloproteinasen<br />
(bspw. MMP-1 und MMP-2), die durch erhöhte<br />
Enzymaktivität zu einem vermehrten Abbau<br />
der Extrazellularmatrix beitragen, um dadurch<br />
einzelnen Tumorzellen mehr Mobilität zu<br />
verleihen, sich aus dem Tumorzellverband zu<br />
lösen 5 . Weitere identifizierte Faktoren in metastatischen<br />
Brustkrebszellen sind die verstärkte<br />
Expression von Prostaglandin G/H-Synthase-2<br />
(COX2) sowie Epiregulin, einer der Liganden<br />
von epidermalen Wachstumsfaktorrezeptoren<br />
(EGF-Rs), zur Verstärkung des Zellwachstums<br />
metastasierender Tumorzellen 5 . Hierzu tragen<br />
auch TGFb-induzierte angiopoetische Faktoren<br />
bei. Gerade TGFß vermittelte Metastasierung<br />
in Knochengewebe konnte vor kurzem über<br />
multimodale mikro-PET (positron emission<br />
tomography) in einer Zeitkinetik mit Hilfe von<br />
zwei markierten Brustkrebszelllinien mit unterschiedlichen<br />
metastatischen Kapazitäten<br />
dargestellt werden 7 . Ein weiterer Faktor, der in<br />
metastasierenden und auch rezidivierenden<br />
Brustkrebszellen identifiziert wurde, ist das<br />
Enzym Lysyloxidase (LOX), was auch durch<br />
eine hypoxische Umgebung aktiviert wird.<br />
Bemerkenswert an diesen Faktoren ist, dass<br />
die meisten von ihnen auch eine wichtige Rolle<br />
16 | 10. Jahrgang | Nr. 5/2009 LABORWElT
in normalen Brustepithelien spielen, wobei<br />
insbesondere MMPs, EGF-Liganden und LOX<br />
wichtige regulatorische Funktionen während<br />
des Alterungsprozesses von normalen Brustepithelzellen<br />
übernehmen. So konnte in einem<br />
etablierten Alterungsmodell mit normalen<br />
Brustepithelzellen (HMEC) aufeinanderfolgender<br />
Kulturpassagen in vitro ein neuer Mechanismus<br />
identifiziert werden, wobei MMPs (speziell<br />
MMP-7) während des Alterungsprozesses von<br />
normalen HMEC herunterreguliert werden<br />
und so einen funktionellen Zusammenhang<br />
zwischen diesen Faktoren herstellt. Dabei lässt<br />
sich in jungen, proliferativ aktiven HMEC extrazellulär<br />
eine Co-Lokalisation von MMP-7 mit<br />
der Heparin-bindenden Form von EGF (HB-EGF)<br />
nachweisen, die über einen trimeren Komplex<br />
mit multistrukturellen transmembranen Heparansulfat-Proteoglycanrezeptoren<br />
von CD44 die<br />
MMP-7- katalysierte Spaltung von proHB-EGF in<br />
sHB-EGF (soluble HB-EGF) vermittelt und gleichzeitig<br />
eine sterische Assoziation zu den EGF-<br />
Rezeptoren ErbB1 und ErbB4 herstellt, für eine<br />
nachfolgende Aktivierung durch die Bindung<br />
von sHB-EGF an diese Rezeptoren 6 . Die daraufhin<br />
rezeptorvermittelte intrazelluläre Signalkaskade<br />
über eine Reihe von Proteinkinasen und den<br />
Transkriptionsfaktor Fra-1 vermittelt im Zellkern<br />
ein Proliferationssignal und wirkt gleichzeitig<br />
als Repressor für Tropoelastin, ein Substrat von<br />
LOX und LOX-ähnlichen Enzymen (LOXL1 bis<br />
LOXL5) zur extrazellulären Synthese von Elastinassoziierten<br />
Strukturen der Extrazellularmatrix.<br />
Interessanterweise werden diese Signalwege<br />
während der HMEC- Alterung umgekehrt. In<br />
seneszenten und nicht mehr proliferativ aktiven<br />
HMEC ist die Expression von MMP-7 herunterreguliert,<br />
und es findet keine Assoziation zwischen<br />
dem verbleibenden MMP-7 und HB-EGF<br />
mehr statt, so dass ein sHB-EGF-vermitteltes<br />
Proliferationssignal unterbleibt und durch die<br />
fehlende Aktivierung von Fra-1 keine Repression<br />
des Tropoelastingens mehr erfolgt. Als Konsequenz<br />
daraus produzieren die seneszenten<br />
HMEC verstärkt Tropoelastin und durch eine<br />
gleichzeitig signifikant erhöhte LOX-Aktivität<br />
werden verstärkt Elastinfasern gebildet, was<br />
die Komposition und die biophysikalischen Eigenschaften<br />
der Extrazellularmatrix und damit<br />
der Mikroumgebung der Brustepithelzellen signifikant<br />
veränder 6 . Durch die große Bedeutung<br />
der Mikroumgebung von Brustkrebszellen für<br />
ein Metastasierungsverhalten wie etwa das<br />
Elastinnetzwerk der Lunge, könnten Deregulationen<br />
in der Signalkaskade und der Funktion von<br />
alterungsassoziierten Faktoren auch kausale Bedeutung<br />
für neoplastische Entartungen haben,<br />
zumal eine Großzahl von Mammakarzinomen<br />
alterungsassoziiert, also bei Frauen mittleren<br />
Alters bzw. postmenopausal entstehen.<br />
Neuere Erkenntnisse aus der Arbeitsgruppe<br />
von Joan Massagué vom Memorial Sloan-<br />
www.laborwelt.de<br />
Kettering-Krebszentrum in New York zeigen<br />
zudem, dass die Faktoren COX2 und HB-EGF<br />
unter anderem an einer Metastasierung von<br />
Brustkrebszellen nicht nur in die Lunge, sondern<br />
auch in das Gehirn beteiligt sind. Ein weiterer<br />
Faktor, a-2,6-Sialyltransferase wirkt hier offenbar<br />
organspezifisch und verändert die Oberflächeneigenschaften<br />
der Brustkrebszellen durch<br />
den Umbau diverser Glykoproteine, was die<br />
Anheftung der Tumorzellen an den Gefäßwänden<br />
im Gehirn stabilisiert, um so die Blut-Hirn-<br />
Schranke aus Endothelzellen und Astrozyten zu<br />
durchdringen 8 .<br />
Metastasen-spezifische Therapien<br />
Angesichts der zunehmenden Diversifizierung<br />
von Brustkrebstumorzellen im Rahmen der<br />
Metastasierung – also während der Adaptation<br />
an eine organspezifische Umgebung – können<br />
standardisierte Mono- als auch Kombinationstherapien<br />
nur einen begrenzten Wirkungsgrad<br />
erzielen. Unter gesundheitsökonomischen<br />
Aspekten wären metastasenspezifische Therapeutika<br />
oder eine Individualtherapie mit<br />
einem spezifischen Wirkungsspektrum initial<br />
natürlich deutlich kostenintensiver, allerdings<br />
würden sich bei größeren Therapieerfolgen<br />
langfristig die Folgekosten wiederum minimieren.<br />
Literatur<br />
[1] Hass, R., Primärzellen aus Brusttumoren für die Diagnostik<br />
und individuelle Tumor-Therapie, Labrorwelt 7(1), 40 (2006)<br />
[2] Hass, R. & Bertram C. Characterization of human breast cancer<br />
epithelial cells (HBCEC) derived from long term cultured<br />
biopsies. J. Exp. & Clin. Cancer Res., in press (2009)<br />
[3] Pantel, K. & Brakenhoff, R. H. Dissecting the metastatic<br />
cascade. Nature Rev. Cancer 4, 448–456 (2004)<br />
[4] Hass, R. Rejuvenation in distinct cell populations - what does<br />
it mean? Exp Gerontol. (2009)<br />
[5] Nguyen DX, Bos PD, Massagué J. Metastasis: from dissemination<br />
to organ-specific colonization. Nature Rev. Cancer 9,<br />
274-284 (2009)<br />
[6] Bertram C, Hass R Cellular senescence of human mammary<br />
epithelial cells (HMEC) is associated with an altered MMP-7/<br />
HB-EGF signaling and increased formation of elastin-like<br />
structures. Mech Aging Dev (2009)<br />
[7] Serganova I, Moroz E, Vider J, Gogiberidze G, Moroz M,<br />
Pillarsetty N, Doubrovin M, Minn A, Thaler HT, Massague J,<br />
Gelovani J, Blasberg R. Multimodality imaging of TGFbeta<br />
signaling in breast cancer metastases. FASEB J. 23, 2662-<br />
2672 (2009)<br />
[8] Bos PD, Zhang XH, Nadal C, Shu W, Gomis RR, Nguyen DX,<br />
Minn AJ, van de Vijver MJ, Gerald WL, Foekens JA, Massagué<br />
J. Genes that mediate breast cancer metastasis to the brain.<br />
Nature 459, 1005-1009 (2009)<br />
Korrespondenzadresse<br />
Prof. Dr. Ralf Hass<br />
Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe<br />
AG Biochemie und Tumorbiologie<br />
Medizinische Hochschule Hannover<br />
D-30625 Hannover<br />
Tel.: +49-(0)511-532-6070<br />
Fax: +49-(0) 511-532-6071<br />
www.mh-hannover.de/4122.html<br />
��������<br />
������<br />
�����<br />
������<br />
Report Metastasierung<br />
�����������������������<br />
���������������<br />
�������������<br />
�� ������������������<br />
�� �����������<br />
�� ���������������<br />
��������������<br />
�����������������<br />
������������������<br />
���������������������������<br />
����������������������������<br />
LABORWElT 10. Jahrgang | Nr. 5/2009 | 17
11 th Guide to German Biotech Companies<br />
11 th Guide to German Biotech Companies 2009 BIOCOM<br />
Blitzlicht Klinische Entwicklung<br />
Neuer<br />
Jahrgang<br />
11 th Guide<br />
to German<br />
Biotech<br />
Companies<br />
2009<br />
In co-operation with:<br />
BIO Deutschland – German<br />
Biotech Industry Organisation<br />
ISBN 978-3-928383-10-3<br />
DIB German Association<br />
of Biotechnology Industries<br />
VBU Association of German<br />
Biotechnology Companies<br />
BIOCOM<br />
Die internationale Visitenkarte der<br />
deutschen Biotech-Industrie, der<br />
englischsprachige Guide to<br />
German Biotech Companies, ist<br />
jetzt neu im 11. Jahrgang erschienen.<br />
Auf rund 230 vierfarbigen<br />
Seiten präsentieren sich führende<br />
deutsche Biotechnologie-<br />
Unternehmen mit Schwerpunkt<br />
Forschung und Entwicklung.<br />
Gemeinsam herausgegeben von<br />
BIO Deutschland, DIB und VBU.<br />
16,80 R<br />
05/2009 | ISBN 978-3-928383-10-3<br />
BIOCOM Verlag GmbH<br />
Stralsunder Str. 58-59<br />
13355 Berlin | Germany<br />
www.biocom.de<br />
service@biocom.de<br />
Tel. +49 (0)30/264921-40<br />
Fax +49 (0)30/264921-11<br />
Experimentelle Therapie<br />
von Flt3-ITD-positiven<br />
AML-Patienten<br />
PD Dr. Andreas Burchert, Dr. Stephan Metzelder, Prof. Dr. Andreas Neubauer,<br />
Philipps Universität Marburg, Universitätklinikum Gießen und Marburg GmbH<br />
Die akute myeloische Leukämie (AML) ist eine lebensbedrohliche Erkrankung und hat vor<br />
allem im höheren Alter eine schlechte Prognose 1 . Einer der wichtigsten prognosebestimmenden<br />
Faktoren bei der AML ist die Zytogenetik. Je nach Aberration wird zwischen Hoch-,<br />
Intermediär- und Niedrigrisikogruppen unterschieden. Patienten mit normalem Karyotyp<br />
haben ein intermediäres Risiko. Allerdings weist etwa ein Drittel dieser Patienten eine<br />
bestimmte Mutation im Flt3-Gen auf (Flt3-ITD), die mit einer zur zytogenetisch definierten<br />
Hochrisikogruppe vergleichbar schlechten Prognose assoziiert ist 2-4 . So erleiden ca. 35% der<br />
Flt3-ITD-Patienten innerhalb der ersten beiden Jahre nach konventioneller AML-Chemotherapie<br />
ein Rezidiv 5,6 . Eine Stammzelltransplantation kann das Rezidivrisiko im Vergleich zu<br />
einer konventionellen Chemotherapie nur zu einem gewissen Grad verringern 6 .<br />
Das Flt3-Gen kodiert für eine Rezeptortyrosinkinase,<br />
die normalerweise in hämatopoetischen<br />
Vorläuferzellen exprimiert wird.<br />
Der enzymatisch inaktive Flt3-Rezeptor wird<br />
nach Binden des Flt3-Liganden aktiviert und<br />
reguliert dann biologische Prozesse wie<br />
Überleben, Differenzierung und Wachstum<br />
(Abb. 1A). Die Flt-3-Ligandenbindung führt<br />
zu einer Rezeptordi- bzw. -oligomerisation<br />
und einer Flt3-Konformationsänderung, die<br />
eine Transphosphorylierung von Tyrosinresten<br />
sowie Substratphosphorylierungen<br />
zur Folge hat (Abb. 1A). Auf diese Weise<br />
werden verschiedene, Flt3 nachgeschaltete<br />
Signalwege, wie der Ras-, Stat-5 und<br />
PI3K-Akt-Signalweg, ligandenabhängig<br />
aktiviert (Abb. 1A). Nach Internalisation des<br />
Liganden-Rezeptorkomplexes limitiert sich<br />
Abb. 1: Schematische Darstellung der Aktivierung der Flt-3-Rezeptortyrosinkinase und der<br />
davon abhängigen Signaltransduktionswege. A. Flt-3-Liganden-abhängige Aktivierung.<br />
B. Konstitutive, ligandenunabhängige Flt3-Aktivierung. Sorafenib inhibiert Flt3-<br />
ITD durch Bindung in der Kinasedomäne und Verhinderung von Auto- und Substratphosphorylierung.<br />
18 | 10. Jahrgang | Nr. 5/2009 LABORWElT
www.laborwelt.de<br />
die Flt3-Liganden-induzierte Signaltransduktion<br />
von selbst. Dies ist bei der Flt-3-<br />
ITD (interne Tandemduplikation)-Variante<br />
nicht der Fall (Abb. 1B). Die ITD-Mutation<br />
befindet sich im juxtamembranären Teil des<br />
Flt-3-Rezeptors (Abb. 1B). Sie führt zu einer<br />
ligandenunabhängigen Oligomerisation und<br />
damit zur konstitutiven Phosphorylierung<br />
und Aktivierung aller von Flt-3 abhängenden<br />
anti-apoptotischen und pro-proliferativen<br />
Signalwege (Abb. 1B).<br />
Grundlage für eine Flt-3-Inhibition<br />
mit Sorafenib bei AML-Patienten<br />
Sorafenib (BAY-43-9006, Nexavar®) ist ein<br />
Multikinaseinhibitor, der zunächst als Inhibitor<br />
der Raf-Kinase für die Behandlung<br />
unterschiedlicher Tumorenentitäten entwickelt<br />
wurde. In zellbasierten Assays zeigte<br />
sich, dass Sorafenib neben Raf auch andere<br />
Rezeptortyrosinkinasen wie VEGFR-2, VEG-<br />
FR-3 und PDGFR-alpha sowie die Flt3-Kinase<br />
hemmt. Interessanterweise inhibiert Sorafenib<br />
auch die mutierte Flt3-Kinase (Flt3-ITD)<br />
im niedrigen nanomolaren Bereich und damit<br />
sogar deutlich effektiver als den Wildtyp-<br />
Flt-3 Rezeptor 7 . Dies führt zu einer Hemmung<br />
der enzymatischen Aktivität von Flt3-ITD und<br />
der Flt3-ITD-abhängigen Signaltransduktion<br />
(Abb. 1B). Sorafenib ist in den Indikationen<br />
fortgeschrittenes Leberzellkarzinom 8 sowie<br />
metastasiertes Nierenzellkarzinom in den<br />
USA und in Europa zugelassen.<br />
Der bei AML-Patienten häufig überexprimierte<br />
oder mutierte Flt3-Rezeptor stellt<br />
ein interessantes Molekül für eine gezielte<br />
therapeutische Intervention dar. Die AML ist<br />
allerdings eine genetisch heterogene Erkrankung,<br />
was erklärt, warum die Resultate des<br />
Einsatzes unterschiedlicher Flt3-Inhibitoren<br />
in Phase I- und II-Monotherapiestudien an<br />
unselektierten AML-Patienten ernüchternd<br />
ausfielen 9 . Es gibt allerdings fundierte Rationalen,<br />
die für den Einsatz von Flt3-Inhibitoren<br />
wie Sorafenib speziell bei Flt3-ITD-positiven<br />
AML-Patienten sprechen:<br />
I Flt3-ITD ist ein AML-spezifisches therapeutisches<br />
Target, welches eine prognostisch<br />
sehr ungünstige Subgruppe von AML-<br />
Patienten definiert.<br />
I Die therapeutischen Optionen und Prognose<br />
bei Rezidiv einer Flt3-ITD-positiven<br />
AML sind schlecht.<br />
I Das (Expressions-)Niveau von Flt3-ITD<br />
korreliert invers mit dem Überleben 10 .<br />
I Flt3-ITD-induzierte Transformation (u.a via<br />
Aktiverung von Akt) führt zu onkogener<br />
Abhängigkeit 11 . Im Leukämie-Xenograftmodell<br />
und in einer Phase I-Studie konnte<br />
gezeigt werden, dass eine Blockade von<br />
Flt3-ITD in Flt3-ITD-abhängigen, hämatopoetischen<br />
Vorläuferzellen zur potenten<br />
Apoptoseinduktion in vitro und in vivo<br />
führt7 .<br />
I Flt3-ITD ist offensichtlich für den Erhalt<br />
des malignen Phänotyps des AML-Klons<br />
notwendig, da 90% bis 100% der Flt3-<br />
ITD-positiven AML-Patienten auch im<br />
Rezidiv Flt3-ITD-positiv bleiben oder Flt3-<br />
ITD überexprimieren. Dies unterstreicht,<br />
dass die Flt3-ITD-Mutation eine die AML<br />
„treibende“ Aberration ist, die auch im<br />
fortgeschrittenen Verlauf der Erkrankung<br />
ein relevantes therapeutisches Zielmolekül<br />
sein sollte.<br />
The European Biotech Industry Guide 2009 Features:<br />
4 More than 2,000 Biotechnology Company Records<br />
4 Biotech Companies from the 27 EU Member States, Switzerland and Norway<br />
4 Research, Product, Platform Technology, and Service-based Core Enterprises<br />
4 All Company Addresses Recently Updated<br />
4 Condensed Description of Biotech Companies Activities<br />
4 Pharma, Agricultural, Environmental and Industrial Biotechnology<br />
4 Data Compliant with OECD Biotechnology Statistical Framework<br />
4 Contact Data of all European Biotech Company Associations<br />
4 With Foreword from European Biotechnology Network<br />
Therapieeffizienz von Sorafenib<br />
bei Flt3-ITD positiver AML<br />
Zhang et al. konnten in einer Phase I-Studie<br />
mit 16 AML-Patienten eine klinisch relevante<br />
Aktivität von Sorafenib in sechs von sieben<br />
Flt3-ITD-positiven AML-Patienten zeigen,<br />
nicht aber in Flt3-ITD-negativen AML7 . Die<br />
berichtete Therapiedauer war aber mit 21<br />
bis 70 Tagen kurz. Safaian et al. publizierten<br />
einen Fall mit extramedullärem Rezidiv<br />
einer Flt3-ITD- positiven AML. Hier führte<br />
Sorafenib zu einer kompletten molekularen<br />
Remission12 .<br />
ISBN 3-928383-28-8 I 98.00 Euro I www.biocom.de<br />
Ansprechen auf Sorafenib bei Flt3-ITDpositiven<br />
AML der Marburger Kohorte<br />
In der Marburger Kohorte von Patienten mit<br />
rezidivierter oder therapierrefraktärer Flt3-<br />
ITD-positiver AML konnte die therapeutische<br />
Effizienz von Sorafenib bei sechs Patienten<br />
auch nach langfristiger Einnahme (Median:<br />
81 Tage, Spanne: 13-221 Tage) belegt werden 13 .<br />
Es wurden insgesamt zwei Patienten vor, drei<br />
Patienten nach und ein Patient sowohl vor<br />
als auch nach allogener Stammzelltransplantation<br />
(SCT) mit Sorafenib-Monotherapie<br />
in einer Dosierung von 200mg bis 800mg<br />
täglich therapiert.<br />
Sorafenib vor allogener SCT<br />
Von den drei Patienten, die vor SCT behandelt<br />
worden waren, konnten im weiteren Verlauf<br />
zwei erfolgreich allogen transplantiert<br />
werden. Diese hatten zuvor unter Sorafenib-<br />
Monotherapie jeweils klinisch bedeutsame<br />
Remissionen erreicht, ohne dass eine Chemotherapie<br />
durchgeführt werden konnte.<br />
Wie exemplarisch in Abbildung 2 an Patient<br />
Nr. 5 zu ersehen, erfolgte das Sorafenib-<br />
Ansprechen rasch. Die unerwartet zügige<br />
periphere Blastendepletion – in diesem Fall<br />
auch verbunden mit einer partiellen peripheren<br />
Blutbildregeneration – war durchweg<br />
bei allen Patienten bereits innerhalb der<br />
Blitzlicht Klinische Entwicklung<br />
Fakten Europe<br />
kompakt! Guide 09<br />
European<br />
Biotechnology<br />
Guide<br />
Die komplette europäische Biotech-<br />
Branche Der BioTechnologie-Studienführer<br />
in einem praktischen<br />
Handbuch: bietet detaillierte Mehr als Informati- 2.000 Datensätzeonen<br />
über der in die den Studiengänge 27 Mitgliedstaaten an<br />
der 34 deutschen Europäischen Universitäten Union plus und der<br />
Schweiz Fachhochschulen, und Norwegen die Biotechnolo- aktiven<br />
Biotechnologie-Unternehmen gie in unterschiedlichen fachlichen nach<br />
OECD-Klassifizierung. Ausrichtungen und Schwerpunkten<br />
Vollständig<br />
neubearbeite anbieten, sowie Ausgabe zum trinationalen 2009 in<br />
Zusammenarbeit Studiengang Biotechnologie mit dem in<br />
European Straßburg. Biotechnology Network.<br />
Preis: 19,80 R<br />
2003 | ISBN 3-928383-16-7<br />
98,00 R<br />
06/2009 | ISBN 978-3-928383-28-8<br />
BIOCOM AG Verlag GmbH<br />
Stralsunder Str. 58-59<br />
13355 Berlin | Germany<br />
www.biocom.de<br />
service@biocom.de<br />
Tel. +49 (0)30/264921-40<br />
Fax +49 (0)30/264921-11<br />
LABORWElT 10. Jahrgang | Nr. 5/2009 | 21<br />
European Biotechnology Guide<br />
European<br />
Biotechnology<br />
Network<br />
Industry<br />
2009<br />
Volume 2<br />
European Biotechnology Industry Guide
Blitzlicht Klinische Entwicklung<br />
Abb. 2: Skizzierung der konventionellen Vortherapie und klinisches Ansprechen einer Flt3-<br />
ITD-positiven, Chemotherapie-refraktären Patientin auf die Sorafenib-Monotherapie.<br />
Unten: Sorafenib führt innerhalb kurzer Zeit zu einer deutlichen Erholung des peripheren<br />
Blutbildes. (Bestrahlung (roter Blitz), komplette molekulare Remission (grüne<br />
Kreise), C-(Cytarabin), ICE (2. Induktion nach ICE-Schema); + (allogene Stammzelltransplantation),<br />
roter Kreis: hämatologisches Rezidiv, FLAMSA - Rezidivtherapieprotokoll<br />
ersten sieben Therapietage zu beobachten.<br />
Dies bestätigte in vivo die bereits in vitro<br />
zu beobachtende Sensitivität von Flt3-ITD<br />
gegenüber Sorafenib 7 . Intrazelluläre Messungen<br />
der Aktivierung des Flt3-ITD Substrates<br />
Stat-5 bei Patient Nr. 5 zeigen zudem, dass<br />
Sorafenib die Flt3-ITD-Signaltransduktion<br />
schon innerhalb von Stunden nach Erstgabe<br />
und auch anhaltend danach hinreichend<br />
blockiert (Abb. 2).<br />
Sorafenib nach allogener SCT<br />
Vier der sechs Marburger Patienten erlitten<br />
ein hämatologisches Rezidiv nach allogener<br />
SCT. Für diese Patientengruppe gibt es nur<br />
sehr limitierte therapeutische Optionen,<br />
zumal wenn vor Rezidiv bereits eine chronische<br />
„graft versus host“ (GvH)-Erkrankung<br />
vorlag.<br />
Zwei der vier Marburger Patienten erreichten<br />
in dieser Situation unter Sorafenib eine<br />
anhaltende komplette molekulare Remission.<br />
Die beiden anderen Patienten überlebten<br />
jeweils 211 und 221 Tage, wobei nur bei einem<br />
dieser Patienten eine Sorafenib-Resistenz<br />
nachgewiesen wurde. Hervorzuheben ist,<br />
dass es bei drei der vier Patienten unter Sorafenib<br />
zu einem ansteigenden Spenderchimärsimus<br />
kam, was mit dem Wiederaufflammen<br />
einer milden GvH-Erkrankung verbunden war.<br />
Dieser klinische Verlauf deutet darauf hin,<br />
dass Sorafenib keine ausgeprägten immunsuppressiven<br />
Eigenschaften hat und somit im<br />
therapeutischen Kontext einer SCT synergis-<br />
www.laborwelt.de<br />
tische Wirkungen durch die Kooperation mit<br />
einer „graft versus leukemia“ (GvL)-Reaktion<br />
zu erwarten sein können. Vergleichbare Erfahrungen<br />
existieren bereits für Imatinib bei<br />
BCR/ABL-positiven Leukämien.<br />
Fazit<br />
Der Stellenwert einer Sorafenib-Monotherapie<br />
in der Behandlung der Flt3-ITD-<br />
positiven AML ist derzeit noch nicht klar<br />
definiert. Basierend auf den vorliegenden<br />
Daten könnte Sorafenib allerdings bereits<br />
heute für bestimmte Patienten mit Flt3-ITDpositiver<br />
AML vor oder nach allogener SCT<br />
eine klinisch interessante therapeutische<br />
Alternative darstellen. Hierzu gehören Patienten,<br />
bei denen intensive Therapieverfahren<br />
nicht durchführbar sind oder Chemotherapierefraktäre<br />
Patienten, bei denen der Zeitraum<br />
bis zur Durchführung einer allogenen SCT<br />
überbrückt werden muss. Sorafenib könnte<br />
aber auch schon früher, zur Verhinderung<br />
eines Rezidivs eingesetzt werden.<br />
Die Begündung für dieses Vorgehen wäre<br />
ein angenommener optimaler Synergismus<br />
zwischen Sorafenib und GvL-Effekt, da sich<br />
letzterer auf der Basis minimaler Resterkrankung<br />
besser etablieren kann. Eine randomisierte<br />
klinische Studie zur Überprüfung<br />
dieses Konzepts befindet sich derzeit in<br />
Vorbereitung.<br />
In Deutschland wird aktuell die Kombination<br />
von Chemotherapie mit Sorafenib oder<br />
anderen Flt3-Inhibitoren wie Midostaurin<br />
(PKC412) in Phase II- und III-Studien unter Leitung<br />
von Prof. Dr. Hubert Serve (Uniklinikum<br />
Frankfurt) und Prof. Dr. Gerhard Ehninger<br />
(Uniklinikum Dresden) bei Patienten mit und<br />
ohne Flt3-ITD-Mutation getestet. Diese Studien<br />
werden dazu beitragen, den Stellenwert<br />
einer Flt3-Inhibition zusätzlich zur Standardchemotherapie<br />
in der Erstlinienbehandlung<br />
von AML-Patienten besser zu definieren.<br />
Literatur<br />
[1] Appelbaum FR, Rosenblum D, Arceci RJ, et al: End points<br />
to establish the efficacy of new agents in the treatment of<br />
acute leukemia. Blood 109:1810-6, 2007<br />
[2] Rombouts WJ, Blokland I, Lowenberg B, et al: Biological<br />
characteristics and prognosis of adult acute myeloid leukemia<br />
with internal tandem duplications in the Flt3 gene.<br />
Leukemia 14:675-83, 2000<br />
[3] Kottaridis PD, Gale RE, Frew ME, et al: The presence of a<br />
FLT3 internal tandem duplication in patients with acute<br />
myeloid leukemia (AML) adds important prognostic information<br />
to cytogenetic risk group and response to the first<br />
cycle of chemotherapy: analysis of 854 patients from the<br />
United Kingdom Medical Research Council AML 10 and 12<br />
trials. Blood 98:1752-9, 2001<br />
[4] Thiede C, Steudel C, Mohr B, et al: Analysis of FLT3-activating<br />
mutations in 979 patients with acute myelogenous<br />
leukemia: association with FAB subtypes and identification<br />
of subgroups with poor prognosis. Blood 99:4326-35,<br />
2002<br />
[5] Gale RE, Hills R, Kottaridis PD, et al: No evidence that FLT3<br />
status should be considered as an indicator for transplantation<br />
in acute myeloid leukemia (AML): an analysis of<br />
1135 patients, excluding acute promyelocytic leukemia,<br />
from the UK MRC AML10 and 12 trials. Blood 106:3658-<br />
65, 2005<br />
[6] Bornhauser M, Illmer T, Schaich M, et al: Improved outcome<br />
after stem-cell transplantation in FLT3/ITD-positive<br />
AML. Blood 109:2264-5; author reply 2265, 2007<br />
[7] Zhang W, Konopleva M, Shi YX, et al: Mutant FLT3: a<br />
direct target of sorafenib in acute myelogenous leukemia.<br />
J Natl Cancer Inst 100:184-98, 2008<br />
[8] Llovet JM, Ricci S, Mazzaferro V, et al: Sorafenib in advanced<br />
hepatocellular carcinoma. N Engl J Med 359:378-90,<br />
2008<br />
[9] Knapper S: FLT3 inhibition in acute myeloid leukaemia. Br<br />
J Haematol 138:687-99, 2007<br />
[10] Gale RE, Green C, Allen C, et al: The impact of FLT3<br />
internal tandem duplication mutant level, number, size,<br />
and interaction with NPM1 mutations in a large cohort of<br />
young adult patients with acute myeloid leukemia. Blood<br />
111:2776-84, 2008<br />
[11] Brandts CH, Sargin B, Rode M, et al: Constitutive activation<br />
of Akt by Flt3 internal tandem duplications is necessary<br />
for increased survival, proliferation, and myeloid transformation.<br />
Cancer Res 65:9643-50, 2005<br />
[12] Safaian NN, Czibere A, Bruns I, et al: Sorafenib (Nexava ® )<br />
induces molecular remission and regression of extramedullary<br />
disease in a patient with FLT3-ITD(+) acute myeloid<br />
leukemia. Leuk Res 33:348-50, 2009<br />
[13] Metzelder S, Wang Y, Wollmer E, et al: Compassionate-use<br />
of sorafenib in Flt3-ITD positive acute myeloid leukemia:<br />
sustained regression prior and post allogenic stem cell<br />
transplantation. Blood, 2009<br />
Danksagung<br />
Dr. Burchert und Dr. Neubauer werden durch die DFG, die Deutsche<br />
José Carreras Leukämiestiftung und einen Grant der UKGM<br />
GmbH unterstützt.<br />
Korrespondenzadresse<br />
PD Dr. med. Andreas Burchert<br />
Philipps-Universität Marburg<br />
Klinik für Hämatologie, Onkologie und<br />
Immunologie<br />
35043 Marburg<br />
Tel.: +49-(0)6421-586 5611<br />
Fax: +49-(0)6421-586 5613<br />
burchert@staff.uni-marburg.de<br />
22 | 10. Jahrgang | Nr. 5/2009 LABORWElT
Blitzlicht DNA-Methylierung<br />
BEAMing: Sensitive<br />
Plasmadiagnostik in<br />
der Onkologie<br />
Wiebke Peters, Dr. Philipp Angenendt und Dr. Frank Diehl, Inostics GmbH, Hamburg<br />
Pro Jahr erkranken rund 3,2 Millionen Menschen in Europa an Krebs – am häufigsten sind die<br />
Lunge und der Dickdarm betroffen 1 . Krebs ist trotz heutiger Behandlungsmöglichkeiten eine<br />
Krankheit mit oft tödlichem Ausgang. Die Situation ließe sich dramatisch verbessern, wenn<br />
die Krankheit im Frühstadium entdeckt würde und die Behandlung besser auf den jeweiligen<br />
Patienten abgestimmt werden könnte. Neben neuartigen bildgebenden Verfahren werden<br />
daher zunehmend in vitro-Diagnostikansätze verfolgt, die auf der Analyse tumorspezifischer<br />
genetischer und epigenetischer Marker im Blutplasma basieren. Im Unterschied zu etablierten<br />
Diagnostikverfahren wird von den zielgerichteten molekularen Markern eine bessere<br />
klinische Sensitivität und Spezifität sowie eine molekulare Charakterisierung des Tumors<br />
für verbesserte Therapieentscheidungen erwartet. BEAMing ist eine neue Technologie, mit<br />
der kleinste Mengen an tumorspezifischer DNA in Blutplasma quantitativ gemessen werden<br />
können 2 . Dies ermöglicht es, Tumore in einem frühen Stadium nicht-invasiv zu detektieren<br />
und unmittelbar den Behandlungserfolg einer Therapie abzuschätzen.<br />
Die Erforschung der molekularen Grundlagen<br />
der Tumorentstehung hat dazu geführt, dass<br />
heute neue diagnostische Markerstrategien<br />
entwickelt werden können. Diese bieten die<br />
Möglichkeit, Tumorerkrankungen bereits in<br />
einer frühen – und damit für die Heilung besten<br />
Phase – zu entdecken. Weiterhin konnte<br />
gezeigt werden, dass ein Zusammenhang<br />
zwischen molekularen Eigenschaften der Tumoren<br />
und dem Behandlungserfolg besteht,<br />
was zunehmend eine Personalisierung der<br />
Arzneimitteltherapie ermöglicht. Einer der<br />
spezifischsten Tumormarker ist die Veränderung<br />
der DNA-Sequenz, wie zum Beispiel<br />
somatische Punktmutationen in Genen, die<br />
direkt für die Entstehung von Krebs verantwortlich<br />
sind. Weiterhin rückt die Entwicklung<br />
von diagnostischen Tests auf Grundlage<br />
von Blutplasma in den Fokus, da Blut einfach<br />
und wiederholt gewonnen werden kann. Die<br />
Detektion mutierter DNA-Moleküle im Blut<br />
erscheint daher als außerordentlich attraktiver<br />
diagnostischer Ansatz in der Onkologie.<br />
Bisher gestaltete sich die praktische Anwendung<br />
dieser Strategie allerdings schwierig, da<br />
hierfür analytische Verfahren mit hoher Sensitivität<br />
und Selektivität benötigt werden.<br />
BEAMing-Technologie<br />
Die BEAMing-Technologie ist eine hochsensitive<br />
quantitative Technologie, die kleinste<br />
Mengen mutierter oder methylierter DNA<br />
www.laborwelt.de<br />
nachweisen kann, die zuvor vom Tumor in<br />
das Blut abgegeben wurden und dort zirkulieren<br />
3,5 . Die Abkürzung BEAMing steht dabei für<br />
die Komponenten des Assays: Beads, Emulsion,<br />
Amplification und Magnetics. Es handelt<br />
sich bei dem Verfahren um eine gezielte Amplifikation<br />
von DNA-Einzelmolekülen auf der<br />
Oberfläche von magnetischen Mikropartikeln<br />
(Beads) in einer Wasser-in-Öl-Emulsion 3 . Das<br />
Resultat einer BEAMing-Reaktion ist somit<br />
die Umwandlung einzelner DNA-Moleküle in<br />
fluoreszierende Mikropartikel, welche mit Hilfe<br />
der Durchflusszytometrie detektiert und<br />
quantifiziert werden können. Der entscheidende<br />
Amplifikationsschritt findet in den<br />
Wassertröpfchen einer Emulsion statt und<br />
kann somit millionenfach mit geringstem<br />
Reagenzienverbrauch durchgeführt werden.<br />
Dieser Ansatz ermöglicht heute eine Miniaturisierung,<br />
bei der statt einer Reaktion pro<br />
Gefäß mehr als 10 8 PCR-Reaktionen gleichzeitig<br />
möglich sind. BEAMing ermöglicht eine<br />
unabhängige Analyse der DNA-Sequenz, bei<br />
der die techniche Sensitivität lediglich von<br />
der Anzahl der eingesetzten DNA-Moleküle<br />
abhängt. In der Anwendung hat sich eine<br />
Sensitivität von 0.01%, das heißt dem Nachweis<br />
von einem mutierten oder methylierten<br />
DNA-Molekül in der Gegenwart von 10.000<br />
Wildtyp-DNA-Fragmenten, als praktisch<br />
erwiesen.<br />
Die Detektion von Mutationen im Blutplasma<br />
auf Basis der BEAMing-Technologie lässt<br />
sich in mehrere Arbeitsschritte unterteilen<br />
(Abb. 1 A):<br />
Probenvorbereitung & Präamplifikation: Jede<br />
Analyse beginnt mit der DNA-Isolierung aus<br />
Blutplasma oder anderen klinischen Proben.<br />
Gehen Sie auf<br />
Nummer Sicher!<br />
Bei der Analyse von<br />
Biomarkern müssen Sie sich<br />
auf Ihre Daten verlassen können.<br />
WideScreen Biomarker Assay Kits,<br />
basierend auf Luminex ® xMAP ®<br />
Plattform, sind umfangreich<br />
validiert und getestet –<br />
verlassen Sie sich darauf!<br />
LABORWElT 10. Jahrgang | Nr. 5/2009 | 23<br />
ht<br />
Novagen ®<br />
Sind meine Biomarker-Daten<br />
wirklich aussagekräftig?<br />
www.merckbio.eu/<br />
widescreen<br />
Für weitere Informationen oder ein<br />
Angebot kontaktieren Sie bitte<br />
Ihren Ansprechpartner vor Ort<br />
www.merckbio.eu/AccountManager<br />
oder unser Team vom<br />
Technischen Service<br />
Tel: 0800 100 3496 (gebührenfrei)<br />
techservice@merckbio.eu<br />
www.merckbio.eu
Blitzlicht DNA-Methylierung<br />
Hierbei kann die Menge des Startmaterials<br />
stark schwanken. Studien haben gezeigt,<br />
dass sich in einem Milliliter Plasma zwischen<br />
4 ng und 750 ng frei zirkulierender humaner<br />
genomischer DNA befinden kann 2 . Nach der<br />
DNA-Isolierung wird die zu untersuchende<br />
DNA-Region mit Hilfe einer konventionellen<br />
PCR amplifiziert. Dieser Schritt ermöglicht<br />
die Anreicherung der DNA-Moleküle und<br />
zugleich die Einführung von universellen Tag-<br />
Sequenzen, welche die weiteren Arbeitsschritte<br />
vereinfachen.<br />
Emulsions-PCR: Die DNA der Präamplifikation<br />
wird verdünnt und dient als Ausgangsmaterial<br />
für die Emulsions-PCR. Der PCR-Ansatz enthält<br />
die Komponenten einer konventionellen PCR<br />
(z.B. Nukleotide, Polymerase), ein spezielles<br />
Öl-Emulgator-Gemisch sowie magnetische<br />
A B<br />
Mikropartikel, an die ebenfalls universelle<br />
Tag-Sequenzen gekoppelt sind. Die wässrige<br />
Phase wird mit dem Öl emulgiert, so dass Millionen<br />
einzelner Wassertröpfchen mit einem<br />
Durchmesser von 3µm bis 10 µm einen Reaktionsraum<br />
für separate PCR-Reaktionen bilden<br />
(Abb. 1 B). In den Wassertröpfchen befindet<br />
sich statistisch nur ein einzelnes DNA-Molekül<br />
und ein magnetisches Partikel. Während der<br />
Reaktion werden die einzelnen DNA-Moleküle<br />
in den Tropfen auf der Partikeloberfläche mit<br />
Hilfe der gekoppelten Tag-Sequenzen vervielfältigt<br />
(Abb. 1 C).<br />
Hybridisierung: Nach der PCR wird die Wasser-<br />
und Ölphase wieder getrennt, so dass<br />
sich die Mikropartikel in der wässrigen Phase<br />
befinden. Mit Hilfe einer sequenzspezifischen<br />
Hybridisierung mit fluoreszenzmarkierten<br />
Abb. 1: A: Schematische Darstellung der BEAMing-Technologie. B: Lichtmikroskopische Aufnahme<br />
von Wasser-in-Öl-Emulsionen mit magnetischen Mikropartikeln (Durchmesser<br />
1 µm) C: Schematische Darstellung der DNA-Amplifikation auf der Oberfläche eines<br />
magnetischen Mircopartikels D: Durchflusszytometer-Diagramm einer Patientenprobe<br />
mit Mutationen (rote Partikel)<br />
C<br />
D<br />
DNA-Sonden wird die auf dem Mikropartikel<br />
gebundene DNA markiert. Das Ergebnis der<br />
Hybridisierung sind Partikel, die – je nach<br />
Mutationsstatus – mit einem der beiden Farbstoffe<br />
markiert sind. Die Analyse der Mikropartikel<br />
erfolgt mit einem Durchflusszytometer,<br />
das mehrere tausend Partikel pro Sekunde<br />
quantifizieren kann (Abb. 1 D). Die Anzahl der<br />
gemessenen Partikel entspricht somit der<br />
Häufigkeit der Wildtyp- und Tumor-DNA in<br />
der Plasmaprobe.<br />
Da Tumore je nach Stadium und Ursprungsorgan<br />
ein spezielles Mutationsspektrum<br />
aufweisen, ist die Entwicklung verschiedener<br />
Plasmatests erforderlich. Für häufig mutierte<br />
Gene, wie PIK3CA, BRAF, KRAS, TP53 und APC<br />
stehen bereits BEAMing-Assays zur Verfügung.<br />
Die offene Architektur der BEAMing-Technologie<br />
ermöglicht eine schnelle Etablierung weiterer<br />
Mutations- und Methylierungstests.<br />
Anwendung der BEAMing-Technologie<br />
in der Onkologie<br />
Die sensitive Detektion somatischer Mutationen<br />
in Blutplasma und anderem klinischen<br />
Probenmaterial mit der BEAMing-Technologie<br />
kann zur Entwicklung neuartiger in vitro-<br />
Diagnostika in der Onkologie genutzt werden.<br />
Schwerpunktmäßig könnten Bluttests im<br />
Bereich der Versorgung von Krebspatienten<br />
nach erfolgter Diagnose eingesetzt werden.<br />
Dabei lassen sich verschiedene klinische Anwendungsgebiete<br />
unterscheiden (Abb. 2).<br />
Therapieauswahl<br />
Es ist bekannt, dass zielgerichtete molekulare<br />
Krebstherapeutika nur in relativ kleinen Patientengruppen<br />
effizient wirken. Die Schwierigkeit<br />
bei der routinemäßigen Verwendung und<br />
Entwicklung dieser Medikamente ist deshalb,<br />
die geeigneten Patientenpopulationen vorab<br />
auszuwählen. Für einige Krebsarten wurden<br />
bereits bestimmte DNA-Mutationen entdeckt,<br />
die zur Patientenauswahl dienen. So sind<br />
therapeutische Antikörper wie Erbitux® oder<br />
Vectibix® nur wirksam bei Patienten mit dem<br />
KRAS-Wildtyp-Gen. In der Praxis ist ein solcher<br />
Nachweis für einen Teil der Patienten schwierig,<br />
da der Mutationsnachweis bis vor kurzem<br />
nur an Tumorgewebe selbst durchgeführt werden<br />
konnte, die Gewinnung des Tumorgewebes<br />
durch Biopsie oder operativen Eingriff aber<br />
mit Risiken und erheblichen Kosten verbunden<br />
ist. Ein prädiktiver Bluttest eröffnet hier eine<br />
bessere Patientenversorgung.<br />
Therapieverlauf<br />
Im Verlauf einer Behandlung könnte mit BEAMing<br />
auch bestimmt werden, ob eine Therapie<br />
erfolgreich ist, ob also die Tumorzellen durch<br />
24 | 10. Jahrgang | Nr. 5/2009 LABORWElT
Abb.2: Anwendungsgebiete der BEAMing-Technologie in der Onkologie: Therapieauswahl,<br />
Therapieverlauf und Nachsorge<br />
das Medikament selektiv absterben. Diese Erkenntnisse<br />
würden – falls erforderlich – einen<br />
schnelleren Therapiewechsel ermöglichen oder<br />
die Entwicklung neuer Behandlungsmethoden<br />
beschleunigen. In einer Studie mit 18 Darmkrebspatienten<br />
konnte bereits gezeigt werden,<br />
dass die Menge der Tumor-DNA im Blut mit der<br />
Größe und Invasivität des Tumors korreliert 4 . In<br />
diesen Patienten lag die Anzahl deer mutierten<br />
DNA-Moleküle zwischen 1 und 1833 (Median<br />
39). Dies bildet den Ausgangspunkt für weitere<br />
Studien, um den Nutzen dieser Art von Plasmadiagnostik<br />
zu evaluieren.<br />
Nachsorge<br />
Ziel der Krebs-Nachsorgeuntersuchungen ist<br />
es, einen wiederauftretenden Tumor möglichst<br />
früh zu erkennen, so dass therapeutisch<br />
eingegriffen werden kann. Mit der BEAMing-<br />
Technologie könnten im Rahmen der Nachsorge<br />
nicht entfernter Resttumor oder kleinste<br />
wiederkehrende Metastasen nachgewiesen<br />
werden.<br />
In Patienten mit metastasiertem Kolonkarzinom<br />
konnte dies bereits gezeigt werden 4 . So<br />
konnte wenige Wochen nach einer Behandlung<br />
in 15 von 16 Fällen (94%) ein Wiederauftreten<br />
der Tumorerkrankung vorhergesagt<br />
werden. Denkbar ist ebenfalls, dass BEAMing<br />
in der Früherkennung über eine regelmäßige<br />
Blutabnahme Krebserkrankungen schon vor<br />
dem Auftreten klinischer Symptome detektiert.<br />
Diese frühen Tumore könnten dann<br />
durch einen operativen Eingriff entfernt<br />
werden. Neben der Blutplasmadiagnostik ist<br />
– beispielsweise beim Kolonkarzinom – auch<br />
die Anwendung von BEAMing auf Stuhlproben<br />
möglich 5,6 .<br />
Abschließend lässt sich sagen, dass BEAMing<br />
neue Wege in der Krebsdiagnostik eröffnet. Es<br />
ist eine nicht-invasive Detektion von Tumoren<br />
unterschiedlicher Organe über das Blutplasma<br />
möglich. Des Weiteren eignet sich das<br />
Verfahren zur begleitenden Diagnostik bei<br />
Krebstherapien, da die Wirksamkeit von Therapieansätzen<br />
schnell abgeschätzt, und die<br />
Therapie gegebenenfalls angepasst werden<br />
kann. All diese Ansätze verfolgen das Ziel, die<br />
Krebsbehandlung effektiver und kostengünstiger<br />
zu machen, so dass die Mortalitätsrate<br />
in Zukunft gesenkt werden kann.<br />
Literatur<br />
[1] Coleman M.P., Alexe D.M., Albreht T., McKee, M., Institute<br />
of Public Health of the Republic of Slovenia (2008)<br />
www.euro.who.int/Document/E91137.pdf<br />
[2] Diehl F., Li M., Dressman D., He Y., Shen D., Szabo S.,<br />
Diaz L.A. Jr, Goodman S.N., David K.A., Juhl H., Kinzler<br />
K.W., Vogelstein B., PNAS 102 (2005), 16368-16373.<br />
[3] Dressman D., Yan H., Traverso G., Kinzler K.W., Vogelstein<br />
B., PNAS 100 (2003), 8817-8822.<br />
[4] Diehl F., Schmidt K., Choti M.A., Romans K., Goodman<br />
S., Li M., Thornton K., Agrawal N., Sokoll L., Szabo S.A.,<br />
Kinzler K.W., Vogelstein B., Diaz L.A. Jr., Nature Medicine<br />
14 (2008), 985-990.<br />
[5] Li M., Chen W.D., Papadopoulos N., Goodman S.N.,<br />
Bjerregaard N.C., Laurberg S., Levin B., Juhl H., Arber N.,<br />
Moinova H., Durkee K., Schmidt K., He Y., Diehl F., Velculescu<br />
V.E., Zhou S., Diaz L.A. Jr, Kinzler K.W., Markowitz<br />
S.D., Vogelstein B., Nature Biotechnology (2009) 21,<br />
858-863<br />
[6] Diehl F., Schmidt K., Durkee K.H., Moore K.J., Goodman<br />
S.N., Shuber A.P., Kinzler K.W., Vogelstein B. Gastroenterology<br />
135 (2008), 489-498.<br />
Korrespondenzadresse<br />
Next generation<br />
sequencing<br />
applying the<br />
Roche GS FLX<br />
TITANIUM Technology<br />
Dr. Frank Diehl<br />
Inostics GmbH<br />
Falkenried 88<br />
AGOWA genomics<br />
www.laborwelt.de<br />
20251 Hamburg<br />
Tel.: +49-(0)40-41 33 83 90<br />
Fax: +49-(0)40-41 33 83 94<br />
diehl@inostics.com<br />
AGOWA GmbH (part of LGC)<br />
Tel: +49 (0)30 5304 2260<br />
Email: ngs@agowa.de<br />
Web: www.lgc.co.uk/genomics<br />
LABORWElT No part of this publication may be reproduced or transmitted 10. in any Jahrgang form or by any means, | Nr. electronic 5/2009 or mechanical, | 25 including photocopy-<br />
035/1.09-2009-08<br />
Service features:<br />
• De novo sequencing of genomes<br />
• Finishing of de novo sequencing<br />
• Analysis of:<br />
- metagenomes<br />
- transcriptomes / normalised cDNA<br />
- methylation patterns<br />
- pools of tagged fosmids and BACs<br />
• Targeted re-sequencing<br />
• ChIP and ncRNA sequencing<br />
• Sequence enrichment<br />
Visit us at<br />
BIOTECHNICA 2009<br />
at booth F19 in hall 9.<br />
ing, recording or any retrieval system, without the written permission of the copyright holder. © LGC Limited, 2009. All rights reserved.<br />
Picture: Museum Wiesbaden and Kevin Clarke, The Invisible Body, Wiesbaden 1999 (Portrait of Miguel Algarin, page 28)
Blitzlicht Proteomics<br />
Detektion neuer Tumorassoziierter<br />
Biomarker<br />
des Pankreaskarzinoms<br />
Dr. Georg Martin Fiedler, Dr. Alexander Leichtle, Dr. Uta Ceglarek und Prof. Dr. Joachim Thiery,<br />
Institut für Laboratoriumsmedizin, Klinische Chemie und Molekulare Diagnostik,<br />
Universität Leipzig<br />
Das Pankreaskarzinom ist eine Tumorerkrankung mit sehr schlechter Prognose und fehlender<br />
Möglichkeit einer frühzeitigen serologischen Diagnostik. Die Proteom- und Peptidomanalytik<br />
eröffnet neue Möglichkeiten, Biomarker zu entdecken. Voraussetzung dafür sind jedoch die<br />
Standardisierung der Präanalytik, eine sensitive Analytik und neue leistungsfähige Verfahren der<br />
Bioinformatik. Unter Berücksichtigung dieser Vorbedingungen gelang uns in einer klinischen Studie<br />
der Nachweis des Plättchenfaktors 4 (PF4) als neuem Biomarker für das Pankreaskarzinom.<br />
Abb. 1: Studiendesign; modifiziert nach Fiedler et al. (2009) 10<br />
Die rasante Entwicklung der Peptidomanalytik<br />
mit Hilfe massenspektrometrischer<br />
Verfahren eröffnet neue Perspektiven für die<br />
Identifikation krankheitsassoziierter Zielmoleküle<br />
und Aufklärung von Signalkaskaden 1 .<br />
Allerdings stellen die Dynamik des Proteoms,<br />
komplexe Matrixeffekte und der weite Konzentrationsbereich<br />
der Proteine im Blut und<br />
anderen humanen Untersuchungsproben<br />
besondere Anforderungen an die Analytik 2 .<br />
Darüber hinaus sind neue bioinformatische<br />
Methoden der Datenanalyse sowie spezielle<br />
Studienplanungen erforderlich, um aus den<br />
umfangreichen Proteom- und Peptidomdaten<br />
medizinisch nutzbare Ergebnisse zu gewinnen<br />
sowie die Probleme des „multiplen Testens“<br />
und der „Falsch-positiven“ zu reduzieren 3 .<br />
Wir haben uns daher in den vergangenen<br />
Jahren zunächst auf systematische Untersu-<br />
chungen zu Störfaktoren und Einflussgrößen<br />
der Peptidomanalytik unterschiedlicher humaner<br />
Untersuchungsproben konzentriert.<br />
Die Untersuchungen führten wir mit der<br />
Matrix-assistierten Laserdesorptions/Ionisations-Time-of-Flight-Massenspektrometrie<br />
(MALDI-TOF-MS) nach Vorfraktionierung mit<br />
Magnetpartikeln unterschiedlicher Oberflächenfunktionalitäten<br />
(MB-HIC C8, MB-<br />
IMAC Cu und MB-WCX) durch. Auf der Basis<br />
dieser detaillierten Untersuchungen konnten<br />
wir erstmals standardisierte präanalytische<br />
Vorgaben für die Gewinnung, Aufarbeitung<br />
und Lagerung von Patientenproben erstellen,<br />
um die Validität und Reproduzierbarkeit<br />
klinischer Befunde sicherzustellen 4-7 . In<br />
Kooperation mit dem Institut für Mathematik<br />
II der Freien Universität Berlin (Gruppe<br />
Prof. Schütte, DFG Forschungszentrum für<br />
Mathematik „Matheon“) und mit Microsoft<br />
Research (Cambridge, UK) haben wir zudem<br />
eine neue Analysesoftware für die Auswertung<br />
von Proteombefunden entwickelt<br />
(„Proteomics.net“, www.msproteomics.net) 8 .<br />
Die Analysesoftware zeichnet sich durch eine<br />
besonders sensitive Detektion einzelner Kandidatenpeaks<br />
aus. Sie bietet die Möglichkeit<br />
der statistischen Evaluation anhand verschiedener<br />
Peakfeatures.<br />
Pankreaskarzinom<br />
Unsere Vorarbeiten bilden eine wesentliche<br />
Voraussetzung für die nachfolgenden klinischen<br />
Peptidomanalysen. In einer von uns<br />
initiierten klinischen Studie mit den Chirurgischen<br />
Universitätskliniken Leipzig und<br />
Heidelberg fokussierten wir uns zunächst auf<br />
die Serum-Peptidomanalytik von Patienten<br />
mit Pankreaskarzinom. Hierbei handelt es<br />
sich um eine der bösartigsten soliden Tumorerkrankungen<br />
des Gastrointestinaltraktes. In<br />
Deutschland macht das Pankreaskarzinom<br />
etwa 3% aller Krebserkrankungen aus. Eine<br />
Heilungschance besteht nur, wenn der oft<br />
lange symptomfreie Tumor in einem sehr<br />
frühen Stadium erkannt und vollständig<br />
operativ entfernt werden kann. Daher liegt<br />
die 5-Jahres-Überlebensrate unter 8%.<br />
Tumormarker der ersten Wahl beim Pankreaskarzinom<br />
ist das „Carbohydrate Antigen<br />
19-9“ (CA 19-9). Die Sensitivität für den<br />
Nachweis eines Pankreaskarzinoms wird<br />
in der Literatur für CA 19-9 jedoch mit nur<br />
67-92%, die Spezifität mit 68-92% angegeben<br />
9 . Tumormarker der zweiten Wahl ist<br />
das „Carcino embryonale Antigen (CEA)“, das<br />
gegenüber CA 19-9 eine noch geringere Sensitivität<br />
und Spezifität aufweist 9 . Aufgrund<br />
dieser für diag nostische Zwecke zu geringen<br />
Sensitivität und Spezifität sind CA 19-9 und<br />
CEA nicht in der Lage, als Einzelmarker oder<br />
in Kombination bestimmte Tumorformen<br />
exakt zu diagnostizieren und Frühstadien<br />
der Tumore präzise nachzuweisen. Diese<br />
aktuell unzureichenden labormedizinischen<br />
Möglichkeiten zur serologischen Diagnose<br />
des Pankreaskarzinoms erhöhen den Druck,<br />
neue valide Biomarker zu entwickeln. Da die<br />
Mehrzahl der heute in der Routinediagnostik<br />
verwendeten Tumormarker aus der Gruppe<br />
der Proteine stammt, besteht die Hoffnung,<br />
dass mit Hilfe gezielter Proteom- oder Peptidomanalysen<br />
neue krankheitsassoziierte<br />
Biomarker für eine präzise und frühzeitige<br />
Diagnose des Pankreaskarzinoms gefunden<br />
werden können 1 .<br />
Klinische Peptidomanalytik am<br />
Beispiel des Pankreaskarzinoms<br />
Im Rahmen einer klinischen Studie (Abb. 1)<br />
wurden in einer !Discovery-Studie“ mittels<br />
26 | 10. Jahrgang | Nr. 5/2009 LABORWElT
© 2009 PerkinElmer, Inc. 400169_01. All trademarks or registered trademarks are the property of PerkinElmer, Inc. and/or its subsidiaries.<br />
CATALOG<br />
AND<br />
CUSTOM*<br />
GLOBAL<br />
DELIVERY<br />
Image Area<br />
This is your home for NEN® radiochemicals and radionuclides. Made in the USA<br />
and delivered around the globe, our NEN radiochemicals arrive safely in our exclusive<br />
NENSure packaging. Also, with over fifty years of experience in labeling technologies,<br />
we can label virtually any biomolecule. Every day, we prove our commitment to you<br />
with reliable performance, dependable product availability and proven leadership.<br />
Visit us online to order custom, catalog and countless other radiometric products.<br />
www.perkinelmer.com/nenradiochemicals<br />
TRUSTED<br />
NENSURE<br />
PACKAGING<br />
*GMP Radiosynthesis services available. Visit www.perkinelmer.com/customsynthesis to learn more.<br />
NEN RADIOCHEMICALS<br />
50 YEARS<br />
AND COUNTING<br />
MADE IN<br />
THE USA
Blitzlicht Proteomics<br />
www.laborwelt.de<br />
MB-MALDI-TOF-MS (Bruker Daltonik, Bremen)<br />
die Serumpeptidomprofile von Patienten<br />
mit Pankreaskarzinom (p) und gesunden<br />
Kontrollprobanden (c) aus den Chirurgischen<br />
Universitätskliniken Leipzig (Prof. Dr. J. Hauss)<br />
(A) und Heidelberg (Prof. Dr. Dr. hc M. Büchler)<br />
(B) zunächst direkt (Ap nach Ac (roter<br />
Pfeil) bzw. Bp nach Bc (oranger Pfeil) und<br />
dann verschränkt (Ap nach Bc (blauer Pfeil)<br />
bzw. Bp nach Ac (grüner Pfeil) mit Hilfe von<br />
„proteomics.net“ analysiert und miteinander<br />
verglichen. Der verschränkte Vergleich hatte<br />
zum Ziel, frühzeitig ein „Overfitting“ auf<br />
Spezifika der Studienzentren zu vermeiden<br />
und damit die Rate der „Falsch-positiven“ zu<br />
reduzieren.<br />
Abb. 2: ROC-Kurven für das Modell aus den<br />
Tumormarkern CA19-9 und CEA<br />
(blaue Linie) sowie deren Kombination<br />
mit dem Kandidatenpeak<br />
m/z 3884 („Area under the ROC“,<br />
AUROC=0,983, rote Linie) für das Gesamtkollektiv<br />
(n=120).<br />
Das Ergebnis der Discovery-Studie waren<br />
Massenpeaks, die eine signifikante Trennung<br />
der Serumproben von Patienten und<br />
Gesunden in den vier Gruppenvergleichen<br />
ermöglichten.<br />
Die Massenpeaks, die in allen Gruppenvergleichen<br />
(Ap nach Ac, Bp nach Bc sowie<br />
Ap nach Bc, Bp nach Ac) als signifikant trennendes<br />
Merkmal auftraten (exemplarisch<br />
dargestellt als „Diskriminator D“) wurden<br />
anschließend im Rahmen der „externen<br />
Validation“ an unabhängig und ebenfalls<br />
standardisiert gesammelten Serumproben<br />
von Patienten mit Pankreaskarzinom und gesunden<br />
Kontrollprobanden der Chirurgischen<br />
Universitätsklinik Leipzig (C) allein und in<br />
Kombination mit den etablierten Tumormarkern<br />
CA 19-9 und CEA mittels ROC-Analysen<br />
auf ihre gruppentrennenden Eigenschaften<br />
untersucht. Anschließend wurde mit unterschiedlichen<br />
Verfahren (LC-MALDI-TOF/<br />
TOF-MS, direkte MALDI-TOF/TOF-MS, in silico-<br />
Suche innerhalb der SwissProt-Datenbank)<br />
eine Identifikation der den Kandidatenmassen<br />
zugrundeliegenden Peptide angestrebt. Es<br />
folgte eine antikörperbasierte Bestätigung<br />
des identifizierten Peptids mit Hilfe von Antikörper-Capture<br />
Beads und MALDI-TOF-MS.<br />
Zum Abschluss wurde eine direkte Validation<br />
und Quantifizierung mit einem ELISA (Roche,<br />
Mannheim) in Serumproben von Patienten<br />
mit Pankreaskarzinom (n=60) und chronischer<br />
Pankreatitis (n=26) sowie bei Gesunden<br />
(n=60)) durchgeführt.<br />
Ergebnisse<br />
Im Rahmen unserer klinischen Studie gelang<br />
es uns, mittels MB-MALDI-TOF-MS-Analytik<br />
den Massenpeak m/z 3884 im Serum als<br />
Peptidommarker des Pankreaskarzinoms zu<br />
detektieren.<br />
Wie die ROC-Analysen in Abbildung 2<br />
zeigen, erhöhte die zusätzliche Bestimmung<br />
dieses Kandidatenpeaks die Sensitivität und<br />
Spezifität der labormedizinischen Tumordiagnostik<br />
in Verbindung mit den etablierten<br />
Tumormarkern CA 19-9 und CEA deutlich 10 .<br />
Eine in silico-Suche innerhalb der SwissProt-<br />
Datenbank ergab als mögliches Kandidatenpeptid<br />
ein Fragment von Plättchenfaktor 4<br />
(PF4). Mit Hilfe von Anti-PF4-gekoppelten<br />
MB-IAC-Prot-G-Magnetpartikeln und anschließender<br />
MB-MALDI-TOF-MS gelang die<br />
antikörperbasierte Bestätigung von PF4 als<br />
zugrundeliegendem Peptid. In der abschließenden<br />
Validation und immunologischen<br />
Quantifizierung mittels ELISA konnte gezeigt<br />
werden, dass die PF4-Konzentration im Serum<br />
von Patienten mit Pankreaskarzinom<br />
signifikant niedriger ist als bei gesunden<br />
Kontrollpersonen und auch bei Patienten mit<br />
Pankreatitis 10 . Dieser Befund ist unerwartet<br />
und spannend. Er ist möglicherweise auf eine<br />
bisher noch nicht aufgeklärte proteolytische<br />
Aktivität im Serum der Tumorpatienten<br />
zurückzuführen. Vor einer möglichen Einführung<br />
in die klinische Praxis muss unser hier<br />
vorgestellter Befund zu PF4 noch in größeren<br />
klinischen Studien weiter evaluiert werden.<br />
Darüber hinaus müssen die Anforderungen an<br />
den PF4-ELISA gezielt auf die neue Indikation<br />
hin weiterentwickelt und entsprechend der<br />
Richtlinie der Bundesärztekammer (RILIBÄK)<br />
zur Qualitätssicherung laboratoriumsmedizinischer<br />
Untersuchungen standardisiert<br />
werden.<br />
Fazit<br />
Die Peptidomanalytik in der Klinischen Chemie<br />
und Laboratoriumsmedizin besitzt ein herausragendes<br />
Zukunftspotential für die Entdeckung<br />
neuer krankheitsassoziierter Marker.<br />
Allerdings wird die MALDI-TOF-MS-Analytik<br />
noch durch ihre zu geringe Sensitivität und<br />
Trennschärfe limitiert. Aktuelle Fortschritte<br />
in der selektiven Probenfraktionierung,<br />
hochauflösende massenspektrometrische<br />
Verfahren sowie neue LC-MS/MS-Methoden<br />
zur direkten Quantifizierung versprechen<br />
künftig eine wesentlich sensitivere und spezifischere<br />
Analyse von Peptiden und Proteinen<br />
in sehr niedrigen Konzentrationsbereichen 1 .<br />
Hierdurch könnte in Zukunft eine nachhaltige<br />
Vernetzung der Genomanalytik mit der<br />
Peptidom- oder Proteomanalytik zur Aufklärung<br />
der pathophysiologischen Basis und der<br />
ungeklärten Varianz häufiger Erkrankungen<br />
erreicht werden.<br />
Literatur<br />
[1] Schiess, R., Wollscheid, B. & Aebersold, R. Targeted<br />
proteomic strategy for clinical biomarker discovery.<br />
Mol Oncol 3, 33-44 (2009).<br />
[2] Hortin, G. L. Can mass spectrometric protein profiling<br />
meet desired standards of clinical laboratory practice?<br />
Clin Chem 51, 3-5 (2005).<br />
[3] Diamandis, E. P. & van der Merwe, D. E. Plasma protein<br />
profiling by mass spectrometry for cancer diagnosis:<br />
opportunities and limitations. Clin Cancer Res 11,<br />
963-5 (2005).<br />
[4] Fiedler, G. M., Baumann, S., Leichtle, A., Oltmann,<br />
A., Kase, J., Thiery, J. & Ceglarek, U. Standardized<br />
peptidome profiling of human urine by magnetic bead<br />
separation and matrix-assisted laser desorption/ionization<br />
time-of-flight mass spectrometry. Clin Chem 53,<br />
421-8 (2007).<br />
[5] Baumann, S., Ceglarek, U., Fiedler, G. M., Lembcke,<br />
J., Leichtle, A. & Thiery, J. Standardized approach to<br />
proteome profiling of human serum based on magnetic<br />
bead separation and matrix-assisted laser desorption/<br />
ionization time-of-flight mass spectrometry. Clin.<br />
Chem. 51, 973-80 (2005).<br />
[6] Bruegel, M., Planert, M., Baumann, S., Focke, A., Bergh,<br />
F. T., Leichtle, A., Ceglarek, U., Thiery, J. & Fiedler, G.<br />
M. Standardized peptidome profiling of human cerebrospinal<br />
fluid by magnetic bead separation and matrixassisted<br />
laser desorption/ionization time-of-flight mass<br />
spectrometry. J Proteomics 72, 608-15 (2009).<br />
[7] Ceglarek, U., Fiedler, G. M., Baumann, S., Leichtle,<br />
A. & Thiery, J. Klinische Proteomics - Chancen für die<br />
Labormedizin? <strong>Laborwelt</strong> 6, 15-17 (2005).<br />
[8] Conrad, T. O. F., Leichtle, A., Hagehülsmann, A.,<br />
Diederichs, E., Baumann, S., Thiery, J. & Schütte,<br />
C. in Proceeding of CompLife 2006 (ed. M. R. Berthold,<br />
R. G., and I. Fischer) 119-128 (Springer-Verlag Berlin<br />
Heidelberg, 2006).<br />
[9] Steinberg, W. M., Gelfand, R., Anderson, K. K., Glenn, J.,<br />
Kurtzman, S. H., Sindelar, W. F. & Toskes, P. P. Comparison<br />
of the sensitivity and specificity of the CA19-9 and<br />
carcinoembryonic antigen assays in detecting cancer of<br />
the pancreas. Gastroenterology 90, 343-9 (1986).<br />
[10] Fiedler, G. M., Leichtle, A. B., Kase, J., Baumann,<br />
S., Ceglarek, U., Felix, K., Conrad, T., Witzigmann,<br />
H., Weimann, A., Schutte, C., Hauss, J., Buchler,<br />
M. & Thiery, J. Serum peptidome profiling revealed<br />
platelet factor 4 as a potential discriminating Peptide<br />
associated with pancreatic cancer. Clin Cancer Res 15,<br />
3812-9 (2009).<br />
Korrespondenzadresse<br />
Prof. Dr. med. Joachim Thiery<br />
Institut für Laboratoriumsmedizin, Klinische<br />
Chemie und Molekulare Diagnostik<br />
Universität Leipzig<br />
Liebigstraße 27<br />
04103 Leipzig<br />
thiery@medizin.uni-leipzig.de<br />
28 | 10. Jahrgang | Nr. 5/2009 LABORWElT
Protein-Microarrays:<br />
Sensitive quantitative<br />
Analyse von Signalwegen<br />
Frauke Henjes, Frank Götschel, Heiko Mannsperger, Johanna Sonntag, Ulrike Korf;<br />
Molekulare Genomanalyse, Deutsches Krebsforschungszentrum, Heidelberg<br />
Proteinen kommt bei der Identifizierung von neuen Krankheitsmarkern und bei der Entwicklung<br />
gezielter Therapien eine besondere Bedeutung zu, da sie die Funktionsträger der<br />
Zelle sind. Von Seiten der klinischen Forschung sowie der Systembiologie besteht daher<br />
ein großer Bedarf an zuverlässigen quantitativen Daten, die in vielen Proben gleichzeitig<br />
erhoben werden können. Diesem Anspruch kommen die charakteristischen Merkmale von<br />
Protein-Microarray-Technologien, wie hohe Probenkapazität und hohe Sensitivität, entgegen.<br />
Protein-Microarrays liefern als Antikörper-basiertes Verfahren zuverlässige Daten für<br />
gezielte Fragestellungen und sind daher sowohl für die zielgerichtete klinische Forschung<br />
wie auch die systematische Analyse von Signalwegen eine vielversprechende experimentelle<br />
Plattform. In jüngerer Zeit haben sich Protein-Microarrays insbesondere bei der Erforschung<br />
von krebsrelevanten Signalwegen bewährt.<br />
Abb. 1: Wachstumsfaktor-vermittelte Signaltransduktion. Gezeigt werden EGFR und sein Ligand<br />
EGF, ERBB3 und sein Ligand HRG sowie der ligandenunabhängig agierende Rezeptor<br />
ERBB2. Diese Rezeptoren müssen miteinander dimerisieren, um nachgeordnete Signaltransduktionswege<br />
zu aktivieren. Funktionelle Dimere sind EGFR/EGFR, EGFR/ERBB2,<br />
EGFR/ERBB3 sowie ERBB2/ERBB3.<br />
In biologischen Systemen werden extrazelluläre<br />
Signale mit hoher Geschwindigkeit<br />
weitervermittelt und in die zellulären<br />
Abläufe integriert. Bei der Regulation des<br />
physiologischen Gleichgewichtes spielen<br />
unterschiedliche biochemische Vorgänge eine<br />
Rolle, von denen viele über posttranslationale<br />
Modifizierungen von Proteinen, wie etwa die<br />
Phosphorylierung- und Dephosphorylierung<br />
von Proteinen, vermittelt werden.<br />
So werden membranständige Rezeptortyrosinkinasen<br />
(RTK) durch das Andocken<br />
spezifischer Liganden aktiviert, zum Beispiel<br />
des epidermalen Wachstumsfaktors (EGF).<br />
Für die Weitervermittlung des Signals in die<br />
Zelle muss der Rezeptor mit einer anderen RTK<br />
dimerisieren (Abb. 1). In die Signalweitergabe<br />
sind zahlreiche intrazelluläre Lipid- und Proteinkinasen<br />
eingebunden. Rückkopplungsschleifen<br />
sorgen gleichzeitig für eine Integration<br />
der Information in parallel stattfindende<br />
zelluläre Signalprozesse beziehungsweise<br />
auch für ein Abschalten des Rezeptors.<br />
Zahlreiche Tumoren produzieren anstelle<br />
der normalen Version mutierte Varianten<br />
einer bestimmten Rezeptortyrosinkinase, da<br />
sie auf diese Weise einen Überlebensvorteil<br />
gewinnen und ihre Zellteilung und somit auch<br />
das Tumorwachstum vorantreiben können.<br />
So sind für den Rezeptor des Epidermalen<br />
Wachstumsfaktors (EGFR) verschiedene<br />
aktivierende Mutationen beschrieben, die<br />
Blitzlicht Microarrays<br />
beispielsweise in Tumoren der Lunge identifiziert<br />
wurden 1 . Eine andere erfolgreiche<br />
Strategie von Tumoren für die Sicherung eines<br />
schnelleren und nicht regulierten Wachstums<br />
ist die verstärkte Expression eines bestimmten<br />
Rezeptors. In vielen Tumoren der Brust<br />
wird beispielsweise HER2, ein dem EGFR<br />
strukturell verwandtes Membranprotein,<br />
überproduziert. Im Gegensatz zu EGFR kann<br />
HER2 auch ohne Andocken eines extrazellulären<br />
Liganden sein wachstumsaktivierendes<br />
Signal in die Zelle weitergeben und auf<br />
diese Weise die Malignität eines Tumors<br />
verstärken 2 . Gegen beide Rezeptoren wurden<br />
gezielte Therapeutika entwickelt, die bereits<br />
in der klinischen Anwendung sind 3 . In der<br />
klinischen Praxis sind jedoch nur rund 30%<br />
der gezielten Therapeutika wirksam, und in<br />
vielen Fällen entwickeln Tumoren während<br />
einer langfristigen Behandlung Resistenzen<br />
gegen die Therapie. Offensichtlich verfügen<br />
Tumoren über molekulare Mechanismen, die<br />
es ihnen erlauben, die Wirkung der gezielten<br />
Therapeutika zu umgehen.<br />
Bislang sind die Mechanismen der intrazellulären<br />
Regulationsprozesse jedoch nur unzureichend<br />
verstanden, da viele Signalwege<br />
durch Knotenpunkte miteinander verknüpft<br />
sind und als komplexe Netzwerke fungieren.<br />
Exakte zeitaufgelöste und quantitative Analysen<br />
miteinander interagierender Signalwege<br />
können jedoch hilfreiche Anhaltspunkte<br />
zu zell- oder tumorspezifischen Regulationsvorgängen<br />
liefern. In den vergangenen<br />
Jahren wurden Protein-Microarrays als experimentelle<br />
Plattform für quantitative und<br />
dynamische Analysen des Phosphoproteoms<br />
eingesetzt. Protein-Microarrays übertreffen<br />
herkömmliche etablierte Methoden der<br />
Proteomik im Hinblick auf ihre große Probenkapazität,<br />
hohe Empfindlichkeit, sehr gute<br />
Reproduzierbarkeit quantitativer Daten und<br />
auch die Schnelligkeit der Analyse. So haben<br />
sich Protein-Microarrays als sensitives und<br />
effizientes Werkzeug für die Wirkstoffforschung<br />
sowie die Untersuchung individueller<br />
Tumorproben erwiesen. Insbesondere bieten<br />
sie eine ideale Grundlage für die quantitative<br />
und dynamische Analyse von Proteinkinasevermittelten<br />
Signalprozessen<br />
Reverse Phase Protein-Microarrays<br />
In der Reverse Phase Protein Microarray-Technologie,<br />
RPPA, werden die zu untersuchenden<br />
Proben in genau definierten Positionen auf einem<br />
Festphasenträger (Slide) aufgebracht. Die<br />
Abgabe der Proben auf die Slides erfolgt mit<br />
Hilfe eines sehr präzisen Roboters. Vergleichbar<br />
zu den Positionen einer Mikrotiterplatte<br />
lässt sich jede einzelne Position auf dem Slide<br />
und damit auch jede Probe genau adressieren<br />
(Abb. 2). In einem Druckvorgang können<br />
mehrere Hundert identische Replikat-Slides<br />
produziert werden. In den immobilisierten<br />
LABORWElT 10. Jahrgang | Nr. 5/2009 | 29
Blitzlicht Microarrays<br />
Lysat-Spot<br />
Zielprotein<br />
spezifischer<br />
1. Antikörper<br />
Nitrocellulose-beschichtete Objektträger<br />
mit jeweils zwei Subarrays<br />
Abb. 2: Prinzip der Reverse Phase Protein-Arrays (RPPA). Jeder Subarray kann mit einem anderen<br />
Antikörper ausgelesen werden. Auf diese Weise werden über viele Proben hinweg Expressionsprofile<br />
für ausgewählte Proteine erstellt, die anschließend mit Hilfe von bioinformatischen<br />
Verfahren miteinander verglichen werden können.<br />
Proben können mit Hilfe von Antikörpern<br />
Zielproteine spezifisch erkannt und markiert<br />
werden. Anschließend werden die an die Zielproteine<br />
gebundenen Antikörper mit Hilfe von<br />
fluoreszenzmarkierten Sekundärantikörpern<br />
und geeigneten Scannern sichtbar gemacht.<br />
Die Intensität des Fluoreszenzsignals entspricht<br />
dabei über einen sehr großen Bereich<br />
der Menge des Zielproteins auf dem Array.<br />
Mit Hilfe moderner Methoden der Datenanalyse<br />
und der Statistik lassen sich die Signale<br />
aller Proben auf den unterschiedlichen Slides<br />
NIR-markierter<br />
2. Antikörper<br />
Scan eines Objektträgers<br />
analysieren und vergleichen 4,5 . Die Stärke der<br />
RPPA-Technologie liegt darin, die Expression<br />
einer Vielzahl von Proteinen und Phosphoproteinen<br />
in verschiedenen Proben mit hoher<br />
Sensitivität und nur minimalem Probenbedarf<br />
miteinander vergleichen zu können. Von jeder<br />
Probe wird pro Slide ein Volumen von wenigen<br />
Nanolitern benötigt. In einem Tropfen von<br />
einem Nanoliter ist bereits das gesamte Proteom<br />
einer Zelle präsentiert. Da die Sensitivität<br />
des RPPA-Ansatzes im picomolaren Bereich<br />
liegt, lassen sich auch gering exprimierte<br />
Abb. 4: Prinzip Microspot-Immunoassay (MIA). Spezifische Fängerantikörper werden als Replikatspots<br />
in 16 identischen Subarrays auf den Träger gedruckt. Jeder Fängerantikörper<br />
erkennt sein Zielprotein. Ein zweites Epitop jedes Zielproteins wird nach Inkubation mit<br />
einem Cocktail aus spezifischen Detektionsantikörpern markiert und kann in einem weiteren<br />
Inkubationsschritt fluoreszenzmarkiert visualisiert werden. Mit Hilfe von geeigneten<br />
Standards können die Fluoreszenzsignale der Proben quantitativ analysiert werden.<br />
Dieser Ansatz ist insbesondere für quantitative Phosphoproteomics geeignet.<br />
Proteine und Phosphoproteine zuverlässig<br />
detektieren. Dank dieser hohen Sensitivität<br />
der RPPA-Technik können auch klinische Proben<br />
analysiert werden 6,7 , und die Motivation zur<br />
Etablierung der RPPA Strategie zielte ursprünglich<br />
darauf ab, die Limitationen etablierter<br />
Proteomanalyse-Methoden zu überwinden<br />
und eine adäquate Methode für quantitative<br />
Analysen von Proteinnetzwerken in klinischen<br />
Proben zu entwickeln 8 . Nicht zuletzt haben<br />
sich RPPA auch als hilfreiches Werkzeug für die<br />
Quantifizierung von Proteinen und Phosphoproteinen<br />
nach siRNA-basierten Knock-downs<br />
erwiesen 9,10 .<br />
Auch systembiologische Untersuchungen<br />
wie etwa die Analyse von zeitaufgelösten<br />
Messungen können mit Hilfe von RPPA<br />
effizient durchgeführt werden 11 . Bindet beispielsweise<br />
EGF an seinen Rezeptor EGFR,<br />
werden vielfältige Phosphorylierungsprozesse<br />
initiiert. Obwohl der EGFR in verschiedenen<br />
Zelllinien prinzipiell dieselben Signalwege<br />
nutzt, zeigt jede Zelllinie ihre ganz charakteristische<br />
Dynamik. Dies ist zunächst<br />
1<br />
0 10 20 30 40 50 60<br />
Abb. 3: EGF-induzierte Phosphorylierung der<br />
Proteinkinasen ERK in den humanen<br />
Brustkrebszelllinien HCC-1954, BT-474<br />
und MCF-7<br />
30 | 10. Jahrgang | Nr. 5/2009 LABORWElT<br />
pERK phosphorylation<br />
2<br />
1.5<br />
BT474 HCC1954 MCF7<br />
time [min]<br />
überraschend, da sich die Expression des<br />
EGFR in den untersuchten Zelllinien nicht<br />
grundlegend unterscheidet. Trotzdem induziert<br />
EGF in den humanen Brustkrebszelllinien<br />
MCF-7 und BT-474 nur eine zeitlich begrenzte<br />
Phosphorylierung der Proteinkinase ERK1/2.<br />
In der humanen Brustkrebszelllinien HCC-<br />
1954 verläuft die Dynamik anders, und die<br />
Aktivierung der Proteinkinase ERK1/2 ist nach<br />
einer Stunde noch nicht wieder abgeklungen<br />
(Abb. 3). Offensichtlich ist nicht nur das bloße<br />
Vorhandensein des Rezeptors für die Dynamik<br />
der untergeordneten Prozesse verantwortlich,<br />
sondern auch das Repertoire an Dimerisierungspartnern<br />
oder intrazellulären Proteinen,<br />
die gemeinsam in die Signaltransduktion<br />
eingebunden sind.<br />
Microspot-Immunoassay<br />
Im Gegensatz zu den RPPA werden beim<br />
Microspot-Immunoassay (MIA) Fängermoleküle,<br />
beispielsweise Antikörper, auf den
CO 2 - Abfall oder Rohstoff?<br />
Möglichkeiten und Grenzen<br />
der CO2-Sequestrierung<br />
3.-4.11.2009, Zentrum für Umweltkommunikation, Osnabrück<br />
Im Rahmen dieser zweitägigen Konferenz zum Thema Abscheidung von CO soll unter technologischen, ökolo-<br />
2<br />
gischen und wirtschaftlichen Aspekten diskutiert werden, ob CO als Industrieabfall entsorgt oder als Rohstoff<br />
2<br />
zum Aufbau komplexer Kohlenstoffverbindungen genutzt werden kann. Dazu werden erste Ergebnisse der<br />
angewandten CO -Abscheidungs-, Transport- und Lagerungstechnologien verschiedener deutscher Pilotanla-<br />
2<br />
gen vorgestellt sowie Möglichkeiten der biologisch-chemischen Fixierung und Nutzung von CO aus aktuellen<br />
2<br />
Forschungsprojekten in Deutschland aufgezeigt.<br />
Unter anderem werden als Referenten sprechen<br />
Prof. Dr. Hartmut Graßl, Max-Planck-Institut für Meteorologie, Meteorologisches Institut der Universität Hamburg<br />
Prof. Dr. Manfred Fischedick, Vizepräsident, Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Energie<br />
Dr. Thomas Haas, Leiter Science-to-Business Center Biotechnologie, Creavis Technologies & Innovation,<br />
Evonik Degussa GmbH<br />
Prof. Dr. Walter Leitner, Leiter Institut für Technische Chemie und Makromolekulare Chemie, RWTH Aachen<br />
Dr. Wolfgang Rolland, Leiter Bergwirtschaft/Bergbaustrategie, Vattenfall Europe Mining AG<br />
Prof. Dr. Walter Trösch, Abteilungsleiter Umweltbiotechnologie und Bioverfahrenstechnik, Fraunhofer IGB<br />
Dr. Hilke Würdemann, Leiterin Bio-Geoengineering, Deutsches GeoForschungszentrum<br />
Registrierung und weitere Informationen unter www.biocom.de/events.<br />
Medienpartner: zertifiziert durch:<br />
BIOCOM Projektmanagement GmbH | Brunnenstraße 128 | 13355 Berlin | Germany<br />
www.biocom.de | events@biocom.de | Tel. +49 (0)30 264921-53 | Fax +49 (0)30 264921-66
Blitzlicht Microarrays<br />
Tab. 1: Quantitative Proteinmicroarray-Anwendungen<br />
Multiplexing-Kapazität RPPA MIA<br />
Anzahl Zielproteine 50-200 5-10<br />
Probenkapazität 2000-4000 10-20<br />
Signalbereich 10 3 -10 4 Größenordnungen<br />
Empfindlichkeit<br />
pERK [ng/mg lysate]<br />
1000<br />
750<br />
500<br />
250<br />
0<br />
0 10 20 30 40 50 60<br />
Träger gedruckt. Die Quantifizierung wird<br />
dann vergleichbar zu den klassischen ELISA-<br />
Techniken mit Hilfe eines zweiten Antikörpers<br />
durchgeführt, der ein weiteres Epitop des<br />
Zielproteins erkennt (Abb. 4). Im Microspot-<br />
Immunoassay (MIA) wird die ELISA-Strategie<br />
miniaturisiert und im Multiplex-Format für<br />
die gleichzeitige Quantifizierung mehrerer<br />
Phosphoproteine eingesetzt. Dank des miniaturisierten<br />
Maßstabs ändert sich die Konzentration<br />
des Analyten während der Messung<br />
nicht, und es werden exaktere Werte erhalten<br />
als mit Standard-ELISA-Techniken möglich<br />
ist 12 . Im miniaturisierten Maßstab werden die<br />
Fängerantikörper als winzig kleine Replikat-<br />
Spots auf Nitrozellulose-beschichtete Träger<br />
gedruckt. Da der Array aus Fängerantikörpern<br />
mehrfach – im gezeigten Beispiel 16-fach –<br />
auf den Slide gedruckt wird, entstehen nach<br />
einer Kompartimentierung der Oberfläche<br />
16 kleine Inkubationskammern von denen<br />
ein Teil für die Aufnahme einer multiplexen<br />
Verdünnungsreihe genutzt wird. Die übrigen<br />
Inkubationskammern stehen für Vermessung<br />
der biologischen Proben zur Verfügung.<br />
Die Detektion der spezifisch gebundenen<br />
Proteine erfolgt mit einem Cocktail aus Detektionsantikörpern<br />
und in einem zweiten<br />
Schritt die Visualisierung der Antikörper-<br />
Picomolar<br />
Femtogramm Protein/Spot<br />
time [min]<br />
Femtomolar<br />
Picogramm Protein/ml<br />
Readout Qualitative Änderungen Exakte Quantifizierung<br />
HGF 5ng/ml HGF 20ng/ml HGF 40ng/ml negative control<br />
Abb. 5: Dosisabhängige Aktivierung der Signaltransduktion durch den Hepatischen Wachtumsfaktor<br />
(HGF) in der Brustkrebszellinie HCC-1954. HGF bindet an seinen Rezeptor MET, der<br />
für die Weitergabe des Signals dimerisieren muss. In der Zelllinie HCC-1954 wird in erster<br />
Linie die Phosphorylierung von ERK1/2 aktiviert.<br />
Protein-Komplexe mit fluoreszenzmarkierten<br />
Sekundärantikörpern. Eine maßgeschneiderte<br />
Software berechnet die Konzentration eines<br />
jeden Analyten in der Probe 13 . Im Hinblick auf<br />
die Sensitivität können ohne weiteres femtomolare<br />
Mengen eines Analyten detektiert<br />
werden. Im Gegensatz zu den RPPA liefert<br />
dieser Ansatz sehr präzise quantitative Daten<br />
und ermöglicht auch Untersuchungen zur<br />
dosisabhängigen Aktivierung von Signalwegen<br />
(Abb. 5).<br />
Produktion von Protein-Microarrays<br />
Da Protein-Microarrays quantitative Aussagen<br />
der untersuchten biologischen Proben<br />
liefern sollen, ist die Reproduzierbarkeit<br />
und Standardisierung der experimentellen<br />
Parameter ein wichtiger Aspekt: So ist bei<br />
der Produktion der Arrays eine über viele<br />
Proben hinweg einheitliche Tropfengröße<br />
unverzichtbar. Geringe Unterschiede in der<br />
Tropfengröße (wenige Prozent) können durch<br />
geeignete Normalisierungsverfahren ausgeglichen<br />
werden. Die Abgabe der Proben auf<br />
den Festphasenträger kann dabei mit Hilfe<br />
eines direkten Kontakts zwischen Druckernadel<br />
und Slide realisiert werden. Andere Dru-<br />
cker geben in einem kontaktlosen Verfahren<br />
winzige Tropfenmengen ab. Im Hinblick auf<br />
die Zeit unterscheiden sich unterschiedliche<br />
Druckverfahren beträchtlich. Schnelle Drucker<br />
benötigen für die Probenabgabe auf eine<br />
vorgegebene Anzahl Slides nur eine halbe<br />
Stunde. Langsame Drucker brauchen für<br />
denselben Druckvorgang 15 bis 18 Stunden.<br />
Die Geschwindigkeit des Druckvorgangs<br />
ist bei der Produktion von Antikörperarrays<br />
von untergeordneter Bedeutung. Im Falle<br />
von RPPA ist die Zeit jedoch ein wichtiger<br />
Faktor, da in komplexen biologischen Proben<br />
biochemische Prozesse weiterlaufen, die<br />
möglicherweise auch zur Degradation des<br />
Zielproteins beitragen, und es sind daher<br />
schnelle Druckverfahren von Vorteil.<br />
Zusammenfassung<br />
Grundsätzlich besitzen Protein-Microarrays<br />
gegenüber Gel-basierten Techniken eine<br />
ausgesprochen hohe Probenkapazität, eine exzellente<br />
Sensitivität und einen großen dynamischen<br />
Bereich. Sowohl RPPA wie auch MIA sind<br />
mit der Untersuchung von klinischen Proben<br />
kompatibel. Dank ihrer hohen Sensitivität und<br />
Flexibilität sind Protein-Microarray-basierte<br />
Methoden eine exzellente Ausgangsbasis, um<br />
die Dynamik und Komplexität von biologischen<br />
Prozessen gezielt zu untersuchen. Protein-<br />
Microarrays sind darüber hinaus auch für die<br />
Wirkstoffforschung und die Entwicklung der<br />
individuellen Tumortherapie eine vielversprechende<br />
Plattform (Tabelle 1).<br />
Literatur<br />
[1] Bell, D.W. et al., J. Clin. Oncology, 23 (2005), 8081-8092.<br />
[2] Yarden, Y., Oncology, 61 (2001), 1-13.<br />
[3] Mendelsohn, J., Baselga, J., Oncogene, 19 (2000), 6550-6565.<br />
[4] Neeley, E.S. et al., Bioinformatics, 25 (2009), 1384-1389.<br />
[5] Zhang, L. et al., Bioinformatics, 25 (2009), 650-654.<br />
[6] Gulman, C. Et al., K.M., J Pathol., 218 (2009), 514-519.<br />
[7] Vasudevan, K. et al., Cancer Cell., 16 (2009), 21-32.<br />
[8] Paweletz, C.P. et al., Oncogene. 20 (2001), 1981-1989.<br />
[9] Sahin, O. et al., Proc Natl Acad Sci U S A., 104 (2007), 6579-6584.<br />
[10] Sahin, O. et al., BMC Syst Biol., 1 (2009), 1.<br />
[11] Löbke, C. et al., Proteomics, 8 (2008), 1586-1589.<br />
[12] Poetz, O. et al., Proteomics, 9 (2005), 2402-11.<br />
[13] Korf, U. et al., Proteomics, 8 (2008), 4603-4612.<br />
Korrespondenzadresse<br />
Dr. Ulrike Korf<br />
Quantitative Proteomics<br />
Deutsches Krebsforschungszentrum<br />
Im Neuenheimer Feld 580<br />
69120 Heidelberg<br />
Tel.: + 49-(0)6221-424765<br />
Fax: + 49-(0)6221-423454<br />
u.korf@dkfz.de<br />
www.laborwelt.de<br />
32 | 10. Jahrgang | Nr. 5/2009 LABORWElT
Weltkongress für<br />
Regenerative Medizin:<br />
Forschungselite in Leipzig<br />
Thomas Gabrielczyk, Redaktion LABORWELT<br />
Aktuelle Forschung und mögliche Anwendungen von Stammzellen und des Tissue Engineerings,<br />
aber auch Technologien zur reproduzierbaren Kultivierung von Zellen und Geweben<br />
für den medizinischen Einsatz sowie Methoden, diese möglichst immunkompatibel zu<br />
implantieren, stehen im Mittelpunkt, wenn sich vom 29. bis 31. Oktober die Weltelite der<br />
Stammzellforscher auf der Weltkonferenz für Regenerative Medizin in Leipzig trifft (www.<br />
wcrm-leipzig.com/). Organisiert vom TRM Leipzig – dem deutschen Translationszentrum für<br />
die Regenerative Medizin – bietet der internationale Meeting eine Auswahl an Vorträgen,<br />
die jedem Vergleich standhält. Dass das Forschungsfeld hochdynamisch ist und methodisch<br />
signifikant vorangekommen ist, dokumentierte Ende September nicht zuletzt die Verleihung<br />
der als „US-Nobelpreise“ gehandelten Lasker-Awards an zwei Stammzellforscher – den Entdecker<br />
der induzierten pluripotenten Stammzellen, Shinya Yamanaka (Univ. Kyoto), und John<br />
Gurdon (Univ. Cambridge,UK), einem Pionier der Zellkerntransfer-Technologie.<br />
Abb.: Komplexe Ko-Kultivierung von Nerven- und Muskelzellen auf einem Bio-Nanofaser-<br />
Scaffold aus Polymilchsäure<br />
Gemäß der Interdisziplinarität des Forschungs-<br />
und Anwendungsfeldes Regenerative Medizin<br />
ist die thematische Spannweite der Vorträge in<br />
den fünf Themenschwerpunkten „Stem Cells“,<br />
„Tissue Engineering“, „Technology Development“,<br />
„Immunology and Signaling“ sowie „Regulatory<br />
Affairs“ sehr weit. So wird etwa John<br />
Hunt vom UK Centre for Tissue Engineering an<br />
der Universität Liverpool berichten, wie die Dip<br />
Pen-Nanolithographie (DPN®) eingesetzt werden<br />
kann, um den Phänotyp von Stammzellpopulationen<br />
durch definierte Zugabe benötigter<br />
Faktoren zu definieren und damit das Problem<br />
heterogener Zellpopulationen zu lösen, das einer<br />
medizinischen Anwendung von Stammzellen<br />
als Ersatzzellen oder in zellbasierten Assays<br />
derzeit noch entgegensteht. Jeffrey Karp vom<br />
US-Eliteinstitut MIT (Cambridge, USA) dagegen<br />
stellt biomimetische Adhäsive für den biomedizinischen<br />
Einsatz vor, die den adhäsiven<br />
Regionen des Geckofusses nachgebildet sind.<br />
Die vom britischen Start-up-Unternehmen<br />
Regentec Ltd. in Leipzig präsentierte Injectible<br />
scaffold-Technologie zielt darauf ab, im Körper<br />
eine definierte Mikroumgebung für Zellen zu<br />
schaffen, die zur Knochenreparatur eingesetzt<br />
werden. Die Entwicklung geeigneter resorbierbarer<br />
Gerüstmaterialien ist ein ständiges<br />
Arbeitsfeld des Tissue Engineering, aber auch<br />
der Stammzellforschung (vgl Abb.), über dessen<br />
Neuerungen die Forscher auf dem WCRM<br />
in Leipzig diskutieren werden.<br />
Blitzlicht Kongress<br />
Cell Culture<br />
goes fully<br />
automated<br />
Biomek ®<br />
Cell Workstation<br />
Besuchen Sie uns!<br />
Halle 9, Stand E26<br />
Process to<br />
Solution<br />
Maintenance - Expansion - Production<br />
¸ total process control<br />
¸ integrated data handling and<br />
decision making<br />
¸ flexible process definition editor<br />
¸ cell viability check with integrated<br />
Vi-CELL ®<br />
¸ small footprint<br />
Expansion Options through modular<br />
design to get i.e. cell line optimisation<br />
or monoclonal antibody production<br />
workstations<br />
Beckman Coulter GmbH<br />
47807 Krefeld Europark Fichtenhain B13<br />
Tel. 02151/333 625<br />
www.beckmancoulter.com<br />
Genomics Proteomics Cell Analysis Centrifugation Lab Tools<br />
Particle Characterization Bioseperation Lab Automation<br />
LABORWElT 10. Jahrgang | Nr. 5/2009 | 33
Blitzlicht Bibiometrie<br />
Leistungsmessung in der<br />
Forschung – Erfordernis<br />
oder Vermessenheit?<br />
Prof. Dr. Stefan Hornbostel, Dr. Markus von Ins,<br />
Institut für Forschungsinformation und Qualitätssicherung iFQ, Bonn/<br />
Kompetenzzentrum Bibliometrie für die deutsche Wissenschaft<br />
Die Reflexion von Wissenschaft auf und über sich selbst ist keineswegs neu. Ein deutlicher<br />
Wandel in der Art und Weise wie Wissenschaft über sich selbst räsoniert,setzte aber mit Beginn<br />
des 20. Jahrhunderts ein. Neben die Wissenschaftsphilosophie traten zunehmend empirische<br />
Untersuchungen des Verhaltens von Wissenschaftlern, des Forschungsprozesses und der<br />
(Selbst-)Steuerungsmechanismen, denen Wissenschaft unterliegt. Eine weitere Veränderung<br />
setzte Mitte der 1960er Jahre ein: Die elektronische Datenverarbeitung ermöglichte erstmals,<br />
die bis dahin nur in den „Zettelkästen“ der Bibliotheken vorhandenen Informationen über die<br />
wissenschaftliche Literatur elektronisch verfügbar zu machen. Die neue Technik ermöglichte<br />
auch einen weiteren Schritt, der mit dem Science Citation Index realisiert wurde: Nicht nur der<br />
bibliographische Nachweis wurde elektronisch gespeichert,sondern auch die Referenzen,die in<br />
der Literaturliste am Ende eines Aufsatzes genannt werden. Damit war es erstmals möglich, in<br />
großem Umfang Beziehungen zwischen Dokumenten – Referenzierungen und Zitierungen – zu<br />
analysieren. Im Gegensatz zu den schon weit früher zu Beginn des zwanzigsten Jahrhunderts<br />
eingeführten „Abstracting Services“ wie etwa „Chemical Abstracts“ und „Physics Abstracts“<br />
(heute „INSPEC-Physics“), welche auf eine rein inhaltliche Erfassung der Literatur (Titel, Ausgabentitel<br />
und Abstracts) abzielten und zunächst nur den ersten Autorennamen enthielten,<br />
wurden in den bibliometrischen Datenbanken neben den Referenzen nach und nach auch<br />
sämtliche Autoren und die institutionellen Adressen der Autoren erfasst, um mit der Zunahme<br />
der Mehrfachautorschaft umgehen zu können.<br />
Obwohl diese Datenbanken zunächst dazu<br />
gedacht waren, amerikanische Wissenschaftler<br />
– insbesondere Naturwissenschaftler – bei der<br />
Suche in der schnell wachsenden Flut wissenschaftlicher<br />
Aufsätze effektiv zu unterstützen,<br />
entwickelte sich mit der Bibliometrie sehr bald<br />
ein eigenes Forschungsfeld, das diese Datenbanken<br />
als ein Abbild des Kommunikations- und<br />
Kooperationsprozesses in der Wissenschaft zu<br />
nutzen begann. Damit traten insbesondere Fragen<br />
nach den Kooperations- und Stratifikationsstrukturen<br />
im weltweiten Wissenschaftssystem<br />
in den Vordergrund. Ein Zitat wurde nicht mehr<br />
nur als eine intellektuelle Verbindungslinie<br />
zwischen Dokumenten betrachtet, sondern<br />
auch als eine soziale Handlung der bewussten<br />
Auswahl von Autoren und Texten, als eine Art<br />
„Anerkennungswährung“. Sichtbar wurde<br />
bei diesen Analysen unter anderem, dass die<br />
meisten untersuchten Phänomene nicht einer<br />
Normalverteilungen folgen, sondern in aller<br />
Regel sehr schief verteilt sind. War dies zunächst<br />
nur Anlass für akademische Debatten, bekamen<br />
die sichtbaren Ungleichheitsstrukturen spätestens<br />
seit den 1980er Jahren auch eine wissenschaftspolitische<br />
Bedeutung. Mit Evaluationen,<br />
Rankings, leistungsorientierter Mittelvergabe,<br />
öffentlicher Rechenschaftslegung, aber auch<br />
verstärktem institutionellem Management<br />
zunehmend autonomer werdender Hoch-<br />
schulen stieg die Bedeutung bibliometrischer<br />
Indikatoren deutlich an. Darauf reagierten auch<br />
die Anbieter der beiden weltweit wichtigsten<br />
Datenbanken Thompson Scientific (Web of<br />
Science) und Elsevier (Scopus). Beide bieten<br />
inzwischen Managementtools an (Institutional<br />
Citation Reports und SciVal). Darüber hinaus<br />
erhalten auch die Nutzer der Datenbanken eine<br />
ganze Reihe von bibliometrischen Indikatoren<br />
„frei Haus“ und unabhängig von diesen Datenbanken<br />
stehen im Internet Tools zur Verfügung,<br />
die – basierend auf Google – eine Reihe bibliometrischer<br />
Indikatoren anbieten.<br />
Dieses leicht zugängliche Angebot hat dazu<br />
geführt, dass in zunehmenden Maße für Qualitätssicherung,<br />
aber auch für die Beurteilung<br />
der wissenschaftlichen Leistung einzelner Wissenschaftler<br />
– nicht zuletzt im Rahmen von Berufungsverfahren<br />
– bibliometrische Indikatoren<br />
genutzt werden. Der im Wissenschaftssystem<br />
dominante Peer Review ist damit zwar nicht<br />
außer Kraft gesetzt, wohl aber selbst zunehmend<br />
durch die Nutzung von bibliometrischen<br />
Indikatoren gekennzeichnet.<br />
So erfreulich der leichte Zugang zu bibliometrischen<br />
Daten und die in den letzten Jahren<br />
deutlich verbesserte Datenqualität ist, so problematisch<br />
sind die folgenden Umstände:<br />
I die Theorieentwicklung hat mit der schnellen<br />
technischen Entwicklung nicht Schritt gehal-<br />
ten. Noch immer ist es etwas nebulös, was<br />
mit dem „Impact“ (den Zitationen) genau<br />
gemessen wird (vgl. Abb. 1). Dies wird umso<br />
bedeutsamer, als der Einsatz bibliometrischer<br />
Indikatoren für evaluative und distributive<br />
Zwecke alle Akteure anspornt, die Publikationstätigkeit<br />
auch unter strategischen<br />
Gesichtspunkten zu behandeln. Autorschaft<br />
kann so zum Verhandlungsgegenstand werden,<br />
Herausgeber können sanften Druck auf<br />
die Aufnahme von Referenzen aus eigenen<br />
Zeitschriften ausüben, und Autoren können<br />
schnell an die Grenzen „guter wissenschaftlicher<br />
Praxis“ stoßen. All dies beeinflusst<br />
seinerseits die Messung.<br />
Daten nicht einfach interpretierbar<br />
I Für Laien entziehen sich die Kennzahlen und<br />
Indikatoren jeder Zuverlässigkeitsprüfung,<br />
Validierbarkeit und Kontrolle. Eine solche<br />
ist nur unter erheblichem Aufwand und mit<br />
fundierten Detailkenntnissen zu erreichen.<br />
Die scheinbare „Objektivität“ der Kennzahlen<br />
verleitet zudem zu einem zunehmend<br />
unkritischen, gelegentlich naiven Umgang<br />
mit derartigen „Performanzindikatoren“. Dies<br />
ist umso gravierender, als die Daten Fehler<br />
und Unschärfen unterschiedlichster Art enthalten,<br />
wie etwa das Homonymenproblem<br />
(unterschiedliche Autoren gleichen Namens)<br />
und daraus resultierende Fehlzuordnungen<br />
von Publikationen und Zitationen, fehlerhafte<br />
Angaben der Autoren, falsche Klassifikation<br />
des Dokumententyps, unterschiedlich<br />
gute Fachgebiets- und Länderabdeckungen,<br />
etc. Je kleiner die analysierten Aggregate sind<br />
(im Extremfall eine Person) desto problematischer<br />
werden derartige Fehler.<br />
I Die Indikatoren, die inzwischen angeboten<br />
werden, sind keineswegs selbstevident; zur<br />
sachkundigen Interpretation ist vielmehr<br />
eine Fülle von Hintergrundwissen notwendig.<br />
Wie krass in der Praxis auch gegen einfache<br />
methodische Regeln verstoßen wird,<br />
zeigt die Verwendung von „Journal Impact<br />
Factors“ (JIF) zur Bewertung individueller<br />
wissenschaftlicher Leistungen. Die JIFs sind<br />
mit einigen Einschränkungen bestenfalls zur<br />
Charakterisierung von Zeitschriften geeignet,<br />
nicht aber zur Beurteilung individueller Leistungen.<br />
I Die meisten Indikatoren sind in ihren Ausprägungen<br />
von den disziplinären oder<br />
subdisziplinären Pubklikations- und Zitiergepflogenheiten<br />
abhängig. Ein Vergleich<br />
über (sub)disziplinäre Grenzen hinweg ist<br />
daher nur möglich, wenn zuvor eine geeignete<br />
Normierung stattgefunden hat. Solche<br />
Normierungen setzen feingranulierte Fachgebietsidentifikationen<br />
voraus, die ihrerseits<br />
www.laborwelt.de<br />
34 | 10. Jahrgang | Nr. 5/2009 LABORWElT
Abb.1: An Subfields normalisierter Zitationsindex der führenden Forschungsuniversitäten.<br />
Jeder Punkt gibt an, inwieweit die Publikationen einer Universität mehr oder weniger<br />
als im weltweiten Durchschnitt wahrgenommen (zitiert) werden 2<br />
eine Analyse des Rohdatenmaterialsmit<br />
großem Aufwand erfordern.<br />
I Eine Erfassung der wesentlichen wissenschaftlichen<br />
Literatur mit vertretbarem<br />
Aufwand erschien zunächst in den Naturwissenschaften<br />
und medizinischen Wissenschaften<br />
besonders einfach, da in diesen<br />
sehr oft relativ wenige Fachzeitschriften die<br />
Mehrheit der Artikel im Fachgebiet enthalten<br />
(Bradfords Law). Entsprechend wurden andere<br />
Publikationskanäle wie Monographien,<br />
Sammelbände und Conference Proceedings<br />
gar nicht oder eher unsystematisch berücksichtigt.<br />
Bis heute ist dies eine Schwäche<br />
der beiden Zitationsdatenbanken, die sich<br />
bei Analysen nicht nur in den Sozial- und<br />
Geisteswissenschaften, sondern auch in der<br />
Informatik oder den Ingenieurwissenschaften<br />
unangenehm bemerkbar macht. Bibliometrische<br />
Indikatoren sind daher keineswegs<br />
für jedes Fachgebiet geeignet.<br />
Neben diese Problematik der Datengrundlage<br />
bibliometrischer Indikatoren gesellen sich<br />
weitere methodische Probleme: Die zugrundeliegenden<br />
„Publikationen“ und auch die „Zitationen“<br />
sind nicht a priori vorgegeben, sondern<br />
es ist vielmehr definitionsbedürftig, welches die<br />
jeweils relevanten Prublikationsorgane sind. Wie<br />
sollen Publikationen und Zitate insbesondere bei<br />
der häufigen Mehrfachautorschaft zugeordnet<br />
werden? Wie sind die Beiträge der einzelnen<br />
Koautoren zu eruieren und zu gewichten? Sind<br />
die Publikationen alle gleich zu gewichten oder<br />
sollen etwa Aufwand, Umfang oder Informationsgehalt<br />
der Publikationen in die Gewichtung<br />
einfließen und wie sollen diese bemessen<br />
werden? Auch scheinbar einfache Fragen etwa<br />
nach der Zordnung von Zitaten zu Publikationen<br />
bergen eine Reihe von Problemen.<br />
Das Kompetenzzentrum Bibliometrie<br />
für die deutsche Wissenschaft<br />
Die gegenwärtige Situation wirkt ein wenig paradox:<br />
Durch die leichte Verfügbarkeit bibliometrischer<br />
Indikatoren droht ein mächtiges analytisches<br />
Werkzeug, durch unbedarfte Nutzung<br />
eine ganze Reihe nicht intendierter Wirkungen<br />
auszulösen. Vor diesem Hintergrund werden<br />
qualitativ hochstehende bibliometrische Analysen,<br />
eine elaborierte Indikatorik und informierte<br />
Nutzer immer wichtiger. Dies gilt umso mehr,<br />
als auch in der Forschungsförderung und<br />
-politik der Bedarf an fundierten und kritisch<br />
geprüften bibliometrischen Analysen und einer<br />
adäquaten Indikatorik sowie ein stark ansteigender<br />
Beratungsbedarf bei den Hochschulen<br />
im Rahmen der Entwicklung von Qualitätsmanagements-<br />
und Mittelverteilungssystemen zu<br />
erwarten ist. Während im Ausland in den letzten<br />
20 Jahren sehr leistungsfähige Einrichtungen<br />
entstanden sind, die sich auf bibliometrische<br />
Analysen spezialisiert haben, sind in Deutschland<br />
nur einige sehr kleine Arbeitsgruppen in<br />
den verschiedenen Teilgebieten der Wissen-<br />
Blitzlicht Bibliometrie<br />
schafts- und Technikforschung entstanden, die<br />
für diese fachübergreifende Aufgabe personell<br />
und technisch nur unzureichend gerüstet sind<br />
und eine langfristige Kompetenzakkumulation<br />
kaum leisten können. Für die Entwicklung neuer<br />
Methoden und Produkte aber auch für die Validierung<br />
und Qualitätsprüfung der Indikatoren<br />
ist jedoch eine kritische Masse und Breite der<br />
Kenntnisse unabdingbar. Um diese Defizite zu<br />
beheben, an die internationalen Entwicklungen<br />
anzuknüpfen und auch um komplementäre<br />
Erfahrungen und Kenntnisse zu bündeln, haben<br />
sich die das iFQ (Bonn), das IWT (Bielefeld),<br />
das Fraunhofer ISI (Karlsruhe) und das FIZ<br />
Karlsruhe zu einem Konsortium zusammengeschlossen.<br />
Seit Dezember 2008 fördert das<br />
BMBF den Aufbau dieses „Kompetenzzentrum<br />
Bibliometrie für die deutsche Wissenschaft“ 1 .<br />
Unter der Konsortialführerschaft des iFQ führt<br />
ein Steering Committee – bestehend aus den<br />
vier Projektpartnern – die Geschäfte des Konsortiums,<br />
ein wissenschaftlicher Beirat steht<br />
dem Kompetenzzentrum beratend zur Seite<br />
und entscheidet über die durchzuführenden<br />
Forschungsprojekte. Neben dem schrittweisen<br />
Aufbau einer bibliometrischen InHouse-Datenbank<br />
(Scopus und WoS) werden zunächst drei<br />
Ziele verfolgt:<br />
I die Vereinheitlichung der Autorennamen und<br />
der instiutionellen Adressen, auf der Basis der<br />
Erfahrungen der Konsortialpartner,<br />
I die Entwicklung geeigneter Normierungen<br />
für Publikations- Zitationsindikatoren und<br />
I eine Überprüfung und Erfassung der Robustheit,<br />
Validität und Verlässlichkeit der<br />
Datengrundlagen, die längerfristig in eine<br />
„Fehlerlehre“ münden soll, die auch Laien<br />
eine Hilfestellung bei der Interpretation der<br />
Daten liefert.<br />
Wenn diese Grundlagen geschaffen sind, sollen<br />
sich weitere Forschungs- und Anwendungsprojekte<br />
anschließen. Um die Nachwuchsausbildung<br />
in diesem Gebiet zu fördern, hat<br />
das Kompetenzzentrum aktuell drei Promotionsstellen<br />
ausgeschrieben. Für ein breiteres<br />
Publikum sollen in Zukunft „Summer Schools“<br />
angeboten werden.<br />
Literatur<br />
[1] www.forschungsinfo.de/Projekte/Kompetenzzentrum_<br />
Bibliometrie/projekte_bibliometrie.asp<br />
[2] European Commission EUR 23608 EN „A more researchintensive<br />
and integrated European Research Area – Science,<br />
Technology and Competitiveness key figures report<br />
2008/2009, p. 94<br />
Korrespondenzadresse<br />
Prof. Dr. Stefan Hornbostel<br />
IFQ Institut für Forschungsinformation und<br />
Qualitätssicherung<br />
Godesberger Allee 90, 53175 Bonn<br />
Tel./Fax: +49-(0)228-97273-0/-97273-49<br />
www.forschungsinfo.de<br />
hornbostel@forschungsinfo.de<br />
LABORWElT 10. Jahrgang | Nr. 5/2009 | 35<br />
© European Communities, 2008
Marktübersicht PCR<br />
Marktübersicht: PCR<br />
Ob in Grundlagenforschung oder molekularer Diagnostik – die Polymerase-Kettenreaktion (PCR) ist nach gut 20 Jahren als Arbeitspferd molekularbiologischer<br />
Labors nicht mehr wegzudenken. Trotz ausgefeilter und optimierter Amplifikationsprozesse gibt es immer wieder neue Optimierungen.<br />
Einen Überblick über das aktuelle Leistungsportfolio der Anbieter, die sich an der LABORWELT Produktumfrage beteiligt haben, gibt die<br />
vorliegende Marktübersicht.<br />
Applied Biosystems Deutschland GmbH<br />
Frankfurter Straße 129 B<br />
64293 Darmstadt<br />
Tel.: +49-(0)6151-9670 0<br />
Fax: +49-(0)6151-9670 5599<br />
germany.order@lifetech.com<br />
Analytik Jena AG<br />
bio solutions<br />
Konrad-Zuse-Straße 1<br />
07745 Jena<br />
Tel.: +49-(0)3641-779400<br />
Fax: +49-(0)3641-77767776<br />
biosolutions@analytik-jena.de<br />
www.bio.analytik-jena.de<br />
Christiane Knippschild<br />
Firma/Kontakt Analytik Jena AG<br />
bio solutions<br />
Konrad-Zuse-Straße 1<br />
07745 Jena<br />
Tel.: +49-(0)3641-779400<br />
Fax: +49-(0)3641-77767776<br />
biosolutions@analytik-jena.de<br />
www.bio.analytik-jena.de<br />
Christiane Knippschild<br />
Produktname AlphaSC ® SpeedCycler ² StepOne Plus Real-Time PCR-System<br />
Einsatzgebiete RapidPCR-Thermocycler für jede PCR- Applikation RapidPCR-Thermocycler für alle PCR-Applikationen Real-Time quantitative PCR, Quantifizierung von<br />
Genexpression und SNP-Genotypisierung<br />
Thermocycler- und Detektionseinheit für Real-<br />
Time quantitative PCR<br />
höhere Heiz- und Kühlgeschwindigkeiten I RapidPCR Thermocycler<br />
für alle PCR-Applikationen I schnellster Thermocycler weltweit I<br />
ermöglicht PCR-Läufe in weniger als 8 Minuten I vier austauschbare<br />
Blöcke im Low Profile Rapid-Format (LPR) für geringsten Probenverbrauch,<br />
im Standard Profile Rapid (SPR) bzw. Standard Profile<br />
(SP) Format I Programmierung über externe, portable Bedieneinheit<br />
HID-Pro 320 mit 5,7“ graphischem Touchscreen, basierend auf<br />
Windows CE oder konventionell über die PC-Software rPCRsoft.<br />
Flexibel durch vier austauschbare Blöcke: Low Profile Rapid-Blöcke<br />
(LPR) für geringen Probenverbrauch und minimale Running<br />
Costs, Standard Profile Rapid-Blöcke (SPR) oder eine Kombination<br />
aus beiden Blockformaten I enorme Geschwindigkeit I zwei parallele<br />
PCR-Läufe mgl. I individueller und hoher Probendurchsatz I<br />
integrierter PC mit farbigem, graphischem Touchscreen basierend<br />
auf Windows CE mit klar strukturierter Menüführung, dadurch<br />
einfache PCR-Programmierung I Möglichkeit zur individuellen<br />
Farbgestaltung<br />
Kurzbeschreibung<br />
des Produktes<br />
Veriflex Peltier-Block für 96 x 0.1 ml PCR-<br />
Gefäße oder eine 96er PCR-Platte (0.1 ml),
tebu-bio GmbH<br />
Berliner Str. 255,<br />
63067 Offenbach<br />
Tel.: +49-(0)69 801013-0<br />
Fax: +49-(0)69 801013-20<br />
ingrid.kautner@tebu-bio.<br />
com<br />
Ingrid Kautner<br />
Biometra – Part of Analytik-Jena<br />
Rudolf-Wissell-Straße 30<br />
37079 Göttingen<br />
Tel.: +49-(0)551-506860<br />
Fax: +49-(0)551-5068666<br />
www.biometra.com<br />
info@biometra.de<br />
Dr. Holger Densow<br />
BioCat GmbH<br />
Im Neuenheimer Feld 584<br />
69120 Heidelberg<br />
Tel.: +49-(0)6221-7141516<br />
Fax: +49-(0)6221-7141529<br />
info@biocat.com<br />
www.biocat.com<br />
Dr. Elke Gamer<br />
BioCat GmbH<br />
Im Neuenheimer Feld 584<br />
69120 Heidelberg<br />
Tel.: +49-(0)6221-7141516<br />
Fax: +49-(0)6221-7141529<br />
info@biocat.com<br />
www.biocat.com<br />
Dr. Elke Gamer<br />
Firma/Kontakt Applied Biosystems Deutschland<br />
Frankfurter Straße 129 B<br />
64293 Darmstadt<br />
Tel.: +49-(0)6151-9670 0<br />
Fax: +49-(0)6151-9670 5599<br />
germany.order@lifetech.com<br />
EuroTaq DNA Polymerase TProfessional Thermocycler CleanAmp Turbo Primer<br />
CleanAmp Precision Primer<br />
CleanAmp Nukleotide<br />
PRECISOR High-Fidelity DNA<br />
Polymerase<br />
Produktname TaqMan ® Array Gene Signature 96-Well<br />
Plates<br />
Die CleanAmp PCR-Primer<br />
und Nukleotide werden in der<br />
end-point und real-time PCR<br />
eingesetzt.<br />
Verschiedene PCR-Techniken I Reverse Transkription I Restriktionsverdau<br />
I Proteinkristallisation<br />
Qualitative PCR I Sticky-end-<br />
Klonierungen I Amplifikation<br />
von Standard-Templates<br />
Klonierungen, bei denen<br />
Sequenz genauigkeit wichtig<br />
ist I Blunt-end Klonierungen I<br />
Amplifikation von schwierigen<br />
Templates I Site-directed Mutagenesis<br />
PRECISOR High-Fidelity DNA-<br />
Polymerase ist eine thermostabile<br />
DNA-Polymerase, die 5’-3’ DNA-<br />
Polymerase und 3’-5’ Proofreading<br />
Exonuclease-Aktivitäten<br />
besitzt und mit hoher Sequenzgenauigkeit<br />
amplifiziert<br />
Einsatzgebiete Vorplattierte, lyophilisierte TaqMan ®<br />
Gene Expression Assays in 0.2 ml<br />
96-Well-Platten für spezifische Signalwege,<br />
biologische Prozesse und<br />
Krankheitsstatus<br />
Die CleanAmp PCR-Primer<br />
und CleanAmp-Nukleotide<br />
sind chemisch modifiziert mit<br />
hitzelabilen Gruppen und<br />
können ohne Veränderung der<br />
experimentellen Bedingungen<br />
eingesetzt werden.<br />
Mit dem TProfessional- und dem TProfessional Standard-Thermocycler<br />
bietet Biometra zwei Geräte für unterschiedliche Bedürfnisse. I Großes<br />
graphisches Display erlaubt intuitive Programmierung in Tabellen- oder<br />
graphischer Form I Quick Start-Funktion ermöglicht schnellen Zugriff auf<br />
zuletzt gestartete Programme I High Performance Smart Lid öffnet auf<br />
Knopfdruck und arretiert in geöffnetem Zustand I high speed-Silberblöcke<br />
erreichen Spitzenwerte bei Geschwindigkeit, Temperaturuniformität und<br />
sind wahlweise mit oder ohne Gradientenfunktion verfügbar I Für Hochdurchsatz-Ausrüstung<br />
mit 384 Well-Block möglich I Beim TProfessional<br />
Thermocycler lassen sich die Hochleistungsblockmodule in weniger als 10<br />
Sekunden austauschen und werden automatisch vom Gerät erkannt.<br />
EuroTaq DNA-Polymerase<br />
ist eine thermostabile DNA<br />
Polymerase (Thermus aquaticus<br />
YT1 DNA-Polymerase)<br />
Jede Packung TaqMan ® Array-Platten<br />
wird mit Plan der Plattenbelegung auf<br />
Daten-CD geliefert<br />
Kurzbeschreibung<br />
des Produktes<br />
Die chemische Modifikation<br />
blockiert die DNA-Polymerase<br />
vor der Hitzeaktivierung und<br />
verhindert die Entstehung<br />
von Primer-Dimeren und Mispriming<br />
allgemein. Aufgrund<br />
der erhöhten Spezifität lassen<br />
sich auch Proben mit sehr<br />
geringen Mengen an target<br />
zuverlässig amplifizieren. Die<br />
PCR-Reaktion kann auch mit<br />
preisgünstigeren thermophilen<br />
DNA-Polymerasen durchgeführt<br />
werden, es muss keine<br />
„hot start“-Polymerase verwendet<br />
werden.<br />
High Speed Silberblock, großes graphisches Display, Gradientenversion<br />
verfügbar, austauschbare Blöcke I Blockaustausch mgl. I Blockformate:<br />
60 well (0,5 ml) 96 well (0,2 ml), 384 well I 350 Programme I Temperaturbereich<br />
3°C-99 °C I Temperatugradient 40 °C I Temperaturuniformität<br />
(15s nach Start der Uhr) ± 0,15 °C bei 55 °C, ± 0,25 °C bei 70 °C ,±<br />
0,50 °C bei 95 °C I Kontrollgenauigkeit ± 0.1 °C I ¼ VGA Bildschirm,<br />
320 x 240 Pixel I tabellarische Programmierung (Easy Spreadsheet Programming<br />
(ESP), Graphische Programmierung I Softwareoptionen Wechsel<br />
zwischen graphischer und tabellarischer Programmierung, Grafik für<br />
Temperaturgradienten, Einstellbare Heiz- und Kühlrate, Ausführlicher<br />
Selbsttest, Service Files, Automatische Blockerkennung, PC-Kontrolle I<br />
Schnellstart der letzten 5 Programme I High Performance Smart Lid I<br />
Deckeltemperatur 30°C-99 °C I Max. Stromverbrauch 480 Watt I sehr<br />
leise I RS232 serieller Anschluss I 28 cm x 38 cm x 24 cm<br />
Hohe Thermostabilität: Toleriert<br />
stringente Denaturierungs- und<br />
Annealing-Bedingungen wie<br />
z.B. für die Amplifikation von<br />
GC-reichen Templates I Hohe<br />
Reinheit<br />
Höchste Genauigkeit: Die<br />
Genauigkeit wurde mit dem rpsL<br />
Fidelity Assay im Vergleich zu<br />
führenden High-Fidelity Enzymen<br />
bestimmt I Schnelle DNA-Synthese:<br />
15s/kb bei Templates bis<br />
zu 5kb und 30s/kb bei Templates<br />
über 5kb<br />
Technische Daten Aufgetrocknete TaqMan ® -Sondensets<br />
in 96-well-Platten brauchen nur mit<br />
Master Mix und Probe zu 20 µl Reaktionsvolumen<br />
aufgefüllt werden<br />
Marktübersicht PCR<br />
High Speed Silberblock I großes graphisches Display I tabellarische<br />
und graphische Programmierung I Schnellstartfunktion der letzten fünf<br />
Programme I linearer Gradient I netzwerkfähig I fünf verschiedene<br />
Blockmodule I Blockaustausch in wenigen Sekunden I Benutzerfreundliches<br />
Design I Geräuscharmer Betrieb<br />
Amplifikation von Templates<br />
bis zu 10kb I Hohe Prozessivität<br />
I Geeignet für Multiplex-<br />
PCR I Sehr robust I Sehr<br />
ökonomisch<br />
Hohe Sequenzgenauigkeit I<br />
Hohe Geschwindigkeit I Hohe<br />
Prozessivität I Amplifikation von<br />
Templates bis zu 30kb I Sehr<br />
robust<br />
Gensignaturen sind für Brustkrebsregulierung,<br />
p53, Apoptose, Tumor-Metastasen<br />
und über 130 weitere Krankheiten<br />
und biologische Signalwege verfügbar<br />
(www.allgenes.com). Validiert<br />
für Applied Biosystems 7000, 7300,<br />
7500 and 7900HT Fast Real-Time PCR-<br />
Systeme mit 96-well Standardblöcken.<br />
Nur für Forschungszwecke.<br />
CleanAmp dNTP Mix: 130<br />
Euro für 4 x 2 µmoles I CleanAmp<br />
Primer: 400 Euro<br />
pro Paar<br />
LABORWElT 10. Jahrgang | Nr. 5/2009 | 39<br />
Besonderheiten/<br />
Extras<br />
Maximale Heizrate 6 °C/sec, Maximale Kühlrate 4.5°C/sec I Durchschn.<br />
Heizrate 5.0 °C/sec, Durchschn. Kühlrate 3.5 °C/sec<br />
250 units, 189 Euro 1.000 units, 99 Euro Je nach Austattung 5.700 Euro bis 7.175 Euro<br />
Preis 262 Euro / 96 well-Platte, Mindestbestellmenge<br />
3
Marktübersicht PCR<br />
CyBio AG<br />
Ria Sachse<br />
Göschwitzer Straße 40<br />
07745 Jena, Deutschland<br />
Tel.: +49-(0)3641-351 0<br />
Fax: +49-(0)3641-351 409<br />
productinfo@cybio-ag.com<br />
www. cybio-ag.com<br />
BIOTREND Chemikalien GmbH<br />
Eupener Str. 157<br />
50933 Köln<br />
Tel.: +49-(0)221-9498320<br />
Fax: +49-(0)221-9498325<br />
jaeger@biotrend.com<br />
Gunther Jaeger<br />
Bio-Rad Laboratories GmbH<br />
Heidemannstr. 164<br />
D-80939 München<br />
Dr. Marcus Neusser<br />
marcus_neusser@bio-rad.com<br />
Tel.: +49-(0)89-31884-177<br />
Fax: +49-(0)89-31884-123<br />
Firma/Kontakt Biometra – A part of Analytik-Jena<br />
Rudolf-Wissell-Straße 30<br />
37079 Göttingen<br />
Tel.: +49-(0)551-506860<br />
Fax: +49-(0)551-5068666<br />
www.biometra.com<br />
info@biometra.de<br />
Dr. Holger Densow<br />
CyBi ® -8plus1<br />
Produktname T3000 Thermocycler C1000/S1000 a) GelGreen, Nucleic Acid Stain<br />
b) GelRed, Nucleic Acid Stain<br />
Anfertigen von Reaktionsansätzen wie PCR- und Sequenzierungsansätzen<br />
sowie für serielle Verdünnungen, Hit-Picking<br />
und Setzen von Standards<br />
PCR a) stain either dsDNA, ssDNA or RNA<br />
b) stain either dsDNA, ssDNA or RNA<br />
Replace Ethidium Bromide<br />
Einsatzgebiete Verschiedene PCR-Techniken I Reverse Transkription<br />
I Restriktionsverdau<br />
Pipettiersystem mit 8 und einem Kanal an einem Kopf, ermöglicht<br />
Einzelwell- oder Tubeansteuerung und spaltenweise<br />
Bearbeitung von 96- und 384-well Mikroplatten, Anzahl der<br />
Arbeitspositionen (4 bis 10) frei nach den Anforderungen konfigurierbar,<br />
Arbeitspositionen sowie Stacker sind auch später<br />
nachrüstbar<br />
a) GelGreenTM is a sensitive, stable and enviornmentally<br />
safe green fluorescent nucleic acid dye<br />
designed to stain either dsDNA, ssDNA or RNA<br />
in agarose gels. GelGreen is far more sensitive<br />
than SYBR Safe. Unlike SYBR dyes, which are<br />
known to be unstable, GelGreen is very stable,<br />
both hydrolytically and thermally. GelGreen has<br />
a UV absorption between 250 nm and 300 nm<br />
and a strong absorption peak centered around<br />
500 nm. Thus, GelGreen is compatible with<br />
either a 254 nm UV transilluminator or a gel<br />
reader equipped with visible light excitation<br />
(such as a 488 nm laser-based gel scanner or a<br />
Dark Reader) I b) GelRedTM is an ultra sensitive,<br />
extremely stable and environmentally safe fluorescent<br />
nucleic acid dye designed to replace the<br />
highly toxic ethidium bromide (EB) for staining<br />
dsDNA, ssDNA or RNA in agarose gels or polyacrylamide<br />
gels. GelRed is far more sensitive<br />
than EB without requiring a destaining step.<br />
GelRed and EB have virtually the same spectra,<br />
so you can directly replace EB with GelRed<br />
without changing your existing imaging system.<br />
The C1000 and S1000 thermal cyclers<br />
offer a flexible and modular high-end PCR<br />
platform, with features giving performance that<br />
is fast, accurate, and reproducible. The C1000<br />
also includes features such as USB flash drive<br />
data storage and the Protocol Autowriter that<br />
enables users to automatically write protocols<br />
based on their input parameters and the desired<br />
reaction speed.<br />
Weiterentwicklung des Biometra T3 dar. Ausgehend<br />
vom bewährten Dreiblock-Konzept, wurde das Gerät<br />
mit modernster Peltier-Technologie für hervorragende<br />
Heiz- und Kühlraten ausgestattet. Die Software<br />
wurde komplett überarbeitet: Anwenderfreundlich I<br />
Drei unabhängige Thermoblöcke ermöglichen, dass<br />
verschiedene Programme gleichzeitig abgearbeitet<br />
werden. Bei Parallel-Betrieb mit 3 x 48 wells: hoher<br />
Probendurchsatz. I Drei unterschiedliche Blockversionen<br />
für 0,2 ml oder 0,5ml Tubes; ein Kombiblock<br />
nimmt beide Gefäßtypen auf.<br />
Kurzbeschreibung<br />
des Produktes<br />
Volumenbereich 0,5 µl – 250 µl, 3 verschiedenen Spitzentypen<br />
5µl, 50 µl und 250 µl verwendbar, Einwegspitzen sind in den<br />
Qualitäten Standard, PCR-zertifiziert mit Filter und steril erhältlich,<br />
mögliche Plattenformate: 96, 384 und 0,2 ml-2 ml Tubes<br />
±0.2°C of programmed target at 90°C I<br />
±0.4°C well-to-well within 10 sec of arrival<br />
at 90°C I Gradient Temperature Differential<br />
1 – 24 °C within Gradient Temperature Range<br />
30-100°C<br />
Technische Daten Drei unabhängige Blöcke I Hoher paralleler<br />
Probendurchsatz I Blockformate I 3 x 20 Well<br />
(0,5 ml) I 3 x 48 Well (0,2 ml) I 3 x 18* Well<br />
und 3 x 48 Well (0,5 ml und 0,2 ml) Combi I<br />
Programmspeicher: 250 durchschnittliche Programme<br />
I Temperaturbereich 3-99 °CI Temperaturuniformität<br />
(15s nach Start der Uhr) ± 0.5 °C<br />
I Kontrollgenauigkeit ± 0.1 °C I Hochauflösendes<br />
CFL LC Display, 256 x 64 Punkte I Tabellarische<br />
Programmierung I Softwareoptionen Anpassbare<br />
Heiz- und Kühlraten I Zeitinkremente, Temperaturinkremente<br />
I High Performance Smart Lid I Dekkeltemperatur<br />
30 – 99 °C I Max. Stromverbrauch<br />
420 Watt I Geräuschemissions sehr leise I RS232<br />
serieller Anschluss I Abmessungen (B x T x H) I 30<br />
cm x 38 cm x 19 cm<br />
5.0°C/s 96-well block I 4.0°C/s 2x48-well<br />
block I 2.5°C/s 384-well block I 0° - 100°C<br />
Temperature Range<br />
40 | 10. Jahrgang | Nr. 5/2009 LABORWElT<br />
Unterschiedliche Kühladapter gewährleisten eine kontinuierliche<br />
Kühlung der Mikroplatten und Tubes bis zu 2 Stunden<br />
Heiz-/Kühlrate Durchschn. Heizrate 2.2 °C / sec, Durchschn.<br />
Kühlrate 2.0 °C / sec<br />
Pipettierkopf besteht aus einem und 8 Pipettierkanälen, Kopfwechsel<br />
während des Prozesses daher unnötig I integrierte<br />
Datenbank ermöglicht schnellen Gerätestart I einfache Bedienung<br />
durch Webbrowser-ähnliche Benutzeroberfläche I Einstellen<br />
der Liquid Handling-Parameter ermöglichen Umgang mit<br />
verschiedensten Flüssigkeiten I Pipettierer kann mit weiteren<br />
Pipettierwerkzeugen erweitert werden<br />
Patented reduced-mass 96 well sample block I<br />
Fast settling time to uniform target temperature I<br />
>1000 programs onboard I Unlimited with USB<br />
expansion I Step-based graphical, text-based,<br />
automatic with Protocol Autowriter I Full secured<br />
mode for highly regulated environments, optional<br />
login, protected folder<br />
Drei unabhängige Blöcke für drei verschiedene<br />
PCR-Läufe zur selben Zei I Hoher Probendurchsatz<br />
(bis zu 144 0,2 ml Tubes) I Tabellarische<br />
Programmierung I Maximale Flexibilität durch<br />
Combi-Block I Geringer Platzbedarf I Geräuscharmer<br />
Betrieb<br />
Besonderheiten/<br />
Extras<br />
ab 25.000 Euro<br />
Preis 9.350 Euro k.A a) 1 x 500µl 115,- Euro<br />
b) 1 x 500µl 138,- Euro
‡ Verbinden Sie bis zu<br />
30 Cycler zu einem<br />
Netzwerk<br />
‡ Minimale Verdunstung<br />
mit vapo.protect -<br />
Deckel<br />
‡ Neue Software -<br />
funktionen<br />
‡ Ein perfektes Team<br />
mit Eppendorf<br />
Consumables<br />
Reproduzierbar, spezifi sch, schnell.<br />
Der Mastercycler pro erfüllt diese Anforderungen an<br />
eine valide PCR auf einzigartige Weise.<br />
Die patentierte vapo.protect -Technologie* verhindert<br />
die Verdunstung ihres PCR-Ansatzes. Die somit gleich<br />
bleibenden Konzentrationen im PCR-Ansatz ermög lichen<br />
eine stabile und reproduzierbare Spezifi tät, unspezifi sche<br />
Bindungvorgänge werden weitestgehend vermieden.<br />
* Patents pending.<br />
Trademarks: eppendorf ® , Mastercycler ® , SteadySlope ® and vapo.protect are registered trademarks of<br />
Eppendorf AG, Hamburg, Germany. Registered trademarks are not marked in all cases in this manual.<br />
Disclaimer: This product is licensed under U.S. patent Nos. 5,525,300, 5,779,981 and 6,054,263.<br />
The heated cover device is licensed under US 5,552,580 and foreign equivalents.<br />
The user of the Eppendorf Mastercycler pro might require additional rights for kits, reagents<br />
and other components required for his/her application. Such accompanying rights for these kits,<br />
reagents and other may be obtained by the respective holder of such rights.<br />
No rights are conveyed expressly, by implication or estoppel to any patents on real-time methods,<br />
including but not limited to 5’ nuclease assays, or to any patent claiming a reagent or kit. Mastercycler<br />
pro upgraded to a Mastercycler ep realplex requires a Real-Time Thermal Cycler License under<br />
Applera’s United States Patent No. 6,814,934 and corresponding claims in non-U.S. counterparts.<br />
There’s no way out!<br />
Mastercycler pro mit vapo.protect -Verdunstungsschutz<br />
Eppendorf Vertrieb Deutschland GmbH · Peter-Henlein-Straße 2 · 50389 Wesseling-Berzdorf · Germany<br />
Tel. 01803 255911* · Fax 02232 418155 · E-mail: vertrieb@eppendorf.de · Internet: www.eppendorf.de<br />
*9 Cent/Minute aus dem deutschen Festnetz<br />
Der Mastercycler pro<br />
‡ Ultimativer Verdunstungsschutz<br />
‡ Extrem schnelle Heiz- und Kühlraten<br />
‡ Gradientenfunktion mit SteadySlope-Technologie<br />
‡ Aufrüstbar zu real-time PCR<br />
‡ Optionaler Selbsttest der Peltier-Elemente<br />
Für mehr Informationen besuchen Sie:<br />
www.eppendorf.de/pcr<br />
NEU!<br />
Testen Sie uns jetzt und fordern Sie unter<br />
01803 255911 Ihre persönliche Gerätevorführung an!<br />
eppendorf ® ist eine eingetragene Marke. Alle Rechte vorbehalten, einschließlich der Graphiken und Bilder.
Marktübersicht PCR<br />
Genzyme Virotech GmbH<br />
Löwenplatz 5<br />
65428 Rüsselsheim<br />
Dr. Heiko Hofmann<br />
Tel.: +49- (0)6142-6909-14<br />
dhh@virotech.de<br />
www.virotech.de<br />
Fluidigm Europe B.V.<br />
Locatellikade 1<br />
1076 AZ Amsterdam<br />
Tel.: +31-(0)20-5788853<br />
www.fluidigm.com<br />
Harry Boeltz<br />
Harry.Boeltz@fluidigm.com<br />
Fluidigm Europe B.V.<br />
Locatellikade 1<br />
1076 AZ Amsterdam<br />
Tel.: +31-(0)20-5788853<br />
www.fluidigm.com<br />
Harry Boeltz<br />
Harry.Boeltz@fluidigm.com<br />
Eurofins MWG Operon<br />
Anzinger Str. 7a<br />
85560 Ebersberg<br />
Tel.: +49-(0)8092-8289-0<br />
Fax: +49-(0)8092-21084,<br />
support@eurofinsdna.com<br />
Firma/Kontakt Eppendorf AG<br />
22331 Hamburg<br />
www.eppendorf.de<br />
Eppendorf Application Hotline<br />
Tel.: +49-(0)1803-666-789<br />
application-hotline@eppendorf.de<br />
Produktname Mastercycler ® pro S PCR Primer, PCR Primer Design Tool Fluidigm Access Array System Biomark System GeneXpert ® ( der Firma Cepheid)<br />
Diagnostik von Infektionskrankheiten und Leukämien<br />
Für qPCR, Genexpression, SNP-Genotyping,<br />
CNV u.v.m<br />
PCR-basiertes System zur gleichzeitigen<br />
Herstellung von 48 Libraries<br />
für Next Generation Sequenziergeräte.<br />
Für Sample Capture und Target<br />
Enrichment, Sample Barcoding für<br />
multiplex Sequencing und Sequencing<br />
Library Preparation mit Hilfe von<br />
Amplicon Tagging<br />
Einsatzgebiete PCR in Forschung und Diagnostik Standard PCR, Multiplex PCR, RT-PCR,<br />
qPCR, DNA Sequencing<br />
GeneXpert ist völlig modular und voll automatisiert,<br />
keine Serienverarbeitung und Gerätevorschaltung<br />
nötig.<br />
9.000 PCR-Reaktionen in vier Stunden<br />
bei erheblich reduziertem Assayverbrauch<br />
und Pipettieraufkommen simultan. Aus<br />
einzelnen Zellen können gleichzeitig bis<br />
96 Gene in qPCR-Datenqualität bestimmt<br />
werden. Einziges kommerzielles System für<br />
die digitale PCR zur absoluten Bestimmung<br />
der Zielsequenzen. Übliche Chemie, wie<br />
TaqMan ® , und interkalierende Farbstoffe<br />
sind kompatibel. Das Biomark Real<br />
Time-System ist für den Einsatz der nanofluidischen<br />
Dynamic und Digital Arrays<br />
entwickelt. Das Komplettsystem bestehend<br />
aus einem IFC Controller, Thermocycler,<br />
CCD-Kamera und der Auswertesoftware für<br />
Genotypisierungen, Geneexpression und<br />
digitaler PCR vereinfacht den Arbeitsablauf<br />
für Hochdurchsatz-PCR-Applikationen.<br />
Parallele nL-Reaktionen: I Real-Time PCR:<br />
2.304 / 9.216 I SNP Genotyping: 2.304 /<br />
9.216 I Digital PCR: 9.180 / 36.960<br />
Das Access Array besteht aus 2<br />
Access Array IFC Controllern zum Beladen<br />
der IFCs und Wiedergewinnen<br />
der Proben und einem Thermocycler.<br />
Das System kann mit jeder PCRbasierten<br />
Probenvorbereitung und<br />
den kundenspezifischen Reagenzien<br />
und Primern verwendet werden.<br />
The specifications of Eurofins MWG<br />
Operon’s PCR Primer are pre-defined<br />
and optimised for standard PCR applications<br />
and sequencing reactions. PCR<br />
Primer Design Tool suggests a range of<br />
optimal primers or pairs of primers for<br />
PCR, RT-PCR or sequencing reactions.<br />
The online design tool is available free<br />
of charge. On demand and for special<br />
requests, individual project design<br />
services supported by our bioinformatic<br />
specialists are available.<br />
Die extrem schnellen Heiz- und<br />
Kühlraten des Mastercycler pro<br />
sorgen für die nötige Geschwindigkeit<br />
der PCR. Die patentierte vapo.<br />
protect-Technologie verhindert die<br />
Verdunstung des PCR-Ansatzes. Drei<br />
verschiedene Blockformate sind verfügbar,<br />
alle mit einem horizontalen<br />
Gradienten (die 96er-Blöcke sind<br />
aufrüstbar zu real-time PCR)<br />
Kurzbeschreibung<br />
des Produktes<br />
Amplifikationsprinzip RT-PCR I Detektionsprinzip<br />
Sechs-Kanal-Anregungsmodul: Hochleistungs-<br />
LEDs zur Anregung I Sechs-Kanal-Detektionsmodul:<br />
Silizium-Fotodetektoren und Filter I Der<br />
GeneXpert ist ein voll modulares System. Masse<br />
und Gewicht sind von der Anzahl der benötigten<br />
Testungseinheiten (Module) abhängig.<br />
Input: 48 Proben und 48 Primerpaare<br />
I 2.304 PCR-Reaktionen in vorgegebenen<br />
30 nL Reaktionskammern<br />
I Output: Automtisches Poolen aller<br />
sequenzierfertigen Amplicons<br />
Synthesis yield: 30nmol (6 OD) I Primer<br />
lengths: 15-29 bases I Delivery format:<br />
lyophilised I Quality control by Trityl<br />
monitoring, OD measurement, MALDI-<br />
TOF MS I Primers are shipped next day<br />
after Ecom order receipt I a free PCR<br />
Primer Design Tool suggests a range of<br />
optimal primers or pairs of primers for<br />
PCR, RT-PCR or sequencing reactions,<br />
using a set of physical parameters. The<br />
primers are scored in relevance to the<br />
predicted best performance criteria. The<br />
most favourable primer can be found at<br />
the first position. It can also be combined<br />
with a database search. The primers<br />
are checked against the RefSeq mRNA<br />
database (NCBI) to make sure that the<br />
primers have no critica<br />
Technische Daten Temperierbereich: 4-99°C I<br />
Blockhomogenität:20°-72°C:≤<br />
±0,3°C; 95°C: ≤ ±0,4°C I Regelgenauigkeit:<br />
±0,2°C I Speicherkapazität:<br />
>700 Programme<br />
42 | 10. Jahrgang | Nr. 5/2009 LABORWElT<br />
Heizen > 2°C/s I Kühlen > 1°C/s Heizen > 2°C/s I Kühlen > 1°C/s Heizraten (max.): 10 °C/Sek von 50-95 °C, Kühlraten<br />
(max.): 2,5 °C/Sek von 95-50 °C<br />
Heiz-/Kühlrate Heizen: 6°C/s (Impulsfunktion: im<br />
ersten Zyklus 8°C/s) I Kühlen: 4°C/s<br />
Random Access, 1-48 unabh. Testeinheiten, die<br />
mit beliebigen Xpert-Tests beladen w. können. I<br />
Serientestung und Einzeltestung mit gleichem Zeitaufwand<br />
I keine spezifische PCR-Laboraustattung<br />
u. Personal nötig I 24Std/7Tage durchführbar I<br />
Einziges PCR-System mit LIMS plug-in I PCR-Reagenzien<br />
geschlossen in Testkartusche = optimaler<br />
Kontaminationsschutz<br />
Ein 96.96 Dynamic Array entspricht 24<br />
384er Mikrotiterplatten. 192 Pipettierschritte<br />
statt 18.432 zum Ansetzen<br />
notwendig.<br />
Biomark Real Time-PCR-Systeme<br />
sind erweiterbar auf das Access Array<br />
System<br />
Synthesis report, Oligo data sheet, Quality<br />
report & delivery note are provided<br />
online free of charge I Customised tube<br />
label layouts can be selected I Extra<br />
tube labels are available<br />
Steuerbar über Control Panel (bis zu<br />
5 Module) oder PC-Software (bis zu<br />
30 Module). GLP-konforme Report<br />
Files und Benutzerverwaltung. Besondere<br />
vapo.protect-Technologie zur<br />
Vermeidung von Verdunstung.<br />
Besonderheiten/<br />
Extras<br />
k.A. Preis je Datenpunkt qPCR ab ca. 12 Cent<br />
Preis je Datenpunkt SNP ab ca. 5 Cent<br />
PCR Primer: Independent from primer<br />
length: 9,90 Euro<br />
Preis 10.350 Euro (inkl. Control Panel<br />
zzgl. USt.)
Microsynth AG<br />
Schützenstr. 15<br />
CH-9436 Balgach<br />
Tel.: +41-(0)71-722-8333<br />
Fax.: +41-(0)71-722-8758<br />
Dr. Johannes Haugstetter<br />
johannes.haugstetter@<br />
microsynth.ch<br />
Lonza Cologne AG<br />
Nattermannallee 1<br />
50829 Köln<br />
Dr. Volker Vogel<br />
Tel.: +49-(0)221-99199 400<br />
volker.vogel@lonza.com<br />
Invitrogen GmbH<br />
Emmy-Noether Str. 10<br />
76131 Karslruhe<br />
euroinfo@invitrogen.com<br />
www.invitrogen.com<br />
Invitek GmbH - A Stratec Business<br />
Robert-Rössle-Str. 10<br />
13125 Berlin<br />
Frau Sonja Farhangi<br />
sfarhangi@invitek.de<br />
Tel.: +49-(0)30-9489-2894<br />
Fax: +49-(0)30-9489-2909<br />
Firma/Kontakt Hölle & Hüttner AG<br />
Derendinger Straße 470<br />
72072 Tübingen<br />
Dr. Steffen Hüttner<br />
www.h-net.com<br />
StellARray TM Gene Expression System PCR- und Real Time PCR-Service.<br />
InviTaq Hot Start DNA Polymerase 1. SuperScript ® VILO cDNA Synthesis<br />
Kit I 2. Express qPCR & qRT-PCR<br />
Kits<br />
Produktname Software für PCR-Fragestellungen:<br />
Steuerung, Vernetzung, Datenauswertung,<br />
Kitbezogene Standardauswertungen<br />
und zur Simulation<br />
Qualitative und/oder quantitative (Real<br />
Time) PCR-Analysen. Z.B. zur Qualitätssicherung,<br />
Target-Validierung, Genexpressionsanalyse,<br />
Nachweis von Mikroorganismen<br />
und Nachweis von GVO<br />
umfassende Produktgruppe zur Genexpressionsanalyse,<br />
Anwendung z.B. in RNAi,<br />
mRNA-Profiling, Validierung von „Hits“ aus<br />
Whole-Genome-Arrays.<br />
1. RT-PCR und qRT-PCR Applikation bei<br />
variablem Input und linearem Output I<br />
2. Erhöhter Durchsatz für Fast-Cycling<br />
Instrumente, 1-Schritt und 2-Schritt<br />
PCR<br />
complex genomic templates I Ecomplex cDNA<br />
templates I Every low-copy targets I reactions<br />
with multiple primer pairs<br />
Einsatzgebiete Unternehmen, die Geräte für PCR<br />
entwickeln, vertreiben bzw. PCRbasierte<br />
Kits herstellen<br />
Projektentwicklung und -beratung I<br />
DNA- und RNA- Präparationen I (Real<br />
Time) PCR-Assay-Entwicklung I Synthese<br />
von Primer-Probe-Sets I Validierung<br />
von PCR-/qPCR-Assays I Probenanalyse<br />
und Auswertung im Hochdurchsatz<br />
Komponenten: GeneSieve Bioinformatics-Software<br />
zur Suche der für einen<br />
bestimmten Forschungsbereich besonders<br />
relevanten Gene und der entsprechenden<br />
StellARray qPCR Arrays I Vorgefertigte oder<br />
individuell nach Kundenwunsch zusammengestellte<br />
StellARray qPCR-Arrays im<br />
96- und 384-Well Format für die meisten<br />
handelsüblichen qPCR Geräte I Global<br />
Pattern Recognition (GPR) Software zur<br />
präzisen und komfortablen Auswertung<br />
der qPCR Daten ohne die Notwendigkeit<br />
der Verwendung von vordefinierten<br />
„Housekeeping“-Genen.<br />
1. Zuverlässige first-strand cDNA-<br />
Synthese bei sehr hohen Ausbeuten<br />
I 2. Kits für die schnelle RT-PCR und<br />
qRT-PCR<br />
The InviTaq Hot Start DNA Polymerase + the<br />
supplied buffer is especially suited for real-time-<br />
PCR reactions with fluorescence probe detection<br />
by 5’-3’-exonuclease digest. The 5’-3’ DNA<br />
exonuclease activity has a broad thermal range<br />
(50 - 74°C). The thermal activation prevents the<br />
extension of nonspecifically annealed primers<br />
and primer dimers formed at low temperatures<br />
during PCR setup. The polymerase contains<br />
monoclonal antibodies which block polymerase<br />
activity prior to the onset of thermal cycling. The<br />
enzyme requires no prolonged heating or denaturing<br />
step. The antibodies are inactivated during<br />
an initial denaturation step of 5 minute at 95°C<br />
which can be incorporated into any existing<br />
thermal-cycler program.<br />
Umfangreiche Software-Bibliothek<br />
im Themenfeld PCR-Technologie,<br />
die nach Kundenanforderungen zur<br />
OEM- Produkten oder in Lizenz umgesetzt<br />
wird.<br />
Kurzbeschreibung<br />
des Produktes<br />
Automatisierte Probenaufbereitung<br />
(Tecan, Qiagen), Analyse mit Geräten von<br />
ABI, Roche und Qiagen. Zertifizierung<br />
nach ISO 9001:2000 und Akkreditierung<br />
der analytischen Abteilungen nach ISO<br />
17025 (STS 429).<br />
1. Superscript ® III in einem optimierten<br />
Puffersystem I 2) Schnell-Aktivierung,<br />
Antikörper-basierte Platinium ® -<br />
Taq Polymerase<br />
Technische Daten Software unter Windows Volume Activity: 5 units / µl I E10x Reaction<br />
Buffer I E250 mM Tris-HCl pH 8.3 (at 25 °C),<br />
500 mM KCl I Mg2+ Solution<br />
50 mM MgCl (recommended final concentra-<br />
2<br />
tion: 1-6 mM)<br />
Umfangreicher Service im Bereich DNA-<br />
& RNA-Synthese, DNA-Sequenzierung<br />
und Genotyping. Weitere Informationen<br />
unter www.microsynth.ch.<br />
Marktübersicht PCR<br />
Besonders präzise Normalisierung der<br />
Genexpressionsdaten: die StellARray<br />
Analysesoftware findet die für das individuelle<br />
Experiment am besten geeigneten<br />
Normalisierungsgene und verzichtet auf<br />
die Verwendung von vordefinierten, häufig<br />
inkonstanten „Housekeeping“ Genen.<br />
Umfassendes Angebot von mehr als 150<br />
Forschungsbereich-spezifische qPCR-Arrays<br />
für die gebräuchlichsten qPCR-Geräte.<br />
Neben “Expression Profiling” werden auch<br />
“Gene Copy Number Variation” (CNV)-<br />
Experimente unterstützt<br />
1. akkurate und sensitive Quantifizierung<br />
bei einer Linearität von 1<br />
pg-2,5 µg, konsistente Ergebnisse,<br />
hohe Ausbeuten und ideal für cDNA<br />
Archivierung I 2. Weniger Carry-over,<br />
Verbesserte Detektion durch SYBR ®<br />
GreenER in den SYBR ® kits, flexibles<br />
Format mit ROX oder separat für verschiedene<br />
Instrumente, Hochdurchsatz<br />
& Fast-Cycling-Instrumente<br />
reduced nonspecific amplification I high PCR<br />
specificity with minimal optimization I easy<br />
handling and room-temperature setup<br />
LABORWElT 10. Jahrgang | Nr. 5/2009 | 43<br />
Besonderheiten/<br />
Extras<br />
Preis als OEM-Lösng bzw. im Lizenzmodell 100 Units: 51,00 €
Marktübersicht PCR<br />
PEQLAB Biotechnologie<br />
GmbH<br />
Carl-Thiersch-Str. 2b<br />
D-91052 Erlangen<br />
Tel.: 09131-610 70 20<br />
Fax: 09131-610 70 99<br />
info@peqlab.de<br />
www.peqlab.de<br />
Kerstin Hardung<br />
Promega GmbH<br />
Schildkrötstraße 15<br />
68199 Mannheim<br />
Tel./Fax: +49-(0)621<br />
8501-0/8501-222<br />
techsev@promega.<br />
com, www.promega.<br />
com, Katja Krauth<br />
New England Biolabs GmbH<br />
Brüningstr. 50, Geb. G810<br />
65926 Frankfurt/Main<br />
www.neb-online.de<br />
info@de.neb.com<br />
Tel: 0800-246-5227 (in D)<br />
Tel: 00800-246-52277 (in A)<br />
New England Biolabs GmbH<br />
Brüningstr. 50, Geb. G810<br />
65926 Frankfurt/Main<br />
www.neb-online.de<br />
info@de.neb.com<br />
Tel: 0800-246-5227 (in D)<br />
Tel: 00800-246-52277 (in A)<br />
Millipore GmbH<br />
Bioscience Division<br />
Am Kronberger Hang 5<br />
65824 Schwalbach/Ts<br />
www.millipore.com<br />
technischerservice@millipore.com<br />
06196-494-299 (Deutschland)<br />
0433994049 (Schweiz)<br />
0820874464 (Österreich)<br />
Firma/Kontakt Millipore GmbH<br />
Bioscience Division<br />
Am Kronberger Hang 5<br />
65824 Schwalbach/Ts<br />
www.millipore.com<br />
technischerservice@millipore.com<br />
06196-494-299 (Deutschland)<br />
0433994049 (Schweiz)<br />
0820874464 (Österreich)<br />
Produktname? Montage ® PCR Cleanup Kit Amicon ® Ultra 0.5-Zentrifugaleinheiten Tq-Polymerase-Falilie* Proof Reading-Polymerasen: GoTaq ® -Produkt-Familie Primus 25 advanced ®<br />
Alle Arten klassischer PCR<br />
PCR, Hotstart-PCR und<br />
Real-time-PCR<br />
High-Fidelity PCR, besonders<br />
schnelle PCR, optimal auch für<br />
schwierige Templates, Hochdurchsatz<br />
Routine-PCR, Genotypisierungen,<br />
Hochdurchsatzexperimente,<br />
DHPLC, Kolonie-PCR, Lange Amplifikate<br />
(LongAmp Taq), direkte<br />
PCR an Blut oder Bodenproben,<br />
Multiplex-PCR<br />
Aufreinigung von PCR-Produkten (Entfernung<br />
von Primern und freien Nucleotiden,<br />
Umpufferung) mit Ultrafiltrationseinheiten<br />
für die Zentrifuge<br />
Einsatzgebiete Aufreinigung von PCR-Produkten im<br />
Multiwell-Format (Entfernung von<br />
Primern und freien Nucleotiden, Umpufferung)<br />
Kompakter Arbeitsplatz-<br />
Cycler, der dennoch größtmögliche<br />
Flexibilität bietet.<br />
Die GoTaq ® -Produktfamilie<br />
beinhaltet Einzelenzyme<br />
und Master<br />
Mix für alle gängigen<br />
PCR- und Real- Time<br />
PCR-Applikationen.<br />
Phusion ®-Serie: „Designer-Enzym“<br />
mit zusätzlicher DNA-Bindedomäne<br />
für außergewöhnlich gute<br />
PCR-Eigenschaften: geringste<br />
Fehlerrate aller PCR-Polymerasen<br />
im Markt kombiniert mit höchser<br />
Zuverlässigkeit = ideal für Klo-<br />
Rekombinante Enzyme höchster<br />
Reinheit und Qualität,<br />
zuverlässige Amplifikationen<br />
mit hoher Ausbeute, große<br />
Auswahl optimierter Puffer-<br />
Formulierungen:Taq DNA Polymerase<br />
mit „Thermopol-Puffer“<br />
Taq I DNA-Polymerase mit Detergenz-freiem<br />
„Standard“-Puffer<br />
I Crimson Taq-DNA-Polymerase<br />
- für PCR im Gel-Ladepuffer I<br />
LongAmp Taq-DNA-Polymerase –<br />
für Amplifikate bis 40 kb I HemoKlen<br />
Taq – für direkte PCR an<br />
Voll-Blut I Multiplex-PCR-Master<br />
Mix – bis zu 15-plex PCR I für<br />
Routine-PCRs: Phire ® Hot Start-<br />
DNA-Polymerase I Phire ® Plant<br />
Direct PCR Kit I DyNAzyme II Hot<br />
Start-DNA-Polymerase<br />
Millipores Amicon ® Ultra 0.5-Einheiten<br />
sind Ultrafiltrationseinheiten für die Zentrifuge<br />
mit 2ml Auffanggefäßen für Probenvolumina<br />
bis 500µl. Sie ermöglichen<br />
die Aufreinigung von PCR-Produkten für<br />
Sequenzierungen, Genotypisierungen<br />
oder Microarrays.<br />
Millipores Montage ® PCR Cleanup Kits<br />
verwenden ein auf Ultrafiltration basierendes<br />
Größenausschlussverfahren und<br />
werden über Vakuumfiltration betrieben.<br />
Sie ermöglichen im 96-Well- oder<br />
384-Well-Format die Aufreinigung von<br />
PCR-Produkten (≥ 100 bp) für Sequenzierungen,<br />
Genotypisierungen oder<br />
Microarrays.<br />
Kurzbeschreibung<br />
des Produktes<br />
nierungsexperimente I Vent/Deep<br />
® Vent Serie: proof reading PCR-<br />
R<br />
Enzym mit der höchsten Halbwertszeit<br />
bei 95°C, ideal für lange<br />
Inkubationszeiten, kostengünstig!<br />
Blockkapazität: Universalblock<br />
für 25 x 0.2 ml Tubes<br />
oder 13 x 0.5 ml Tubes mit<br />
flachem Deckel I Temperaturbereich:<br />
4 °C bis 105<br />
°C I Regelgenauigkeit: ±<br />
0.1 °C I Blockuniformität<br />
(bei 72°C): ± 0.7 °C I Max.<br />
Programmzahl: 90 (mit bis<br />
zu 99 Schritten/ Programm)<br />
I Max. Heizrate: 2 °C/s I<br />
Max. Kühlrate: 2 °C/s<br />
44 | 10. Jahrgang | Nr. 5/2009 LABORWElT<br />
I Phusion ® High Fidelity-DNA-<br />
Technische Daten Montage ® PCR96: 96-well Filterplatte<br />
(bis 150-300 µl/well Probenvolumen),<br />
erhältlich mit 10 und 50 Platten pro<br />
Packung<br />
Polymerase , auch als Kits und<br />
Mastermixes I Phusion ® -Hot Start-<br />
High Fidelity DNA-Polymerase),<br />
auch als Kits und Mastermixes I<br />
® Vent -DNA- Polymerase I Deep-<br />
R<br />
® Vent -DNA-Polymerase<br />
R<br />
Millipore’s Amicon ® Ultra 0.5-Einheiten<br />
zeichnen sich durch eine hohe<br />
Produktwiederfindung (typischerweise<br />
>90%) aus. Das vertikale Membrandesign<br />
verhindert die Verblockung<br />
der Membran und ermöglicht kürzere<br />
Zentrifugationszeiten. Der „Deadstop“<br />
verhindert das Trockenlaufen der Probe<br />
und die damit verbundene geringere<br />
Probenwiederfindung. Die Möglichkeit<br />
zur Umkehrzentrifugation optimiert die<br />
Probenrückgewinnung.<br />
Heizdeckel mit automatischer<br />
Höhenanpassung I<br />
GLP-Report dokumentiert<br />
Anwendung und Anwender<br />
I Ansteuerung mittels<br />
PC möglich I platzsparend<br />
Erfolgreiche PCR auch bei<br />
schwierigem DNA-Ausgangsmaterial.<br />
Alle Kits<br />
für die klassische PCR-<br />
Applikation beinhalten<br />
sowohl einen farblosen,<br />
als auch einen grünen<br />
Puffer, der direktes Beladen<br />
von Gelen erlaubt.<br />
Millipores Amicon ® Ultra 0.5-Einheiten<br />
sind mit verschiedenen Trenngrenzen<br />
(3/10/30/50/100 kDa) und Packungsgrößen<br />
(8/24/96/500 Stk/Pkg) erhältlich.<br />
Auch erhältlich mit 96- (bis 150 µl/well<br />
Probenvolumen) und 384-well-Platten<br />
(bis 100 µl/well Probenvolumen)<br />
Besonderheiten/<br />
Extras<br />
2.645 Euro<br />
Routine-PCR-Anwendungen<br />
ab 0,13Euro/U, Real-<br />
Time PCR ab 1,10 Euro/<br />
Reaktion<br />
Amicon ® Ultra 0.5-Einheiten 8 Stk/Pkg<br />
40 Euro I Amicon ® Ultra 0.5-Einheiten 24<br />
Stk/Pkg 93 Euro I Amicon ® Ultra 0.5-Einheiten<br />
96 Stk/Pkg 311 Euro<br />
Preis Montage ® PCR96 Cleanup Kit, 10 Stk<br />
451 Euro I Montage ® PCR96 Cleanup Kit,<br />
50 Stk 1787 Euro I Montage® PCRµ96<br />
Cleanup Kit, 10 Stk 441 Euro I Montage ®<br />
PCRµ96 Cleanup Kit, 50 Stk 1769 Euro<br />
I Montagev PCR384 Cleanup Kit, 10 Stk<br />
960 Euro I Montage ® PCR384 Cleanup<br />
Kit, 50 Stk 3444 Euro
Roche Diagnostics GmbH<br />
Sandhofer Straße 116<br />
68305 Mannheim,<br />
Fachliche Information<br />
Tel.: +49-(0)621-759-8568<br />
mannheim.biocheminfo@roche.com<br />
www.roche-applied-science.com<br />
Roche Diagnostics GmbH<br />
Sandhofer Straße 116<br />
68305 Mannheim,<br />
Fachliche Information<br />
Tel.: +49-(0)621-759-8568<br />
mannheim.biocheminfo@roche.com<br />
www.roche-applied-science.com<br />
PromoCell GmbH<br />
Sickingenstrasse 63 / 65<br />
D-69126 Heidelberg<br />
Tel.: +49-(0)6221-64934-0<br />
Fax: +49-(0)6221-64934-40<br />
www.promokine.de<br />
info@promokine.de<br />
Dr. Jürgen Becker<br />
Firma/Kontakt PromoCell GmbH<br />
Sickingenstraße 63/65<br />
D-69126 Heidelberg<br />
Tel.: +49-(0)6221-64934-0<br />
Fax: +49-(0)6221-64934-40<br />
www.promokine.de<br />
info@promokine.de<br />
Dr. Jürgen Becker<br />
Produktname PCR Mycoplasma Test Kits PCR Bacteria Test Kits LightCycler ® 2.0 System LightCycler ® 480 System<br />
Mikrotiterplatten-basiertes Real-Time-PCR-System für mittleren<br />
und Hochdurchsatzbereich, Genexpressionsanalysen mittels Relativer<br />
QuantifizierungLightCycler ® 480 System, absolute Quantifizierung<br />
von Nukleinsäuren, Genotypisierung bekannter Mutationen,<br />
Mono-Color und Multiplex-PCR, Gene Scanning<br />
Kapillar-basiertes Real-Time PCR-System für in vitro-<br />
Diagnostik I qualitative u. quantitative Detektion von<br />
Nukleinsäuren, Genotypisierung. Dank der großen<br />
Flexibilität bei den Detektionsformaten, wie z.Bsp. SYBR<br />
Green I, Hybridisierungs- und Hydrolysesonden, kann<br />
jede gängige Applikation durchgeführt werden.<br />
Eubakterien-Detektion in Zellkulturen<br />
(research use only)<br />
Einsatzgebiete Mykoplasmen-Detektion in Zellkulturen (research use<br />
only)<br />
Patentierte Therma-Base-Technologie sorgt für optimale wellto-well<br />
Temperaturhomogenität. I Schnelle Heiz- und Kühlraten:<br />
Heizen: 4,8°C/s, Kühlen: 2,5°C/s. I Hardware: modulares<br />
System: wahlweise 96- oder 384-Well-Format. I Patentierte<br />
Optik ermöglicht präzise Signaldetektion unabhängig von Probenposition,<br />
Normalisierung über Referenzfarbstoffe ist nicht<br />
notwendig. I 6 Detektionskanäle für große Flexibilität bei der<br />
Wahl der Detektionsfarbstoffe. I bedienerfreundliche Software<br />
mit hochgenauen Auswertelogarithmen. I auf alle Detektionsformate<br />
optimal abgestimmte, gebrauchsfertige Mastermixe<br />
verfügbar, alle gängigen Detektionsformate einsetzbar<br />
Sehr schnelle PCR in 20 min bei systembedingt perfekter<br />
Temperaturhomogenität und online Detektion.<br />
PCR-basierter Kit (konventionelle<br />
PCR) zum schnellen und sensitiven<br />
Nachweis von Eubakterien<br />
in Zellkulturen. Auswertung über<br />
Gelelektophorese.<br />
PCR-basierte Kits (konventionelle und Real-Time PCR)<br />
zum schnellen und sensitiven Nachweis von Mykoplasmen<br />
in Zellkulturen. Auswertung über Gelelektophorese<br />
oder mit Real Time PCR-Cyclern verschiedener Hersteller<br />
Kurzbeschreibung<br />
des Produktes<br />
Platzsparendes Tischgerät: 45 cm x 30 cm x 40 cm I<br />
Probenkarussel für 32 Kapillaren I Anregung: 470 nm;<br />
Detektion: 530 nm, 555 nm, 610 nm, 640 nm, 670 nm,<br />
710 I schnelle Heiz- und Kühlzeiten: 20°C/s<br />
PCR Bacteria Test Kit besteht<br />
aus: Reaktionsgefäßen mit lyophilisierten<br />
Primern und dNTPs;<br />
DNA-Template/Interne Kontrolle,<br />
DNA-Template/Positivkontrolle;<br />
Reaktionspuffer; EUB-Polymerase;<br />
48 PCR-Tests<br />
Tischgerät: B 57.4 cm x T 58.8 cm x H 49.7 cm; Reaktionsvolumen<br />
5 µl–20 µl (384-well), 10 µl – austauschbare Thermoblöcke:100<br />
µl (96-well) I Anregungsfilter (nm): 440, 465, 498,<br />
533, 618; Detektionsfilter (nm): 488, 510, 580, 610, 640, 660<br />
Technische Daten PCR Mycoplasma Test Kit I/C besteht aus: Reaktionsgefäßen<br />
m. lyophilis. Primern, dNTPs + DNA-Template/Interne<br />
Kontrolle; Reaktionsgefäßen m lyophilis. Pri mern, dNTPs<br />
u. DNA-Template/Positivkontrolle; Rehydrierungspuffer;<br />
Hot-Start Taq-Polymerase; 24, 48 bzw. 96 PCR-Tests I PCR<br />
Mycoplasma Test Kit I/RT besteht aus: Reaktionsgefäßen m.<br />
lyophilisierten Primern, dNTPs u. Mykoplasmen-spezifischer<br />
Sonde; Inhibition Control Spike (lyophilisiert); Reaktionspuffer;<br />
DNA-freies Wasser; Hot-Start Taq Polymerase; 25<br />
PCR-Tests I PCR Mycoplasma Test Kit II besteht aus: Reaction-Mix<br />
(Primer, dNTPs, Taq-Polymerase), Buffer Solution,<br />
DNA-Template/Positivkontrolle; 10 bzw. 20 PCR-Tests<br />
Marktübersicht PCR<br />
sehr schnelle PCR mit online Detektion: 40 min im 384er Format;<br />
60 min im 96 er Format I sehr einfach und schnell austauschbare<br />
Thermoblöcke für 96- Well oder 384-Mikrotiterplatten I präzise<br />
Signaldetektion unabhängig von Probenposition durch patentierte<br />
Optik I 6 Detektionskanäle für große Flexibilität bei der Wahl der<br />
DetektionsfarbstoffeSoftware: I bedienerfreundliche Software mit<br />
hochgenauen Auswertealgorithmen I High Resolution Melting<br />
(HRM) Farbstoff in Kombination mit der LightCycler ® 480 Gene<br />
Scanning Software ideal geeignet zur Detektion von bekannten<br />
und unbekannten SNPs I Reagenzien: große Flexibilität bei den<br />
Detektionsformaten, wie z.B. SYBR Green I, Hybridisierungs- und<br />
Hydrolysesonden I Mit der Universal ProbeLibrary kann ein komplettes<br />
Transkriptom einer selektierten Spezies mit 90 vorvalidierten<br />
Detektionsproben abgedeckt werden. Weitere Spezies können<br />
mit einem Erweiterungsset abgedeckt werden. Ein kompetter<br />
qPCR Assay kann innerhalb von 24 Stunden etabliert werden.<br />
www.universalprobelibrary.com I Alle Maßnahmen zur Qualitätssicherung<br />
(IQ,OQ,PQ) verfügbar I Bar Code Reader I Kompatibel mit<br />
Laborautomation (LIMS)<br />
Hardware: sehr schnelle PCR mit online-Detektion : 20 min<br />
I 32 Kapillaren I 6 Detektionskanäle für große Flexibilität<br />
bei der Wahl der Detektionsfarbstoffe I große Flexibilität<br />
bei den Detektionsformaten, wie z.B. SYBR Green I,<br />
Hybridisierungs- und Hydrolysesonden I Probenvolumen<br />
wahlweise 20µl oder 100µl I Software: bedienerfreundliche<br />
Software mit hochgenauen Auswertealgorithmen I<br />
Reagenzien: umfangreiches funktionsgetestetes Reagenzienangebot<br />
für RT-PCR und PCR I Mit der Universal Probe-<br />
Library kann ein komplettes Transkriptom einer selektierten<br />
Spezies mit 90 vorvalidierten Detektionsproben abgedeckt<br />
werden. Weitere Spezies können mit einem Erweiterungsset<br />
abgedeckt werden. Ein kompetter qPCR-Assay kann<br />
innerhalb von 24 Stunden etabliert werden. www.universalprobelibrary.com<br />
Kit detektiert schnell, hochspezifisch<br />
und sehr sensitiv zahlreiche<br />
Eubakterien-Arten, u.a. Pseudomonas,<br />
Actinomyces, Escherichia,<br />
Serratia, Porphyromonas,<br />
Fusobacteria, Staphylococcus,<br />
Streptococcus, Lactobacillus,<br />
Micrococcus, Bacillus, Klebsiella,<br />
Salmonella, Enterococcus,<br />
Mycobacterium, Legionella,<br />
Prevotella, Peptostreptococcus.<br />
Eukaryotische DNA wird hingegen<br />
nicht amplifiziert. Einfache<br />
Probenvorbereitung.<br />
Kits detektieren schnell, hochspezifisch und sehr sensitiv:<br />
M. agalactiae, M. arginini, M. arthritidis, M. bovis,<br />
M. capricolum, M. cloacale, M. falconis, M. faucium, M.<br />
fermentans, M. hominis, M. hyorhinis, M. hyosynoviae,<br />
M. opalescens, M. orale, M. pneumoniae, M. pirum, M.<br />
primatum, M. pulmonis, M. salivarium, M. spermatophilum<br />
und M. timone sowie verschiedene Acholeplasma-<br />
(z.B. A. laidlawii) und Spiroplasma-Arten. Einfache<br />
Probenvorbereitung.<br />
LABORWElT 10. Jahrgang | Nr. 5/2009 | 45<br />
Besonderheiten/<br />
Extras<br />
2.645 Euro<br />
PCR Bacteria Test Kit: 219 Euro<br />
(48 Tests)<br />
Preis PCR Mycoplasma Test Kit I/C: 125 Euro (24 Tests) I PCR<br />
Mycoplasma Test Kit I/RT: 225 Euro (25 Tests) I PCR<br />
Mycoplasma Test Kit II: 70 Euro (10 Tests)
Service Stellenmarkt<br />
Akademischer Stellenmarkt<br />
Veröffentlichen Sie Ihre Stellenanzeigen zielgruppengerecht in unserem akademischen Stellenmarkt (auch online), der allen nicht-kommerziellen Instituten<br />
für ihre Stellenausschreibungen kostenlos zur Verfügung steht. Bitte senden Sie dazu Ihre Anzeige (1/4 Seite 90 mm breit x 122,5 mm hoch, Logo –<br />
jpg oder tiff, 300 dpi Auflösung) an a.macht@biocom.de. Annahmeschluss für die nächste LABorweLt-Ausgabe „Mikrobielle Genomforschung<br />
& Metabolic engineering“ (erscheinungstermin 26.11.2009) ist der 13. November 2009.<br />
FRIEDRICH-SCHILLER-UNIVERSITÄT JENA<br />
Medizinische Fakultät – Institut für Biochemie I – Prof. Dr. Britta Qualmann<br />
2 Doktorand(in)en<br />
gesucht<br />
Das Institut für Biochemie I sucht zwei engagierte Doktorand(in)en mit<br />
Interesse an der Identifizierung und Charakterisierung bisher unbekannter<br />
Proteininteraktionen von Modulatoren des Aktincytoskeletts und Vesikelbildungsmaschinerien<br />
Unser Ziel ist es, die funktionelle Schnittstelle von Membranen und dem Aktincytoskelett<br />
aufzuklären und die Dynamik dieser beiden, für eukaryontische Zellen<br />
lebenswichtigen Strukturen zu verstehen. Dies liefert vertiefte Einsichten in die<br />
Bildung und Plastizität der definierten Zellmorphologien, auf denen die Organund<br />
Gewebebildungen multizellulärer Organismen beruhen. Auf der subzellulären<br />
Ebene liefern unsere Arbeiten Erkenntnisse über Membran-Modulationen durch<br />
Membrantransportprozesse (Endocytose, Rezeptor-Recycling, Vesikelbildung<br />
am Golgi-Apparat), Membrantopologie- und Zellmorphologieveränderungen<br />
durch Aktinpolymerisation und Membranveränderungen durch direkte Anlagerungen<br />
von Lipid-bindenden Proteinen, die Membranen krümmen bzw. sogar<br />
tubulieren können. Hierbei untersuchen wir vor allem die Lipid-bindenden<br />
Modulatorproteine der Syndapin-Familie (vergl. Review Qualmann & Kessels<br />
2004 J. Cell Sci.), die Funktionen der für die Vesikelbildung kritischen GTPase<br />
Dynamin und zwei Aktinnukleations maschinerien, den Arp2/3-Komplex und<br />
seine verschiedenen Aktivatoren (siehe z.B. Kessels & Qualmann 2002 EMBO<br />
J.; Pinyol et al. 2007 PLoS ONE); sowie den neu entdeckten Aktinnukleator Cobl<br />
(Ahuja et al. 2007 Cell).<br />
Für ein Verständnis der zellulären und physio logischen Funktionen dieser<br />
Proteine ist es notwendig, die sie in Funktion, Aktivität und/oder Lokalisation<br />
maßgeblich beein flussenden Inter aktions partner zu kennen und das Zusammenspiel<br />
dieser Komponenten zu verstehen.<br />
Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir daher zwei engagierte Doktorand(in)<br />
en mit fundierter naturwissenschaftlicher Aus bildung, die Inter es se an der<br />
Entdeckung neuer Proteininter aktionen und der in vitro- und in vivo-Charakterisierung<br />
von bisher unbekannten Proteinfunktionen haben.<br />
Die Projekte bieten hervorragende Möglichkeiten, sich mit modernen Methoden<br />
der Molekularbiologie, des Hefe-2-Hybrid-Screenings, der Proteinbiochemie<br />
und der Immunfluoreszenz-Mikroskopie vertraut zu machen und Einblicke<br />
in die für eukaryontische Zellen so wesentliche subzelluläre Steuerung der<br />
Aktincytoskelettorganisation im Kontext von Membrantransport prozessen bzw.<br />
Modulationen der Membrantopologie zu erhalten. Entsprechende Vorkenntnisse<br />
sind erwünscht.<br />
Die Projekte können sich hierbei auf bereits etablierte Methoden und eine exzellente<br />
technische Infrastruktur, die direkt im Institut zur Verfügung stehen, stützen.<br />
Mit unser intensiven technischen und wissenschaftlichen Betreuung und der<br />
lebendigen und stimulierenden Forschungsumgebung im Institut und auf dem<br />
Innenstadt-Campus der FSU aber auch in den umliegenden Forschungsinstituten<br />
sind sehr gute Voraussetzungen für erfolgreiches wissenschaftliches Arbeiten<br />
inmitten der lebhaften und liebenswerten Universitätsstadt Jena gegeben.<br />
Interessierte wenden sich bitte mit aussagekräftiger Bewerbung an:<br />
Prof. Dr. Britta Qualmann<br />
Friedrich-Schiller-Universität Jena, Institut für Biochemie I,<br />
Nonnenplan 2, 07743 Jena<br />
bzw. an britta.qualmann@mti.uni-jena.de<br />
Als europaweit führendes Forschungszentrum mit der Ausrichtung „Environmental<br />
Health“, sind wir Mitglied der Helmholtz Gemeinschaft Deutscher<br />
Forschungszentren e. V.<br />
Ziel unserer Forschung ist es, Gesundheitsrisiken für Mensch und Umwelt frühzeitig<br />
zu erkennen, Mechanismen der Krankheitsentstehung zu entschlüsseln<br />
und Konzepte zur Prävention und Therapie von Erkrankungen zu entwickeln.<br />
Das Helmholtz Zentrum München als Träger des Bayerischen Frauenförderpreises<br />
sowie des Total E-Quality-Zertifikates strebt eine Erhöhung des Frauenanteils<br />
an und fordert deshalb qualifizierte Interessentinnen auf, sich zu bewerben.<br />
Schwerbehinderte werden bei gleicher Eignung bevorzugt.<br />
Das Institut für Bioinformatik und Systembiologie sucht zum nächstmöglichen<br />
Zeitpunkt eine/n<br />
Bioinformatiker/in - Tomatengenom (142/2009)<br />
Ihre Aufgaben<br />
– Genom-Analyse der Tomate<br />
– Erstellung eines umfassenden Datenbanksystems zur Darstellung und<br />
Analyse<br />
Ihre Qualifikation<br />
– Hochschulstudium mit Promotion in Biologie/Bioinformatik<br />
– Fundierte Kenntnisse der Sequenz- und Genomanalyse<br />
– Programmier- und Datenbankkenntnisse (Java, Perl, Phyton, UNIX, SQL und<br />
Oracle db Systeme) werden vorausgesetzt<br />
– hohe Teamfähigkeit und Einsatzbereitschaft<br />
Unser Angebot<br />
– Tätigkeit in einem innovativen, zukunftsorientierten Unternehmen<br />
– umfangreiches Fortbildungsangebot<br />
– zunächst für zehn Monate befristetes Arbeitsverhältnis und eine Vergütung<br />
nach TVÖD<br />
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung online. Dr. Klaus Mayer<br />
E-Mail: kmayer@helmholtz-muenchen.de, Telefon: 089 3187-3584<br />
Helmholtz Zentrum München<br />
Deutsches Forschungszentrum für Gesundheit und Umwelt GmbH<br />
Institut für Bioinformatik und Systembiologie Postfach 11 29<br />
85758 Neuherberg<br />
Mitarbeiter gesucht?<br />
Nutzen Sie die Möglichkeit, zielgruppengerecht in unserem<br />
akademischen Stellenmarkt kostenlos zu werben.<br />
Auch online unter www.laborwelt.de<br />
Informationen erhalten Sie unter:<br />
a.macht@biocom.de<br />
oder tel.: 030-264 921-54<br />
46 | 10. Jahrgang | Nr. 5/2009 LABORWElT
Max-Planck-Institut<br />
für Neurobiologie<br />
Martinsried/München<br />
Das Max-Planck-Institut für Neurobiologie in Martinsried bei München<br />
betreibt Grundlagenforschung auf dem Gebiet der Entwicklung,<br />
Funktion und Krankheiten des Nervensystems. Für die Nachwuchsgruppe<br />
Dendritische Differenzierung suchen wir ab sofort einen/eine<br />
Technische/n Assistenten/in<br />
(BTA/MTA) zeitlich befristet<br />
Wir sind ein junges, engagiertes Team und suchen Verstärkung für<br />
Aufgaben im Bereich der Histologie, Molekularbiologie, Zellkultur und<br />
Genetik. Das Aufgabengebiet umfasst die technische Labororganisation,<br />
die Erhaltung unserer Fruchtfliegenlinien und die Planung und<br />
Durchführung von histologischen und molekularbiologischen<br />
Experimenten.<br />
Wir bieten ein hervorragend ausgestattetes Institut und einen abwechslungsreichen<br />
Arbeitsplatz in einer freundlichen und offenen<br />
Arbeitsatmosphäre. Weitere Informationen über das Institut finden Sie<br />
auf unserer Homepage<br />
http://www.neuro.mpg.de/english/junior/dendif/index.html<br />
Wünschenswert wäre ein/eine Mitarbeiter/in der/die sich selbständig<br />
und zuverlässig in unser Team einbringt.<br />
Die Vergütung erfolgt nach TVöD, die Stelle ist bis 28.02.2011 befristet.<br />
Die Max-Planck-Gesellschaft ist bemüht, mehr schwerbehinderte<br />
Menschen zu beschäftigen. Bewerbungen Schwerbehinderter sind ausdrücklich<br />
erwünscht. Die Max-Planck Gesellschaft will den Anteil von<br />
Frauen in den Bereichen erhöhen in denen sie unterrepräsentiert sind.<br />
Frauen werden deshalb ausdrücklich aufgefordert sich zu bewerben.<br />
Schriftliche Bewerbung In Deutsch oder Englisch mit den üblichen<br />
Unterlagen werden erbeten an:<br />
Max-Planck-Institut für Neurobiologie<br />
Verwaltung<br />
Am Klopferspitz 18,82152 Martinsried<br />
90x130mm<br />
At the University of Bern (Switzerland),<br />
Institute of Plant Sciences, a<br />
PhD position<br />
in Molecular Plant Physiology (www.ips.unibe.ch/plantphys)<br />
is available to work on the characterization of plant peptide<br />
transporters. Molecular, biochemical and physiological<br />
methods will be used to investigate the physiological role<br />
of peptide transporters in planta.<br />
We are looking for a motivated student interested in joining<br />
our research team. The position requires a diploma or<br />
M.Sc. degree in biology, biochemistry or equivalent and<br />
qualifications in plant molecular biology, plant physiology,<br />
cell biology or biochemistry.<br />
Salary will be according to the Swiss National Science Foundation and is limited<br />
to 36 months. Starting 1 th December 2009 or at earliest convenience. Applications<br />
should include a curriculum vitae, description of research interests and<br />
experience and name and address of two references.<br />
Please send your application to<br />
Prof. Dr. Doris Rentsch, plantphys@ips.unibe.ch<br />
Service Stellenmarkt<br />
The University Hospital of Cologne ranks among the leading<br />
university hospitals in Germany. Our 6,800 employees,<br />
working in more than 59 highly efficient clinics, polyclinics<br />
and institutes offer optimum inpatient and outpatient care<br />
as well as professional vocational training and continuing<br />
education programmes. With some 1,300 beds, we are one<br />
of the largest hospitals in the state of North Rhine-Westphalia. Our international<br />
reputation is based on our outstanding record as a provider of top-flight medical<br />
care and as a leading academic institution in the fields of medical research<br />
and teaching.<br />
The Institute of Neurophysiology at the Uniklinik Köln is seeking applications for a<br />
PhD student (TV-L E13, 50%)<br />
to be employed under a limited-time contract for 2 years with the possibility<br />
of extension.<br />
Our group is a part of the Institute of Neurophysiology (Director: Prof. Dr. Jürgen<br />
Hescheler) located at the University of Cologne (Germany). The Institute is part of<br />
the Medical Faculty and is traditionally involved in stem cell research. The major<br />
focus of the research at the Institute is on differentiation of embryonic stem<br />
(ES) and induced pluripotent stem (iPS) cells into cardiac, neuronal, haemangioblastic<br />
and others organotypic cells and on their functional characterization.<br />
Our group is engaged in the exploration of mechanisms involve in mouse<br />
and human ES and iPS cell-derived cardiomyocytes differentiation process<br />
and to characterize (structure and function) the resulting cardiomyocytes<br />
by using several techniques. Several well established ES and iPS cell lines<br />
and differentiation protocols are available. Recently, it has been shown that<br />
mechano- and electro-stimulation of stem cell in culture has strong effect on<br />
cardiac precommitment.<br />
Your responsibilities will include:<br />
The successful candidate will be responsible for establishing a chronic stimulation<br />
of different cell types in culture and to study the stimulation effect of ES<br />
and iPS cell during the differentiation process.<br />
The candidate will join a multidisciplinary team of scientists and will gain experience<br />
in a broad range of techniques including electrophysiology, calcium<br />
imaging, immunohistochemistry, PCR and microarray.<br />
Minimum qualifications:<br />
We are seeking a highly motivated, independent thinking, team- and hardworking<br />
candidate with a solid understanding and practical experience in<br />
cellular biology and physiology.<br />
The candidate must hold a MSc degree or equivalent and must be fluent in English.<br />
The knowledge in the field of stem cells, electrophysiology is desirable.<br />
Your salary will be based on (TV-L E13 , 50%).<br />
The Board of Directors of the University Hospital of Cologne places strong emphasis<br />
on gender equality and seeks to increase the proportional representation<br />
of women in this field. Thus applications from female scientists will be welcomed;<br />
suitably qualified women will be given preferential consideration unless other<br />
candidates clearly demonstrate superior qualifications.<br />
We also welcome applications from disabled candidates, who will also be<br />
given preferential consideration over other applicants with comparable qualifications.<br />
The position is suitable for staffing with part-time employees.<br />
Applications with Curriculum vitae including contact detail of references<br />
and a motivation letter should be sent until 25.09.2009 to:<br />
Filomain Nguemo, Ph.D., Institute of Neurophysiology<br />
Robert Koch Str. 39, 50931 Cologne, Germany<br />
Tel. 0221-478-6940, Fax 0221-478-3834<br />
or per e-mail to: filo.nguemo@uni-koeln.de<br />
LABORWElT 10. Jahrgang | Nr. 5/2009 | 47
Service Stellenmarkt<br />
FB 05_Prof. org. Chemie_2c:Layout 1 11.09.2009 11:29 Uhr Seite 1<br />
Die Hochschule Bonn-Rhein-Sieg ist eine erfolgreiche Hochschule<br />
mit rund 5000 Studierenden, 120 Professorinnen und<br />
Professoren, 6 Fachbereichen und 18 Studiengängen.<br />
Der Fachbereich Angewandte Naturwissenschaften, Campus<br />
Rheinbach, ist bestrebt, die Qualität seines Lehrangebotes zu<br />
sichern und weiter zu entwickeln. Daher ist im Rahmen der<br />
Einführung des Studiengangs Naturwissenschaftliche Forensik<br />
zum nächstmöglichen Zeitpunkt folgende Stelle zu besetzen:<br />
eine wissenschaftliche Mitarbeiterin/<br />
ein wissenschaftlicher Mitarbeiter<br />
Das Aufgabengebiet umfasst:<br />
• Unterstützung der Hochschullehrerinnen und<br />
Hochschullehrer bei der Durchführung von Praktika<br />
• Mitwirkung bei Forschungs- und Entwicklungsvorhaben<br />
• Aufbau und die Betreuung des Labors für chemischforensische<br />
Analytik<br />
• Betreuung der Studierenden in den Praktika zur<br />
chemisch-forensischen Analytik und in weiteren naturwissenschaftlichen<br />
Grundlagenpraktika. Die Praktika<br />
finden teilweise in englischer Sprache statt.<br />
Die Aufgabenstellung erfordert:<br />
• ein stellenrelevantes (Fach-)Hochschulstudium<br />
• sehr gute Kenntnisse und praktische Erfahrungen<br />
in der instrumentellen chemischen Analytik<br />
• breite naturwissenschaftlich-technische Kenntnisse<br />
• gute Kenntnisse der englischen Sprache<br />
• sicheren Umgang mit Microsoft Office Anwendungen<br />
• Einsatzbereitschaft, Eigeninitiative und Teamfähigkeit<br />
Wir bieten Ihnen:<br />
• eine anspruchsvolle, vielseitige und selbständige Tätigkeit<br />
• flexible Arbeitszeiten<br />
• gute Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten<br />
Die Stelle ist zunächst auf 3 Jahre befristet und kann auch<br />
mit zwei Teilzeitkräften besetzt werden. Die Vergütung<br />
erfolgt je nach Qualifikation bis E12 TV-L.<br />
Auskünfte über die Stelle erteilt Ihnen gerne der Dekan des<br />
Fachbereichs Angewandte Naturwissenschaften, Herr Prof.<br />
Dr. Eßmann, unter der Telefonnummer 02241/865-500.<br />
Bewerbungen von Schwerbehinderten werden bei gleicher<br />
Qualifikation bevorzugt berücksichtigt.<br />
Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen richten Sie bitte<br />
bis zum 5.10.2009 an die Hochschule Bonn-Rhein-Sieg,<br />
Personaldezernat, 53754 Sankt Augustin.<br />
www.hochschule-bonn-rhein-sieg.de<br />
Das Comprehensive Pneumologie Center (CPC) ist<br />
eine Kooperation zwischen dem Helmholtz Zentrum<br />
München, der Ludwig-Maximilians-Universität<br />
München, dem Klinikum der Ludwig-Maximilians-<br />
Universität München und den Asklepios Fachkliniken München-Gauting.<br />
Mit 1400 Studierenden ist die Hochschule Biberach eine<br />
kleine, aber renommierte und auch überregional ausgezeichnet<br />
aufgestellte Hochschule im Südosten Baden-Württembergs,<br />
Ranking-Ergebnisse sowie Evaluations- und<br />
Akkreditierungsagenturen bestätigen dies. Ihr bundesweit<br />
einmaliger Studiengang Pharmazeutische Biotechnologie<br />
wurde 2006 als Public-Private-Partnership verwirklicht,<br />
u. a. mit den Pharma-Unternehmen Boehringer-Ingelheim<br />
Deutschland und Rentschler Biotechnologie. Der Studiengang<br />
realisiert erfolgreich eine praxisnahe Lehre im<br />
Bereich der biopharmazeutischen Herstellung, Qualitätssicherung<br />
und Entwicklung.<br />
In diesem Studienfeld ist an der Hochschule Biberach zum<br />
01.03.2010 oder später eine<br />
W 2 - Professur<br />
(Kennziffer PBT 08)<br />
für das Lehrgebiet Zellkulturtechnik zu besetzen.<br />
Bewerber/innen sollten über einen überdurchschnittlichen<br />
Hochschulabschluss und eine Promotion sowie über mehrjährige<br />
einschlägige Erfahrungen in der Zellkulturtechnik<br />
eukaryontischer Zellen verfügen.<br />
Die/der zukünftige Stelleninhaber/in soll Vorlesungen und<br />
praktische Übungen in den Lehrgebieten der Zellkulturtechnik,<br />
Verfahrenstechnik, Bioprozesstechnik, -entwicklung<br />
und in verwandten Disziplinen übernehmen. Darüber<br />
hinaus wird die aktive Mitarbeit in der Selbstverwaltung<br />
und in Gremien erwartet.<br />
Eine detaillierte Beschreibung des Lehrgebiets erhalten Sie<br />
vom Dekan, Herrn Prof. Dr. Hannemann unter Tel. 07351/<br />
5 82-450.<br />
Es wird vorausgesetzt, dass die/der zukünftige Stelleninhaber/in<br />
beim Auf- und Ausbau sowie bei der Fortentwicklung<br />
des Studiengangs Pharmazeutische Biotechnologie<br />
tatkräftig mitarbeitet.<br />
Nähere Informationen zur Dienstaufgabe, zu den Bewerbungs-<br />
und Einstellungsvoraussetzungen und die ausführliche<br />
Stellenausschreibung finden Sie unter<br />
www.hochschule-biberach.de/sections/service/stellenanzeigen<br />
Bitte senden Sie Ihre Bewerbung unter Angabe der Kennziffer<br />
mit den üblichen Unterlagen bis 16.10.2009 an die<br />
Hochschule Biberach.<br />
HBC Hochschule Biberach I Personalabteilung<br />
Karlstr. 11, 88400 Biberach, Tel. Nr. 0 73 51/5 82-1 20<br />
www.hochschule-biberach.de<br />
Zielsetzung des CPC ist die Erforschung grundlegender Mechanismen von chronischen Lungenerkrankungen, sowie die Entwicklung neuer Ansätze für die Diagnostik und<br />
Therapie dieser Erkrankungen.<br />
Für das Comprehensive Pneumologie Center suchen wir für die Forschungsbereiche Chronisch obstruktive Lungenerkrankungen, Medical Biobanking und Primärzellkulturen<br />
am Standort Großhadern in München zum nächstmöglichen Zeitpunkt<br />
4 Technische Assistenten/innen - Lungenforschung (173/2009)<br />
Ihre Aufgaben: Generierung und Kultivierung primärer Zellkulturen aus Gewebeproben / Systematische Erfassung und Archivierung biologischer Proben / Charakterisierung<br />
biologischer Proben mittels molekular- und zellbiologischer Methoden<br />
Ihre Qualifikation: Ausbildung als MTA / BTA / CTA oder vergleichbare Ausbildung / Flexibilität und Zuverlässigkeit / hohe Motivation und Teamfähigkeit<br />
Unser Angebot: Tätigkeit in einem innovativen, zukunftsorientierten Unternehmen / umfangreiches Fortbildungsangebot / zunächst für zwei Jahre befristetes Arbeitsverhältnis<br />
und eine Vergütung nach TVÖD, Arbeitsplatz ab November 2009 / Am Max-Lebsche-Platz 30-32 • 81377 München/Großhadern<br />
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung. Prof. Dr. Oliver Eickelberg • E-Mail: lauer@helmholtz-muenchen.de • Telefon: 089 3187-3071<br />
48 | 10. Jahrgang | Nr. 5/2009 LABORWElT
Paul-Ehrlich-Institut Paul-Ehrlich-Straße 51 - 59,<br />
63225 Langen, Telefon (06103) 77-11 00<br />
Das Paul-Ehrlich-Institut ist eine wissenschaftliche Einrichtung des Bundes, die<br />
als Bundesoberbehörde für die Zulassung und Chargenprüfung immunbiologischer<br />
Arzneimittel zuständig ist und auf den damit verbundenen Gebieten der<br />
Lebenswissenschaften (z.B. Virologie, Bakteriologie, Allergologie, Immunologie,<br />
Hämatologie, Medizinische Biotechnologie) Forschung betreibt.<br />
Im Fachgebiet „Virussicherheit“ der Abteilung - Virologie ist zum nächstmöglichen<br />
Zeitpunkt die Position einer / eines<br />
FÜR: MDC AG MEIER „RNA EDITING AND HYPEREXCITABILITY DISORDERS“ wird<br />
1 Doktorand/-in<br />
gesucht.<br />
Wissenschaftlerin / Wissenschaftlers<br />
Stellenbewertung: E 13 / 14 TVöD<br />
Bewerbungskennziffer: 44 / 2009 zu besetzen.<br />
Aufgabenprofil:<br />
– Bewertung der Virussicherheit von biologischen Produkten<br />
(Plasmaprodukte, monoklonale Antikörper, Zellkulturprodukte, Gentransferarzneimittel<br />
und Gewebezubereitungen) bei europäischen und nationalen<br />
Zulassungen von Arzneimitteln und von Präparaten zur klinischen Prüfung<br />
– Bewertung der Sicherheit dieser Produkte im Hinblick auf TSE (Prionen)<br />
– Beratung von pharmazeutischen Unternehmern im Rahmen von Arzneimittelzulassungen<br />
und klinischen Studien<br />
– Forschungsarbeiten zu Themen der Virussicherheit<br />
Anforderungsprofil:<br />
– Abgeschlossenes naturwissenschaftliches oder medizinisches/veterinärmedizinisches<br />
Hochschulstudium<br />
– Promotion<br />
– Fundiertes Wissen in allgemeiner Virologie, Kenntnisse in medizinischer<br />
Virologie und Virusdiagnostik<br />
– Praktische Erfahrung in klassischen Methoden der Virologie sowie in molekularbiologischen<br />
Techniken<br />
– Kenntnisse auf den Gebiet der Herstellung von biologischen Arzneimitteln<br />
bzw. Proteinreinigung<br />
Service Stellenmarkt<br />
Tätigkeitsbeschreibung: Die ausgeschriebene Stelle ist im Rahmen einer Helmholtz-Hochschul-Nachwuchsgruppe am Max-Delbrück-Centrum für molekulare Medizin<br />
(MDC), die sich mit der Entwicklung alternativer Epilepsietherapien befasst, zu besetzen.<br />
Project description:<br />
In a healthy organism, a balance is maintained between the excitation and inhibition of electrical impulses generated by neurons in the brain. Deregulation of this<br />
balance results in nervous system disorders. A core aspect of our work concerns the study of the brain at the molecular level, by investigating a post-transcriptional<br />
enzymatic process known in research as “RNA editing” or “splicing”. We search for disease-associated alterations in post-transcriptional processes in the nervous<br />
system. Within this context, we are more closely scrutinizing glycine and GABA(A) receptors and gephyrin – key components of the molecular machine responsible<br />
for inhibition of electrical impulses in the brain.<br />
The open position focuses on identification of ligands specific to RNA-edited brain GlyR.<br />
Voraussetzungen:<br />
Abgeschlossenes Studium, Erfahrung im Umgang mit DNA/RNA, mit molekularbiologischen Techniken, primären Zellkulturen, Zellinien, Transfektion und Genexpression,<br />
Immunzyto-/histochemie; Darüberhinaus sind EDV-Kenntnisse (MS-Office, Photoshop, Statistik) sowie gute Englischkenntnisse vorteilhaft.<br />
Vergütungsgruppe Promotions-übliche Vergütung<br />
Eintrittstermin: Sofort<br />
COLOGNE INTERNATIONAL GRADUATE SCHOOL<br />
From Embryo to old Age, Development, Health<br />
and Disease<br />
6 Fellowships<br />
3-year Ph.D. programme starting spring 2010<br />
The University of Cologne has a long-standing tradition and world-wide reputation<br />
of top-level molecular biological research. Beginning in spring 2010<br />
the Research School in Biology „From embryo to old age: the cell biology and<br />
genetics of health and disease“ will be offering a high-level Ph.D. programme<br />
for students with excellent qualifications. The participating research groups<br />
use today‘s microbial, plant and animal model systems to investigate cell<br />
biological and genetic mechanisms whose perturbation during the life cycle of<br />
an organism results in disease.<br />
The three-year programme starts with a six-month rotation and course period,<br />
followed by a PhD project in one of the participating groups. Seminars and<br />
training courses complement the research work. Comprehensive support is<br />
provided throughout the programme. The programme language is English. Accepted<br />
students get a laptop computer and 500 EUR to get started in Cologne.<br />
No tuition fees apply.<br />
Six competitive three-year fellowships (initially 1000 EUR, then 1300 EUR per<br />
month) are available.<br />
We invite you to apply to the IGSDHD in Cologne, the exciting city in the heart<br />
of Europe.<br />
To obtain further information please visit our website at:<br />
http://www.uni-koeln.de/bio-graduateschool/<br />
Submission deadline of complete applications is October 31, 2009<br />
Contact: Dr. Isabell Witt, IGSDHD, Zülpicher Strasse 47, D-50674 Cologne,<br />
Phone: +49(0)221 4701683, Fax: +49(0) 470 1632,<br />
isabell.witt@uni-koeln.de<br />
Nähere Auskünfte über die Aufgaben erteilt: Prof. Dr. Jochen Meier<br />
Tel: (030) 94063062, http://www.mdc-berlin.de/en/research/research_teams/rna_editing_and_hyperexcitability_disorders/index.html<br />
Bitte richten Sie Ihre Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen (CV mit Bild, Zeugniskopien) an: jochen.meier@mdc-berlin.de<br />
LABORWElT 10. Jahrgang | Nr. 5/2009 | 49
Service Verbände<br />
Kontakt zu Verbänden<br />
Die Mitglieder der nachfolgenden Fachgesellschaften erhalten LABORWELT regelmäßig mit<br />
freundlicher Empfehlung ihrer Organisationen. Wer sich darüber hinaus für eine Mitarbeit oder<br />
einen Beitritt interessiert, erreicht die Fachgesellschaften unter den folgenden Kontaktdaten:<br />
Ich interessiere mich für<br />
den Beitritt<br />
Unterstützung für Jungwissenschaftler<br />
Interessenvertretung<br />
eine Spende<br />
Fachgruppen im Bereich<br />
Verband (siehe unten, bitte ankreuzen)<br />
Dt. Ver. Gesell. f. Klinische Chemie<br />
und Laboratoriumsmedizin e.V. (DGKL)<br />
Geschäftsstelle der DGKL<br />
Im Mühlenbach 52 b<br />
53127 Bonn<br />
Tel.: +49-(0)-228-92-68-9522<br />
Fax: +49-(0)-228-92-68-9527<br />
geschaeftsstelle@dgkl.de<br />
www.dgkl.de<br />
Deutsche Gesellschaft für<br />
Proteomforschung<br />
BIO Deutschland<br />
c/o MPI für Biochemie<br />
Am Klopferspitz 18a<br />
82152 Martinsried<br />
Tel.: +49-(0)-89-1897-9007<br />
Fax: +49-(0)-89-1897-9009<br />
c.kleinhammer@dgpf.org<br />
www.dgpf.org<br />
Tegeler Weg 33/<br />
berlinbiotechpark<br />
10589 Berlin<br />
Tel.: +49-(0)-30-3450593-30<br />
Fax: +49-(0)-30-3450593-59<br />
info@biodeutschland.org<br />
www.biodeutschland.org<br />
Deutsche Gesellschaft für Hygiene<br />
und Mikrobiologie (DGHM)<br />
c/o Institut für Hygiene und<br />
Med. Mikrobiologie<br />
Carl-Neuberg-Straße 1<br />
30625 Hannover<br />
Tel.: +49-(0)-511-532-4655<br />
Fax: +49-(0)-511-532-4355<br />
www.dghm.org<br />
bts (Biotechnologische Studenteninitiative<br />
e.V.)<br />
c/o BIOCOM<br />
Stralsunder Straße 58–59<br />
13355 Berlin<br />
Tel.: +49-(0)-2649-21-21<br />
Fax: +49-(0)-2649-21-11<br />
www.bts-ev.de<br />
Bitte kontaktieren Sie mich<br />
Name Firma<br />
Tel. Fax<br />
E-Mail<br />
Gesellschaft für Genetik<br />
GESELLSCHAFT FÜR GENETIK<br />
c/o HZM – Deutsches<br />
Forschungszentrum für<br />
Gesundheit/Inst. of Developmental<br />
Genetics<br />
Tel.: +49-(0)-89-3187-2610<br />
Fax: +49-(0)-89-4620<br />
www.gfgenetik.de<br />
Gesellschaft für Signaltransduktion<br />
c/o Prof. Dr. Ralf Hass<br />
Med. Hochschule Hannover<br />
AG Biochemie u. Tumorbiol.<br />
30625 Hannover<br />
Tel.: +49-(0)-511-532-6070<br />
Fax: +49-(0)-511-532-6071<br />
www.sigtrans.de<br />
Gesellschaft für Pharmakologie und<br />
Toxikologie<br />
Geschäftsstelle der DGPT<br />
Achenbachstraße 43<br />
40237 Düsseldorf<br />
Tel.: +49-(0)-211-600-692-77<br />
Fax: +49-(0)-211-600-692-78<br />
mitglieder@dgpt-online.de<br />
www.dgpt-online.de<br />
Nationales Genomforschungsnetz<br />
c/o DKFZ<br />
Im Neuenheimer Feld 580<br />
69120 Heidelberg<br />
Tel.: +49-(0)-6221-424-743<br />
Fax: +49-(0)-6221-423-454<br />
S.Argo@dkfz-heidelberg.de<br />
www.ngfn.de<br />
Deutsche Gesellschaft für<br />
Neurogenetik<br />
Institut für Humangenetik<br />
Calwer Straße 7<br />
72076 Tübingen<br />
Tel.: +49-(0)-7071-2977692<br />
Fax: +49-(0)-7071-295171<br />
peter.bauer@<br />
med.uni-tuebingen.de<br />
www.hih-tuebingen.de/dgng/<br />
Seite bitte abtrennen – per Fax an 030-264921-11<br />
Netzwerk Nutrigenomik<br />
RNA-Netzwerk<br />
Netzwerk Nutrigenomik<br />
Arthur-Scheunert-Allee 114<br />
14558 Nuthetal<br />
Tel.: +49-(0)-33200-88-301<br />
Fax: +49-(0)-33200-88-541<br />
mail@nutrigenomik.de<br />
www.nutrigenomik.de<br />
c/o Prof. Dr. Volker A. Erdmann<br />
Freie Universität Berlin<br />
Thielallee 63, 14195 Berlin<br />
Tel.: +49-(0)-30-8385 6002<br />
Fax: +49-(0)-30-8385 6413<br />
erdmann@chemie.fu-berlin.de<br />
www.rna-network.com<br />
FA Life Science Research im VDGH<br />
c/o VDGH im VCI<br />
Mainzer Landstraße 55<br />
60329 Frankfurt am Main<br />
Tel.: +49-(0)-69-2556-1730<br />
Fax: +49-(0)-69-236650<br />
vdgh@vdgh.de<br />
www.vdgh.de<br />
Österreichische<br />
Reinraumgesellschaft (ÖRRG)<br />
ÖRRG<br />
Neudorf 41<br />
A-8262 Ilz<br />
Tel.: +43-(0)-3385-8117<br />
Fax: +43-(0)-3385-8117<br />
office@oerrg.at<br />
www.oerrg.at<br />
Österreichische Ges. f. Laboratoriums-<br />
medizin & Klinische Chemie<br />
ÖGLMKC Geschäftsstelle<br />
Infomedica-KEG, Xenius Behal<br />
Tullnertalgasse 72<br />
A-1230 Wien<br />
Tel./Fax: +43-(0)-1889-6238<br />
office@oeglmkc.at<br />
www.oeglmkc.at<br />
50 | 10. Jahrgang | Nr. 5/2009 LABORWElT
Fujifilm<br />
DNA-Extraktion für<br />
die IVD zugelassen<br />
Die Fujifilm-Produkte QuickGene-Mini80,<br />
QuickGene-810, sowie das DNA Whole Blood<br />
Kit sind nun CE IVD gekennzeichnet. Die seit<br />
Jahren erfolgreich eingesetzten QuickGene-<br />
Systeme können ab sofort als prä-analytische<br />
Methode für die medizinische molekulare<br />
Diagnostik verwendet werden.<br />
Die QuickGene-Systeme nutzen eine von Fujifilm<br />
patentierte, 80 µm poröse Membran, die<br />
Nukleinsäuren selektiv bindet. Diese Membran<br />
mit gleichmäßig feinen Poren und einer großen,<br />
spezifisch bindenden Oberfläche sorgt für hohe<br />
Ausbeuten und Reinheit. Ihre besonderen Eigenschaften<br />
ermöglichen eine DNA-Extraktion<br />
durch Luftdruck ohne Zentrifugationsschritte.<br />
QuickGene-Mini80 CE IVD ist ein besonders<br />
kleines Tischgerät. Es gestattet, gleichzeitig<br />
genomische DNA aus acht Proben innerhalb<br />
von 12 Minuten manuell zu extrahieren. Das<br />
benutzerfreundliche und günstige System<br />
ist besonders für kleine diagnostische Labore<br />
attraktiv. Für Hochdurchsatzlabore ist das<br />
QuickGene-Mini80 CE IVD eine sinnvolle<br />
Back-up-Methode für kurzfristige und dringende<br />
Tests. QuickGene-810 CE IVD ist ein<br />
semi-automatisches Gerät, das für mittelgroße<br />
Labore geeignet ist. Auch dieses Gerät ist ein<br />
kompaktes, platzsparendes Tischgerät, und<br />
genomische DNA aus acht Vollblutproben kann<br />
in sechs Minuten extrahiert werden.<br />
Die mit dem DNA Whole Blood Kit CE IVD<br />
und einem der QuickGene-Geräte gereinigte<br />
genomische DNA ist für In-Vitro-Diagnostik-<br />
Untersuchungen vorgesehen. Sie ist für humangenetische<br />
Arbeitsmethoden wie PCR, DNA<br />
Microarrays, Sequenzierung, Restriktionsverdau<br />
und andere molekularbiologische Anwendungen<br />
optimal geeignet.<br />
FUJIFILM Europe GmbH<br />
40549 Düsseldorf<br />
Heesenstr. 31<br />
Tel.: + 49-(0)211-5089-214<br />
presse@fujifilm.de<br />
www.fujifilm.de/lifescience<br />
Fluidigm<br />
Service Produktwelt<br />
Fluidigm: Neuer IFC ermöglicht 9.216 simultane<br />
Real-Time PCR-Experimente in drei Stunden<br />
Fluidigms BioMark 96.96 Dynamic Array – ein<br />
neuer “Integrated Fluidic Circuit” (IFC) – erlaubt<br />
9.216 simultane PCR-Experimente im Nanoliter-<br />
Maßstab und setzt so neue Maßstäbe in Sachen<br />
Kosteneffizienz und Logistik. Die IFC vereinen die<br />
Vorzüge von Mikrotiterplatten (Flexibilität) und<br />
Microarrays (Durchsatz). Sie sind nicht vorkonfiguriert,<br />
vorhandene Assays können einfach<br />
übertragen werden.<br />
Der 96.96 Dynamic Array ist für SNP- und<br />
Genexpressionsstudien sowie andere Applikationen,<br />
wie CNV oder Single Cell-Studien, optimiert,<br />
ohne Kompromisse in der Datenqualität<br />
einzugehen.<br />
Ein Vergleich von Fluidigms 96.96 Dynamic<br />
Arrays mit 384 Well-Systemen in 10µL Reaktionsvolumen<br />
zeigt die signifikant bessere Produktivität<br />
und Effizienz am Beispiel von 96 Proben,<br />
die gegen 96 Assays getestet werden:<br />
I 24-fach höherer Durchsatz: Ein 96.96 Array<br />
entspricht 24.384-MT Platten<br />
I 192-fach weniger Master Mix: 240 µl anstelle<br />
von 46.080 µl<br />
I 96-fach reduzierte Komplexität: 192 statt<br />
18.432 Pipettierschritte im MT-Format<br />
I vier Stunden bis zum Ergebnis für 9.216 Reaktionen.<br />
PromoCell<br />
Schnelle Detektion apoptotischer,<br />
nekrotischer und intakter Zellen<br />
PromoKines Kits zur simultanen Differenzierung<br />
apoptotischer, nekrotischer und intakter Zellen<br />
basieren auf dem Einsatz dreier Fluoreszenzfarbstoffe,<br />
die diese Zellen jeweils spezifisch<br />
anfärben: Annexin V-FITC bindet spezifisch mit<br />
hoher Affinität an die Zelloberfläche von Zellen<br />
in der frühen apoptotischen Phase und färbt diese<br />
grün. Das rot-fluoreszierende EtD-III kann nur<br />
die zerstörten Membranbereiche nekrotischer<br />
Zellen passieren und bindet dort an die DNA<br />
des Zellkerns, während es nicht in intakte Zellen<br />
eindringt. Der DNA-Farbstoff Hoechst 33342<br />
passiert auch die Membran lebender Zellen<br />
und färbt deren Kern blau an. Die Zellen können<br />
unter dem Fluoreszenzmikroskop detektiert<br />
und ausgezählt oder durchflusszytometrisch<br />
analysiert werden. Des Weiteren bietet Promo-<br />
Kine eine Vielzahl an Kits und Reagenzien zum<br />
sensitiven Nachweis und zur Quantifizierung<br />
von Apoptose (z.B. Caspase-, Kinase-,Annexin<br />
V- und TUNEL-Assays), Signaltransduktion,<br />
Zellviabilität, Zytotoxizität, Seneszenz, Zellstress,<br />
Zellmetabolismus und Reportergenen an. Neben<br />
Antikörpern, rekombinanten Proteinen (z.B.<br />
Zytokine) und ELISA-Kits ergänzen zahlreiche<br />
Für den mittleren Durchsatz bietet Fluidigm den<br />
48.48 Dynamic Array an und der Digital Array<br />
erlaubt eine exquisite absolute Quantifizierung<br />
für die Detektion seltener Targets oder hochauflösender<br />
Copy Number Variation (CNV).<br />
Fluidigm Europe B.V.<br />
Locatellikade 1, 1076 AZ Amsterdam<br />
Tel.: +31-(0)20-578-88-53<br />
harry.boeltz@fluidigm.com<br />
www.fluidigm.com<br />
Fluoreszenzfarbstoffe und Kits zum Anfärben<br />
von Zellstrukturen, zum Nachweis zellulärer<br />
Prozesse und zum Markieren von Biomolekülen<br />
(Proteine, Antikörper und Nukleinsäuren) das<br />
zellbiologische Produktangebot. Außerdem<br />
findet sich ein breites Sortiment an Kits und<br />
Reagenzien für die Zelltransfektion sowie zur<br />
Klonierung, Expression und Repression (silencing,<br />
knockout) von Genen.<br />
PromoCell GmbH<br />
Tel.: +49-(0)6221-649-340<br />
info@promokine.info<br />
www.promokine.info<br />
LABORWElT 10. Jahrgang | Nr. 5/2009 | 51
Service Produktwelt<br />
Roche<br />
Echtzeit-Monitoring von<br />
Migration und Invasion<br />
Das xCELLigence System von Roche Applied<br />
Science ist ein Cell Analyzer, der ein markierungsfreies<br />
und dynamisches Monitoring<br />
zellbasierter Assays über die gesamte Dauer<br />
eines Experimentes ermöglicht.<br />
Das neue xCELLigence RTCA DP System<br />
quantifiziert zelluläre Reaktionen nichtinvasiv<br />
und in Echtzeit über die Messung<br />
der elektrischen Impedanz. Zellen werden in<br />
sogenannten E-Plates® im 3x16 Well-Format<br />
kultiviert. In die Wells ist ein mikroelektronischer<br />
Gold-Sensorarray integriert.<br />
Eine Zelle, die mit den Mikroelektroden<br />
in Berührung kommt, verändert den elektrischen<br />
Widerstand zwischen Elektroden<br />
und Medium. Jede Veränderung in der Zelle<br />
– sei es durch Zelladhäsion, Zellinteraktion,<br />
Zelltod, Zellproliferation oder aber morphologische<br />
Veränderungen – führt wiederum<br />
zu Änderungen in der Widerstandsmessung<br />
und kann somit einfach und schnell detektiert<br />
werden.<br />
Eine Markierung der Zellen ist nicht erforderlich.<br />
Eine ganze Reihe von zellbasierten Assays<br />
lässt sich so schnell und bequem durchführen,<br />
zum Beispiel zur Qualitätskontrolle<br />
von Zellen, zur Zellproliferation, Substanz-,<br />
Zell- und virusvermittelten Zytotoxizität, zur<br />
Barrierefunktion, Messungen zur Zelladhäsion<br />
und -ausbreitung sowie zur Rezeptorvermittelten<br />
Signalübertragung.<br />
Zusätzlich ist es mit dem RTCA DP System<br />
möglich, mit einer speziell modifizierten<br />
Boyden-Kammer (CIM- Plate) die Migration<br />
beziehungsweise Invasion von Zellen in Echtzeit<br />
(Real Time) kontinuierlich zu beobachten.<br />
So lässt sich zum Beispiel die Migration von<br />
Krebszellen in Richtung eines Chemoattraktans<br />
verfolgen, wobei aufwendige Färbungen,<br />
das Abschaben von Zellen sowie Zellzählungen<br />
entfallen.<br />
Roche Diagnostics GmbH<br />
Roche Applied Science<br />
Sandhofer Str. 116<br />
68305 Mannheim<br />
Tel.: +49-(0)621-759-8568<br />
mannheim.biocheminfo@roche.com<br />
www.xcelligence.roche.com<br />
Porvair<br />
Spezielle Mikrotestplatte zur Aufbewahrung<br />
lichtempfindlicher Analysen und Proben<br />
Der Mikrotestplattenspezialist Porvair Sciences<br />
Ltd. hat eine neue extratiefe Platte mit 96<br />
schwarzen Vertiefungen zur Aufbewahrung<br />
von Analysen und Proben, die potentiell lichtempfindlich<br />
sind, entwickelt. Das Arbeitsvolumen<br />
beträgt 1 ml pro Vertiefung. Die neuen<br />
extratiefen Porvair-Platten sorgen dafür, dass<br />
Analysen und Proben selbst bei langfristiger<br />
Aufbewahrung nicht durch Lichteinfluss<br />
beschädigt werden. Die schwarzen Vertiefungen<br />
zeichnen sich durch eine zylindrische<br />
Form mit runden Böden aus und bieten somit<br />
optimale Bedingungen zum Mischen und<br />
zur Entnahme der Proben. Die Abmessungen<br />
entsprechen genau den Anforderungen der<br />
entsprechenden ANSI/SBS-Regelungen. Dadurch<br />
wird die Kompatibilität mit fast allen<br />
Lesegeräten und Automaten sichergestellt.<br />
Die neuen schwarzen Vertiefungen sind frei<br />
von Ribonuklease und Desoxyribonuklease,<br />
so dass sie selbst bei empfindlichsten biologischen<br />
Proben zum Einsatz kommen können.<br />
Zum zusätzlichen Schutz lichtempfindlicher<br />
Proben bietet Porvair Sciences auch schwarze,<br />
lichtabsorbierende Versiegelungsfolien an,<br />
die oben auf den schwarzen Platten angebracht<br />
werden können. Die neuen schwarzen<br />
Mikrotestplatten von Porvair sind aus Poly-<br />
Millipore<br />
Proteinkonzentrierung aus einem einzigen Tropfen<br />
Die Amicon® Ultra-0,5 Zentrifugen-Filtereinheit<br />
verbindet höchste Rückgewinnungsraten<br />
mit kürzesten Zentrifugationszeiten. Mit 25-<br />
bis 30-facher Konzentrierung und Rückgewinnungsraten<br />
von 90% bei nur zehnminütiger<br />
Zentrifugation bietet die Amicon Ultra-0,5<br />
Filtereinheit die höchsten Rückgewinnungsraten<br />
und die kürzesten Zentrifugationszeiten<br />
in ihrer Produktklasse. Die Einheit ist aktuell<br />
mit Ultrafiltrationsmembranen mit einer<br />
molekularen Trenngrenze (MWCO) von 3.000<br />
oder 10.000 erhältlich. Zusätzliche Trenngrenzen<br />
werden in den kommenden Monaten<br />
angeboten.<br />
Die effektive Probenkonzentrierung ist<br />
ein äußerst wichtiger Schritt in der Protein-<br />
Biochemie. Oftmals ist die Probenkonzentrierung<br />
nicht nur der abschließende Schritt<br />
eines langwierigen Aufreinigungsverfahrens,<br />
sondern auch der Schritt, von dem der Erfolg<br />
und die Reproduzierbarkeit von Downstream-<br />
Analysen abhängen.<br />
Die Amicon Ultra-0,5 Zentrifugen-Filtereinheiten<br />
besitzen eine vertikal ausgerichtete<br />
Membran und können umgekehrt zentrifugiert<br />
werden. Dadurch wird sowohl eine<br />
propylen hergestellt und verfügen über eine<br />
herausragende Lösemittelbeständigkeit. Da<br />
ausschließlich ultrahochreine Polymere zum<br />
Einsatz kommen, lassen die extratiefen Platten<br />
mit schwarzen Vertiefungen so gut wie keine<br />
Auslaugungen zu, so dass die Proben über einen<br />
langen Zeitraum unverfälscht bleiben.<br />
Porvair Sciences Ltd.<br />
Unit 6, Shepperton Business Park<br />
Govett Avenue<br />
Shepperton, Middlesex, TW17 8BA, UK<br />
Tel.: +44-(0)1372-824290<br />
int.sales@porvair-sciences.com<br />
schnelle Konzentrierung als auch eine hohe<br />
Ausbeute erzielt. Ein integrierter Trockenlaufschutz<br />
verhindert das Austrocknen der Proben<br />
und somit die Denaturierung labiler Proteine.<br />
Die Amicon Ultra-0,5 Filtereinheit ergänzt<br />
die Amicon Ultra-4- und Amicon Ultra-15-<br />
Filtereinheiten, die standardmäßig für die<br />
Probenvorbereitung verwendet werden.<br />
Dr Ulrike Baer-Chardot<br />
Millipore<br />
Bioscience Division<br />
Tel.: +33-(0)1-301270-37<br />
ulrike_baer-chardot@millipore.com<br />
52 | 10. Jahrgang | Nr. 5/2009 LABORWElT
September 2009-November 2009<br />
Veranstaltungskalender<br />
28.09.09<br />
Biosimilars Workshop 2009, London (UK)<br />
Info: DIA Drug Information Association<br />
(E-Mail: diaeurope@diaeurope.org<br />
Web: www.diahome.org)<br />
01.-02.10.09<br />
Ethik der Synthetischen Biologie, Freiburg<br />
Info: Dr. Joachim Boldt, Institut für Ethik und<br />
Geschichte der Medizin (E-Mail: boldt@igm.unifreiburg.de,<br />
Web: www.igm.uni-freiburg.de)<br />
02.10.09<br />
BPI BioPharm Praxisseminar, München<br />
Info: BPI (E-Mail: info@bpi.de,<br />
Web: www.bpi.de)<br />
22. Oktober 2009, Frankfurt/Main<br />
Science4Life-Messe<br />
Die Gründerinitiative Science4Life präsentiert<br />
ihre Kinder: Teilnehmer aus elf<br />
Jahren stellen ihre Technologien und<br />
Produkte vor. Das Angebot wird darüber<br />
hinaus bereichert durch eine Partneringund<br />
eine Stellenbörse. Information: www.<br />
science4life.de<br />
06.-08.10.09<br />
BIOTECHNICA 2009, Hannover (D)<br />
Info: Deutsche Messe AG<br />
(Web: www.biotechnica.de)<br />
07.-10.10.09<br />
6. Jahrestagung der Deutschen Vereinten<br />
Gesellschaft für Klinische Chemie und Laboratoriumsmedizin<br />
(DGKL), Leipzig<br />
Info: Claudia Mittelbach, Conventus (E-Mail:<br />
claudia.mittelbach@conventus.de,<br />
Web: www.conventus.de/dgkl2009/)<br />
Foto: Rentschler Biotechnologie GmbH<br />
24.-27. November 2009 in Berlin<br />
Homogenität in Bioraktoren<br />
Das BioProScale-Symposium „Inhomogenities<br />
in Large Scale Bioreactors – Description,<br />
Scaling, Control“ soll Experten aus der<br />
industriellen Praxis zusammenbringen.<br />
Schwerpunkte sind: Rühren und Mischen,<br />
Zellphysiologie, Sensoren und Probennahme<br />
sowie die Simulation von Prozessen.<br />
www.ifgb.de/bioproscale<br />
07.-09.10.09<br />
ScanBalt Forum and Biomaterials Days 2009,<br />
Kalmar (SE)<br />
Info: Peter Frank, Scanbalt General Secretary<br />
(Web: www.scanbalt.org/forum2009)<br />
13.10.09<br />
Grüne und Weiße Biotechnologie – Nutzen für<br />
Unternehmen, Köln<br />
Info: Detlef Kürten, IHK Köln/Phytowelt Green<br />
Technologies GmbH, (Web: http://www.ihkkoeln.de/VeranstaltungBiotech.)<br />
14.-15.10.09<br />
Scanning Probe Microscopy in Life Sciences/<br />
Optical Tweezers in Life Sciences, Berlin<br />
Info: JPK Instruments<br />
(Tel.: +49-03-5331-120-70,<br />
E-Mail: info@nanobioviews.net,<br />
Web: www.nanobioviews.net)<br />
15.-18.10.09<br />
The Evolution of Medicine – World Health<br />
Summit, Berlin<br />
Info: Dr. Mazda Adli, World Health Summit<br />
Conference Secretariat<br />
(E-Mail: mazda.adli@charite.de,<br />
Web: www.worldhealthsummit.org)<br />
20.-22.10.09<br />
Medical Biodefense Conference, München<br />
Info: Bundeswehr-Institut für Mikrobiologie<br />
(E-Mail: info@biodefense2009.org,<br />
Web: www.biodefense2009.org)<br />
Service Kalender<br />
26.-28.10.09<br />
Immunogenität bei Biopharmazeutika,<br />
Berlin<br />
Info: Mark Reichmann, IQPC<br />
(E-Mail: mark.reichmann@iqpc.de,<br />
Web: www.immunogenitaet.de)<br />
27.-28.10.09<br />
Projektleiter und Beauftragter für die biologische<br />
Sicherheit, Karlsruhe<br />
Info: R. Weyershäuser, FTU Karlsruhe<br />
(E-Mail: renate.weyershaeuser@ftu.fzk.de,<br />
Web: www.fortbildung.fzk.de)<br />
28.10.09<br />
Förderung nachhaltiger Biotechnologie –<br />
Projekt- und Partnerfindungsworkshop zur<br />
5. DBU-ChemBioTec-Antragsrunde,<br />
Frankfurt am Main<br />
Info: ChemBioTec (Web: www.chembiotec.de)<br />
29.10.09<br />
4 rd Fraunhofer Life Science Symposium,<br />
Leipzig<br />
Info: Inst. für Zelltherapie und Immunologie,<br />
Leipzig (Web: www.fs-leipzig.com)<br />
29.-30.10.09<br />
Trenn- und Fraktionierverfahren in der<br />
Lebensmittel- und Biotechnologie, Weihenstephan<br />
Info: Sabine Becker, TU München<br />
(E-Mail: Sabine.Becker@wzw.tum.de,<br />
Web: www.technologieseminar-2009.de)<br />
30. November – 2. Dezember 2009<br />
Pharmakovigilanz, Wiesbaden<br />
Auf dem 4. Jahresforum Pharmakovigilanz<br />
werden neue Entwicklungen wie die regulatorischen<br />
Entwicklungen auf EU-Ebene<br />
oder neue Meldepflichten durch die AMG-<br />
Novelle diskutiert. Information:<br />
www.pharmakovigilanz-konferenz.de<br />
LABORWElT 10. Jahrgang | Nr. 5/2009 | 53
Ausblick<br />
SynBio: Furcht statt<br />
Ingenieurskunst?<br />
Thomas Gabrielczyk<br />
Als Wissenschaftler muss man manchmal auch spinnen können und sich ausmalen, was wäre<br />
wenn…. Genauso scheint es momentan mit der Synthetischen Biologie: das Konzept biologische<br />
Systeme von Grund auf neu zu planen, aus künstlichen Bauelementen zusammenzusetzen und<br />
industriell zu nutzen, gibt es schon seit fast zwei Jahrzehnten. Nun schwappt die Begeisterung für<br />
die Neuschöpfung von Bakterien, lebensunfähigen Protozellen und künstlichen Reaktionskompartimenten,<br />
die Erdöl und alles erdenklich Nützliche produzieren – getragen von professionellen<br />
Bio-Meinungsmachern wie Craig Venter, Jay Keasling, George Church, Drew Endy – endlich über<br />
den großen Teich. Und die Visionen, die aus dem Land kommen, das bereits viermal soviel Geld<br />
wie die EU in das Forschungsgebiet gesteckt hat, können wirklich begeistern. Entstehen soll eine<br />
Art Weiße Superbiotechnologie, in der künstlich programmierte Minimalsysteme fabrikgleich<br />
alles produzieren, was heute in der Industriellen Biotechnologie gerade nicht klappt, weil bisher<br />
weitgehend empirie- und wenig wissensgestützt: Biotreibstoffe aus Cellulose sind da eher die<br />
Untergrenze der Erwartung. Doch falls der Proof-of Concept gelingt, könnte das Feld gerade für<br />
Deutschland interessant werden – stellt die Bundesrepublik schließlich den Weltmarktführer für<br />
synthetische Gene und ist für seine Ingenieurskunst bekannt. Warum also kein VW der produzierenden<br />
Biotechnologie werden, wenn schon die Vermarktung und Anwendung des deutschen<br />
Forschungs-Welthits Grüne Gentechnik nicht geklappt hat?<br />
Die gute Nachricht wäre daher ein umfassendes<br />
Förderprogramm, um frühzeitig kritische<br />
Masse gegenüber den USA zu generieren. Doch<br />
so laufen die Uhren in Europa nicht – und schon<br />
gar nicht in Deutschland. Zwar empfiehlt die<br />
Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) in<br />
einem mitten im Sommerloch publizierten<br />
Positionspapier zur synthetischen Biologie<br />
ausdrücklich eine Förderung der Grundlagenforschung.<br />
Doch nicht einmal ein Schwerpunktprogramm<br />
ist das Lippenbekenntnis<br />
in näherer Zukunft den Bonnern wert. Auch<br />
die Max-Planck-Gesellschaft zeigt sich wenig<br />
begeistert. Der einzige auf dem Gebiet Forschende<br />
habe einen Ruf erhalten und verlasse<br />
bald sein Institut im Süden Deutschlands,<br />
heißt es.<br />
Anstatt die Begeisterung für das Feld weiterzugeben<br />
und damit Kräfte zu wecken, verfallen<br />
Europäer und Deutsche erneut in die alte Gewohnheit,<br />
zunächst eine öffentliche Diskussi-<br />
Impressum<br />
LABORWELT (ISSN 1611-0854)<br />
erscheint zweimonatlich im<br />
BIOCOM Verlag GmbH<br />
Stralsunder Straße 58–59<br />
13355 Berlin, Germany<br />
Tel./Fax: 030/264921-0 / 030/264921-11<br />
laborwelt@biocom.de<br />
www.biocom.de<br />
Redaktion<br />
Dipl.-Biol. Thomas Gabrielczyk<br />
Tel.: 030/264921-50<br />
Anzeigenleitung<br />
Oliver Schnell<br />
Tel. 030/264921-45,<br />
o.schnell@biocom.de<br />
Leserservice<br />
Angelika Werner<br />
Tel. 030/264921-40<br />
Bildtechnik und Layout<br />
Heiko Fritz<br />
Graphik-Design<br />
Michaela Reblin<br />
Druck:<br />
Druckhaus Humburg GmbH, 28325 Bremen<br />
Für einen regelmäßigen Bezug von LABORWELT<br />
ist eine kostenlose Registrierung unter www.<br />
biocom.de oder per Fax erforderlich. Namentlich<br />
gekennzeichnete Beiträge stehen in der<br />
inhaltlichen Verantwortung der Autoren.<br />
on zu den nicht so tollen Seiten anzustoßen. Ob<br />
diese Strategie der vorgreifenden Diskussion<br />
etwaiger Nachteile Jahre vor jeder absehbaren<br />
Anwendung tatsächlich Akzeptanz schafft, ist<br />
fraglich – zumal die Europäer, allen voran die<br />
Presseleute laut einer US-Studie der Technik<br />
halb so zuversichtlich gegenüberstehen als die<br />
amerikanischen Kollegen.<br />
EU will regeln<br />
Noch schlimmer könnte es auf EU-Ebene<br />
werden, wenn eine 2008 von Kommissionspräsident<br />
Barroso bei der European Group<br />
of Ethics beauftragte Studie tatsächlich im<br />
Oktober veröffentlicht wird. Sie fordert eine<br />
gesetzliche Regelung des Feldes, um etwaige<br />
Gefahren zu bannen. Die US-Forscher und<br />
-Ingenieure können sich also freuen, denn ihre<br />
EU-Kollegen müssen diskutieren.<br />
Alle Beiträge sind urheberrechtlich geschützt.<br />
Ohne schriftliche Genehmigung des BIOCOM<br />
Verlages darf kein Teil in irgendeiner Form<br />
reproduziert oder mit elektronischen Systemen<br />
verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.<br />
Diese Ausgabe enthält eine Verlagsbeilage<br />
(Euro Biofairs Compass) und Beilagen<br />
von Bandelin electronics, New England<br />
Biolabs sowie biotechnologie.de<br />
Die Druckauflage von 20 000 Exemplaren<br />
ist IVW geprüft (Stand II/09):<br />
© BIOCOM Verlag GmbH, Berlin<br />
® BIOCOM ist eine geschützte Marke der<br />
BIOCOM AG, Berlin<br />
BIOCOM<br />
Inserentenverzeichnis<br />
AGOWA GmbH ………………………………………… 25<br />
Bandelin electronic GmbH ……………Beilage<br />
Beckman Coulter GmbH ………………………… 33<br />
BIOCOM Projektmanagement GmbH … 31<br />
BIOCOM AG ………………………………………Beilage<br />
Biometra GmbH …………………………………………11<br />
biotechnologie.de ……………………………Beilage<br />
Deutsche Messe AG ………………………………… 17<br />
Dr. Lerche KG …………………………………………… 15<br />
EBD Group, BioEurope …………………………… U3<br />
Eppendorf AG …………………………………………… 41<br />
Fujifilm Europe GmbH ……………………………… 7<br />
Merck Chemicals Ltd. ……………………………… 23<br />
Microsynth AG ……………………………………………9<br />
New England Biolabs GmbH …U4, Beilage<br />
PerkinElmer ……………………………………………… 27<br />
Porvair Science Ltd. ………………………………… 13<br />
Roche Diagnostics GmbH ……………………… U2<br />
Thermo Fisher Sicentific ………………………… 5<br />
Vorschau Heft 6/2009<br />
Thema<br />
Mikrobielle Genomik<br />
Mikrobielle Produktionsorganismen, Krankheitserreger,<br />
Biofilme und Lebensgemeinschaften<br />
stehen im Mittelpunkt der nächsten<br />
Themenausgabe von LABORWELT. Wieweit<br />
Metabolic Engineering und Synthetische<br />
Biologie voneinander profitieren können, wie<br />
sehr schnelle Sequenzierungsmethoden helfen,<br />
wirtschaftlich interessante Funktionen<br />
der Mikroorganismen zu nutzen oder Biomarker<br />
der Entwicklung neuer Diagnostika<br />
und Therapeutika dienen, das beleuchtet die<br />
Themen-Ausgabe „Mikrobielle Genomik“.<br />
Marktübersicht: DNA-Anreicherung<br />
Werbekunden bietet diese Ausgabe mit einer<br />
garantierten Auflage von 20.000 Exemplaren<br />
(IVW-geprüft) eine optimale Plattform<br />
für ihre Produkt- und Imageanzeigen.<br />
Reservieren Sie Ihren Werbeplatz in der<br />
LABORWELT-Themenausgabe bis spätestens<br />
zum 13. November 2009. Ergänzend zu dem<br />
Themenschwerpunkt veröffentlichen wir<br />
eine Marktübersicht „DNA Enrichement“.<br />
Informationen zu Ihrer möglichen Teilnahme<br />
gibt Oliver Schnell (Tel.: +49-30-264921-45,<br />
eMail: o.schnell@biocom.de).<br />
54 | 10. Jahrgang | Nr. 5/2009 LABORWElT
Join the<br />
pre-conference<br />
partnering<br />
process<br />
Building Value Through ParTnershiPs<br />
BIO-EurOpE<br />
15TH ANNUAL INTERNATIONAL<br />
PARTNERING CONFERENCE<br />
2009<br />
November 2–4, 2009<br />
vieNNa, austria<br />
messe WieN exhibitioN & CoNgress CeNter<br />
BIO-Europe is Europe’s largest partnering conference, serving the global biotechnology<br />
industry. The conference annually attracts international leaders from biotech, pharma and<br />
finance along with the most promising start-ups and emerging companies. It is the “must<br />
attend” event for getting business done in the biotech industry.<br />
For further information, please view our conference website at<br />
www.ebdgroup.com/bioeurope<br />
© 2009 EBD Group AG<br />
Background image<br />
© Wien Tourismus/MAXUM
InnovatIve DIscovery tools For sIgnal transDuctIon research<br />
Pathways In Human Cancer<br />
Pathways In Human Cancer<br />
InnovatIve DIscovery tools For sIgnal transDuctIon research<br />
Immunofluorescence Using Activation~state Antibodies<br />
Immunofluorescence Using Activation~state ...from Cell Signaling Antibodies Technology<br />
• Phospho-p44/42 MAPK (green) • Phospho-Akt (red)<br />
• Phospho-p44/42 MAPK (green) • Phospho-Akt (red)<br />
Untreated LPA, 2 min LPA, 5 min<br />
Untreated LPA, 2 min LPA, 5 min<br />
LPA, 15 min LPA, 15 min + LY294002 LPA, 15 min + U0126<br />
Confocal IF images of Phospho-p44/42 MAPK (Thr202/Tyr204) (E10) #9106<br />
Mouse mAb (green) and Phospho-Akt (Ser473) (193H12) Rabbit mAb<br />
#4058 (red) in C6 rat glioma cells treated with LPA as indicated.<br />
LPA induces cytoplasmic and nuclear phospho-p44/42 MAPK signal<br />
and cytoplasmic and membrane phospho-Akt signal. Addition of MEK<br />
inhibitor U0126 #9903 or PI3K inhibitor LY294002 #9901 completely<br />
blocks activation of phospho-p44/42 MAPK or phospho-Akt,<br />
respectively. Blue pseudocolor = DRAQ5<br />
GSK-3<br />
Confocal IF images of Phospho-p44/42 MAPK (Thr202/Tyr204) (E10) #9106<br />
Mouse mAb (green) and Phospho-Akt (Ser473) (193H12) Rabbit mAb<br />
#4058 (red) in C6 rat glioma cells treated with LPA as indicated.<br />
LPA induces cytoplasmic and nuclear phospho-p44/42 MAPK signal<br />
and cytoplasmic and membrane phospho-Akt signal. Addition of MEK<br />
inhibitor U0126 #9903 or PI3K inhibitor LY294002 #9901 completely<br />
(fluorescent DNA dye).<br />
blocks activation of phospho-p44/42 MAPK or phospho-Akt,<br />
respectively. Blue pseudocolor = DRAQ5<br />
GSK-3<br />
LPA, 15 min LPA, 15 min + LY294002 LPA, 15 min + U0126<br />
(fluorescent DNA dye).<br />
For our Free Pathways<br />
In Human Cancer poster<br />
please<br />
For our<br />
visit<br />
Free<br />
our<br />
Pathways<br />
website:<br />
www.neb-online.de<br />
In Human Cancer poster<br />
please visit our website:<br />
www.neb-online.de<br />
Cyclin D<br />
Cyclin D<br />
p21 p27<br />
p21 p27<br />
FKHR/<br />
FOXO<br />
FKHR/<br />
FOXO<br />
mTOR<br />
Rictor<br />
mTOR<br />
Rictor<br />
MDM2<br />
MDM2<br />
in Deutschland und Österreich exklusiv von<br />
n New England Biolabs GmbH Frankfurt/Main Deutschland Tel.: +49(0)69-305-23140 Fax.: +49(0)69-305-23149 in Deutschland email: und Österreich info@de.neb.com exklusiv www.neb-online.de von<br />
n Cell Signaling Technology Inc. Danvers, MA USA Tel. 1-877-616-CELL (2355) Fax 1-978-867-2488 email: info@cellsignal.com www.cellsignal.com<br />
n New England Biolabs GmbH Frankfurt/Main Deutschland Tel.: +49(0)69-305-23140 Fax.: +49(0)69-305-23149 email: info@de.neb.com www.neb-online.de<br />
n Cell Signaling Technology Inc. Danvers, MA USA Tel. 1-877-616-CELL (2355) Fax 1-978-867-2488 email: info@cellsignal.com www.cellsignal.com<br />
...from Cell Signaling Technology<br />
Akt<br />
Akt<br />
XIAP<br />
PIP 3<br />
PIP 3<br />
Pl3K<br />
Pl3K<br />
c-Raf<br />
c-Raf<br />
XIAP<br />
Bcl-x<br />
Bcl-x<br />
Gab1<br />
Gab2<br />
Gab1<br />
Gab2<br />
PDK1<br />
PDK1<br />
PP2A<br />
PP2A<br />
PAK1<br />
PAK1<br />
RTK<br />
LY294002<br />
14-3-3<br />
Bad<br />
14-3-3<br />
Bad<br />
NEW EN GL AN D<br />
® Bi NEW oL EN abs GL AN D<br />
® Bi oL abs<br />
CytC<br />
GmbH<br />
RTK<br />
LY294002<br />
CytC<br />
GmbH<br />
Halle 9, Stand A24<br />
Halle 9, Stand A24