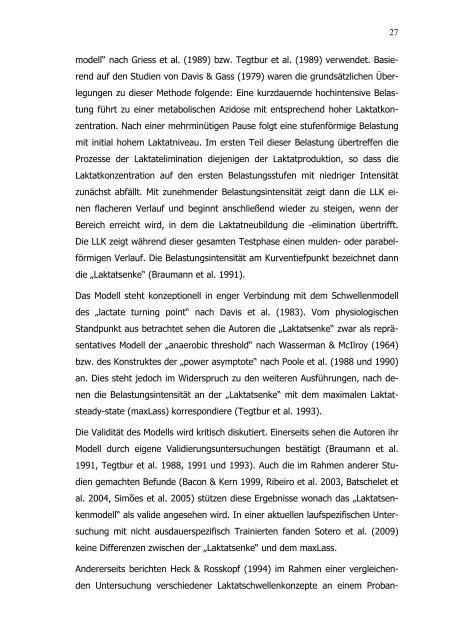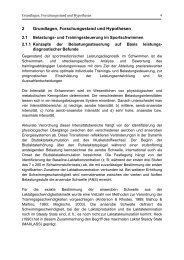Untersuchung der Validität verschiedener Laktatschwellenkonzepte ...
Untersuchung der Validität verschiedener Laktatschwellenkonzepte ...
Untersuchung der Validität verschiedener Laktatschwellenkonzepte ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
27modell“ nach Griess et al. (1989) bzw. Tegtbur et al. (1989) verwendet. Basierendauf den Studien von Davis & Gass (1979) waren die grundsätzlichen Überlegungenzu dieser Methode folgende: Eine kurzdauernde hochintensive Belastungführt zu einer metabolischen Azidose mit entsprechend hoher Laktatkonzentration.Nach einer mehrminütigen Pause folgt eine stufenförmige Belastungmit initial hohem Laktatniveau. Im ersten Teil dieser Belastung übertreffen dieProzesse <strong>der</strong> Laktatelimination diejenigen <strong>der</strong> Laktatproduktion, so dass dieLaktatkonzentration auf den ersten Belastungsstufen mit niedriger Intensitätzunächst abfällt. Mit zunehmen<strong>der</strong> Belastungsintensität zeigt dann die LLK einenflacheren Verlauf und beginnt anschließend wie<strong>der</strong> zu steigen, wenn <strong>der</strong>Bereich erreicht wird, in dem die Laktatneubildung die -elimination übertrifft.Die LLK zeigt während dieser gesamten Testphase einen mulden- o<strong>der</strong> parabelförmigenVerlauf. Die Belastungsintensität am Kurventiefpunkt bezeichnet danndie „Laktatsenke“ (Braumann et al. 1991).Das Modell steht konzeptionell in enger Verbindung mit dem Schwellenmodelldes „lactate turning point“ nach Davis et al. (1983). Vom physiologischenStandpunkt aus betrachtet sehen die Autoren die „Laktatsenke“ zwar als repräsentativesModell <strong>der</strong> „anaerobic threshold“ nach Wasserman & McIlroy (1964)bzw. des Konstruktes <strong>der</strong> „power asymptote“ nach Poole et al. (1988 und 1990)an. Dies steht jedoch im Wi<strong>der</strong>spruch zu den weiteren Ausführungen, nach denendie Belastungsintensität an <strong>der</strong> „Laktatsenke“ mit dem maximalen Laktatsteady-state(maxLass) korrespondiere (Tegtbur et al. 1993).Die Validität des Modells wird kritisch diskutiert. Einerseits sehen die Autoren ihrModell durch eigene Validierungsuntersuchungen bestätigt (Braumann et al.1991, Tegtbur et al. 1988, 1991 und 1993). Auch die im Rahmen an<strong>der</strong>er Studiengemachten Befunde (Bacon & Kern 1999, Ribeiro et al. 2003, Batschelet etal. 2004, Simões et al. 2005) stützen diese Ergebnisse wonach das „Laktatsenkenmodell“als valide angesehen wird. In einer aktuellen laufspezifischen <strong>Untersuchung</strong>mit nicht ausdauerspezifisch Trainierten fanden Sotero et al. (2009)keine Differenzen zwischen <strong>der</strong> „Laktatsenke“ und dem maxLass.An<strong>der</strong>erseits berichten Heck & Rosskopf (1994) im Rahmen einer vergleichenden<strong>Untersuchung</strong> <strong>verschiedener</strong> <strong>Laktatschwellenkonzepte</strong> an einem Proban-