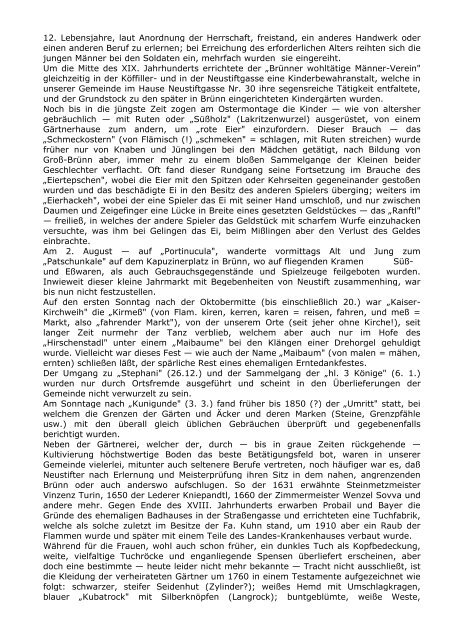Die Brünner Vorstadt Neustift
Die Brünner Vorstadt Neustift
Die Brünner Vorstadt Neustift
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
12. Lebensjahre, laut Anordnung der Herrschaft, freistand, ein anderes Handwerk oder<br />
einen anderen Beruf zu erlernen; bei Erreichung des erforderlichen Alters reihten sich die<br />
jungen Männer bei den Soldaten ein, mehrfach wurden sie eingereiht.<br />
Um die Mitte des XIX. Jahrhunderts errichtete der „<strong>Brünner</strong> wohltätige Männer-Verein"<br />
gleichzeitig in der Köffiller- und in der <strong>Neustift</strong>gasse eine Kinderbewahranstalt, welche in<br />
unserer Gemeinde im Hause <strong>Neustift</strong>gasse Nr. 30 ihre segensreiche Tätigkeit entfaltete,<br />
und der Grundstock zu den später in Brünn eingerichteten Kindergärten wurden.<br />
Noch bis in die jüngste Zeit zogen am Ostermontage die Kinder — wie von altersher<br />
gebräuchlich — mit Ruten oder „Süßholz" (Lakritzenwurzel) ausgerüstet, von einem<br />
Gärtnerhause zum andern, um „rote Eier" einzufordern. <strong>Die</strong>ser Brauch — das<br />
„Schmeckostern" (von Flämisch (!) „schmeken" = schlagen, mit Ruten streichen) wurde<br />
früher nur von Knaben und Jünglingen bei den Mädchen getätigt, nach Bildung von<br />
Groß-Brünn aber, immer mehr zu einem bloßen Sammelgange der Kleinen beider<br />
Geschlechter verflacht. Oft fand dieser Rundgang seine Fortsetzung im Brauche des<br />
„Eiertepschen", wobei die Eier mit den Spitzen oder Kehrseiten gegeneinander gestoßen<br />
wurden und das beschädigte Ei in den Besitz des anderen Spielers überging; weiters im<br />
„Eierhackeh", wobei der eine Spieler das Ei mit seiner Hand umschloß, und nur zwischen<br />
Daumen und Zeigefinger eine Lücke in Breite eines gesetzten Geldstückes — das „Ranftl"<br />
— freiließ, in welches der andere Spieler das Geldstück mit scharfem Wurfe einzuhacken<br />
versuchte, was ihm bei Gelingen das Ei, beim Mißlingen aber den Verlust des Geldes<br />
einbrachte.<br />
Am 2. August — auf „Portinucula", wanderte vormittags Alt und Jung zum<br />
„Patschunkale" auf dem Kapuzinerplatz in Brünn, wo auf fliegenden Kramen Süß-<br />
und Eßwaren, als auch Gebrauchsgegenstände und Spielzeuge feilgeboten wurden.<br />
Inwieweit dieser kleine Jahrmarkt mit Begebenheiten von <strong>Neustift</strong> zusammenhing, war<br />
bis nun nicht festzustellen.<br />
Auf den ersten Sonntag nach der Oktobermitte (bis einschließlich 20.) war „Kaiser-<br />
Kirchweih" die „Kirmeß" (von Flam. kiren, kerren, karen = reisen, fahren, und meß =<br />
Markt, also „fahrender Markt"), von der unserem Orte (seit jeher ohne Kirche!), seit<br />
langer Zeit nurmehr der Tanz verblieb, welchem aber auch nur im Hofe des<br />
„Hirschenstadl" unter einem „Maibaume" bei den Klängen einer Drehorgel gehuldigt<br />
wurde. Vielleicht war dieses Fest — wie auch der Name „Maibaum" (von malen = mähen,<br />
ernten) schließen läßt, der spärliche Rest eines ehemaligen Erntedankfestes.<br />
Der Umgang zu „Stephani" (26.12.) und der Sammelgang der „hl. 3 Könige" (6. 1.)<br />
wurden nur durch Ortsfremde ausgeführt und scheint in den Überlieferungen der<br />
Gemeinde nicht verwurzelt zu sein.<br />
Am Sonntage nach „Kunigunde" (3. 3.) fand früher bis 1850 (?) der „Umritt" statt, bei<br />
welchem die Grenzen der Gärten und Äcker und deren Marken (Steine, Grenzpfähle<br />
usw.) mit den überall gleich üblichen Gebräuchen überprüft und gegebenenfalls<br />
berichtigt wurden.<br />
Neben der Gärtnerei, welcher der, durch — bis in graue Zeiten rückgehende —<br />
Kultivierung höchstwertige Boden das beste Betätigungsfeld bot, waren in unserer<br />
Gemeinde vielerlei, mitunter auch seltenere Berufe vertreten, noch häufiger war es, daß<br />
<strong>Neustift</strong>er nach Erlernung und Meisterprüfung ihren Sitz in dem nahen, angrenzenden<br />
Brünn oder auch anderswo aufschlugen. So der 1631 erwähnte Steinmetzmeister<br />
Vinzenz Turin, 1650 der Lederer Kniepandtl, 1660 der Zimmermeister Wenzel Sovva und<br />
andere mehr. Gegen Ende des XVIII. Jahrhunderts erwarben Probail und Bayer die<br />
Gründe des ehemaligen Badhauses in der Straßengasse und errichteten eine Tuchfabrik,<br />
welche als solche zuletzt im Besitze der Fa. Kuhn stand, um 1910 aber ein Raub der<br />
Flammen wurde und später mit einem Teile des Landes-Krankenhauses verbaut wurde.<br />
Während für die Frauen, wohl auch schon früher, ein dunkles Tuch als Kopfbedeckung,<br />
weite, vielfaltige Tuchröcke und enganliegende Spensen überliefert erscheinen, aber<br />
doch eine bestimmte — heute leider nicht mehr bekannte — Tracht nicht ausschließt, ist<br />
die Kleidung der verheirateten Gärtner um 1760 in einem Testamente aufgezeichnet wie<br />
folgt: schwarzer, steifer Seidenhut (Zylinder?); weißes Hemd mit Umschlagkragen,<br />
blauer „Kubatrock" mit Silberknöpfen (Langrock); buntgeblümte, weiße Weste,