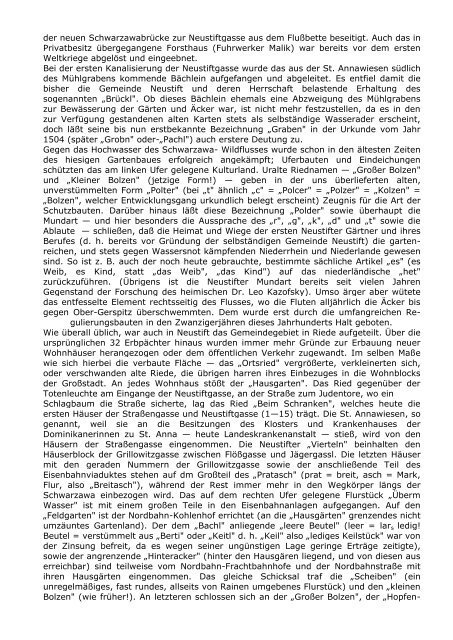Die Brünner Vorstadt Neustift
Die Brünner Vorstadt Neustift
Die Brünner Vorstadt Neustift
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
der neuen Schwarzawabrücke zur <strong>Neustift</strong>gasse aus dem Flußbette beseitigt. Auch das in<br />
Privatbesitz übergegangene Forsthaus (Fuhrwerker Malik) war bereits vor dem ersten<br />
Weltkriege abgelöst und eingeebnet.<br />
Bei der ersten Kanalisierung der <strong>Neustift</strong>gasse wurde das aus der St. Annawiesen südlich<br />
des Mühlgrabens kommende Bächlein aufgefangen und abgeleitet. Es entfiel damit die<br />
bisher die Gemeinde <strong>Neustift</strong> und deren Herrschaft belastende Erhaltung des<br />
sogenannten „Brückl". Ob dieses Bächlein ehemals eine Abzweigung des Mühlgrabens<br />
zur Bewässerung der Gärten und Äcker war, ist nicht mehr festzustellen, da es in den<br />
zur Verfügung gestandenen alten Karten stets als selbständige Wasserader erscheint,<br />
doch läßt seine bis nun erstbekannte Bezeichnung „Graben" in der Urkunde vom Jahr<br />
1504 (später „Grobn" oder-„Pachl") auch erstere Deutung zu.<br />
Gegen das Hochwasser des Schwarzawa- Wildflusses wurde schon in den ältesten Zeiten<br />
des hiesigen Gartenbaues erfolgreich angekämpft; Uferbauten und Eindeichungen<br />
schützten das am linken Ufer gelegene Kulturland. Uralte Riednamen — „Großer Bolzen"<br />
und „Kleiner Bolzen" (jetzige Form!) — geben in der uns überlieferten alten,<br />
unverstümmelten Form „Polter" (bei „t" ähnlich „c" = „Polcer" = „Polzer" = „Kolzen" =<br />
„Bolzen", welcher Entwicklungsgang urkundlich belegt erscheint) Zeugnis für die Art der<br />
Schutzbauten. Darüber hinaus läßt diese Bezeichnung „Polder" sowie überhaupt die<br />
Mundart — und hier besonders die Aussprache des „r", „g", „k", „d" und „t" sowie die<br />
Ablaute — schließen, daß die Heimat und Wiege der ersten <strong>Neustift</strong>er Gärtner und ihres<br />
Berufes (d. h. bereits vor Gründung der selbständigen Gemeinde <strong>Neustift</strong>) die garten-<br />
reichen, und stets gegen Wassersnot kämpfenden Niederrhein und Niederlande gewesen<br />
sind. So ist z. B. auch der noch heute gebrauchte, bestimmte sächliche Artikel „es" (es<br />
Weib, es Kind, statt „das Weib", „das Kind") auf das niederländische „het"<br />
zurückzuführen. (Übrigens ist die <strong>Neustift</strong>er Mundart bereits seit vielen Jahren<br />
Gegenstand der Forschung des heimischen Dr. Leo Kazofsky). Umso ärger aber wütete<br />
das entfesselte Element rechtsseitig des Flusses, wo die Fluten alljährlich die Äcker bis<br />
gegen Ober-Gerspitz überschwemmten. Dem wurde erst durch die umfangreichen Regulierungsbauten<br />
in den Zwanzigerjähren dieses Jahrhunderts Halt geboten.<br />
Wie überall üblich, war auch in <strong>Neustift</strong> das Gemeindegebiet in Riede aufgeteilt. Über die<br />
ursprünglichen 32 Erbpächter hinaus wurden immer mehr Gründe zur Erbauung neuer<br />
Wohnhäuser herangezogen oder dem öffentlichen Verkehr zugewandt. Im selben Maße<br />
wie sich hierbei die verbaute Fläche — das „Ortsried" vergrößerte, verkleinerten sich,<br />
oder verschwanden alte Riede, die übrigen harren ihres Einbezuges in die Wohnblocks<br />
der Großstadt. An jedes Wohnhaus stößt der „Hausgarten". Das Ried gegenüber der<br />
Totenleuchte am Eingange der <strong>Neustift</strong>gasse, an der Straße zum Judentore, wo ein<br />
Schlagbaum die Straße sicherte, lag das Ried „Beim Schranken", welches heute die<br />
ersten Häuser der Straßengasse und <strong>Neustift</strong>gasse (1—15) trägt. <strong>Die</strong> St. Annawiesen, so<br />
genannt, weil sie an die Besitzungen des Klosters und Krankenhauses der<br />
Dominikanerinnen zu St. Anna — heute Landeskrankenanstalt — stieß, wird von den<br />
Häusern der Straßengasse eingenommen. <strong>Die</strong> <strong>Neustift</strong>er „Vierteln" beinhalten den<br />
Häuserblock der Grillowitzgasse zwischen Flößgasse und Jägergassl. <strong>Die</strong> letzten Häuser<br />
mit den geraden Nummern der Grillowitzgasse sowie der anschließende Teil des<br />
Eisenbahnviaduktes stehen auf dm Großteil des „Pratasch" (prat = breit, asch = Mark,<br />
Flur, also „Breitasch"), während der Rest immer mehr in den Wegkörper längs der<br />
Schwarzawa einbezogen wird. Das auf dem rechten Ufer gelegene Flurstück „Überm<br />
Wasser" ist mit einem großen Teile in den Eisenbahnanlagen aufgegangen. Auf den<br />
„Feldgarten" ist der Nordbahn-Kohlenhof errichtet (an die „Hausgärten" grenzendes nicht<br />
umzäuntes Gartenland). Der dem „Bachl" anliegende „leere Beutel" (leer = lars ledig!<br />
Beutel = verstümmelt aus „Berti" oder „Keitl" d. h. „Keil" also „lediges Keilstück" war von<br />
der Zinsung befreit, da es wegen seiner ungünstigen Lage geringe Erträge zeitigte),<br />
sowie der angrenzende „Hinteracker" (hinter den Hausgären liegend, und von diesen aus<br />
erreichbar) sind teilweise vom Nordbahn-Frachtbahnhofe und der Nordbahnstraße mit<br />
ihren Hausgärten eingenommen. Das gleiche Schicksal traf die „Scheiben" (ein<br />
unregelmäßiges, fast rundes, allseits von Rainen umgebenes Flurstück) und den „kleinen<br />
Bolzen" (wie früher!). An letzteren schlossen sich an der „Großer Bolzen", der „Hopfen-