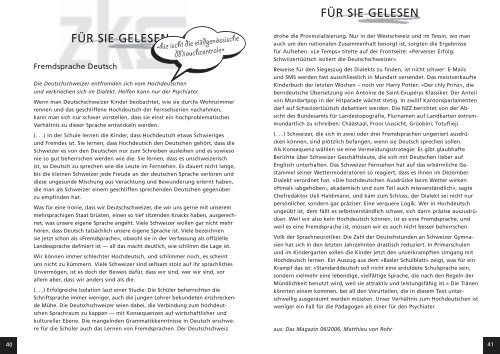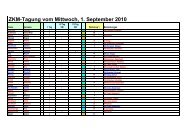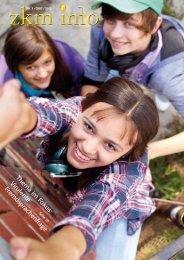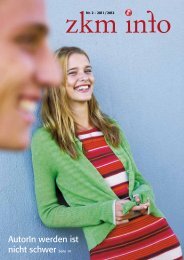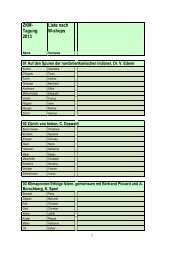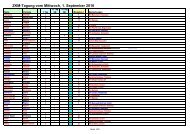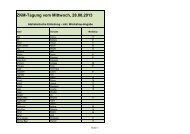April 2006: Inhalt - ZKM
April 2006: Inhalt - ZKM
April 2006: Inhalt - ZKM
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
FÜR SIE GELESENFÜR SIE GELESENFremdsprache Deutsch«hie ischt die eiiidgenössischeMiouchzentrale»Die Deutschschweizer entfremden sich vom Hochdeutschenund verkriechen sich im Dialekt. Helfen kann nur der Psychiater.Wenn man Deutschschweizer Kinder beobachtet, wie sie durchs Wohnzimmerrennen und das geschliffene Hochdeutsch der Fernsehserien nachahmen,kann man sich nur schwer vorstellen, dass sie einst ein hochproblematischesVerhältnis zu dieser Sprache entwickeln werden.(. . .) In der Schule lernen die Kinder, dass Hochdeutsch etwas Schwierigesund Fremdes ist. Sie lernen, dass Hochdeutsch den Deutschen gehört, dass dieSchweizer es von den Deutschen nur zum Schreiben ausleihen und es sowiesonie so gut beherrschen werden wie die. Sie lernen, dass es unschweizerischist, so Deutsch zu sprechen wie die Leute im Fernsehen. Es dauert nicht lange,bis die kleinen Schweizer jede Freude an der deutschen Sprache verloren unddiese ungesunde Mischung aus Verachtung und Bewunderung erlernt haben,die man als Schweizer einem geschliffen sprechenden Deutschen gegenüberzu empfinden hat.Was für eine Ironie, dass wir Deutschschweizer, die wir uns gerne mit unseremmehrsprachigen Staat brüsten, einen so tief sitzenden Knacks haben, ausgerechnet,was unsere eigene Sprache angeht. Viele Schweizer wollen gar nicht mehrhören, dass Deutsch tatsächlich unsere eigene Sprache ist. Viele bezeichnensie jetzt schon als «Fremdsprache», obwohl sie in der Verfassung als offizielleLandessprache definiert ist — all das macht deutlich, wie schlimm die Lage ist.Wir können immer schlechter Hochdeutsch, und schlimmer noch, es scheintuns nicht zu kümmern. Viele Schweizer sind seltsam stolz auf ihr sprachlichesUnvermögen, ist es doch der Beweis dafür, dass wir sind, wer wir sind, vorallem aber, dass wir anders sind als die.(. . .) Erfolgreiche Isolation laut einer Studie: Die Schüler beherrschten dieSchriftsprache immer weniger, auch die jungen Lehrer bekundeten erschreckendeMühe. Die Deutschschweizer seien dabei, die Verbindung zum hochdeutschenSprachraum zu kappen — mit Konsequenzen auf wirtschaftlicher undkultureller Ebene. Die mangelnden Grammatikkenntnisse in Deutsch erschwerefür die Schüler auch das Lernen von Fremdsprachen. Der Deutschschweizdrohe die Provinzialisierung. Nur in der Westschweiz und im Tessin, wo manauch um den nationalen Zusammenhalt besorgt ist, sorgten die Ergebnissefür Aufsehen. «Le Temps» titelte auf der Frontseite: «Perverser Erfolg:Schwiizertüütsch isoliert die Deutschschweizer».Beweise für den Siegeszug des Dialekts zu finden, ist nicht schwer: E-Mailsund SMS werden fast ausschliesslich in Mundart versendet. Das meistverkaufteKinderbuch der letzten Wochen – noch vor Harry Potter: «Der chly Prinz», dieberndeutsche Übersetzung von Antoine de Saint-Exupérys Klassiker. Der Anteilvon Mundartpop in der Hitparade wächst stetig. In zwölf Kantonsparlamentendarf auf Schwiizertüütsch debattiert werden. Die NZZ berichtet von der Absichtdes Bundesamts für Landestopografie, Flurnamen auf Landkarten extremmundartlichzu schreiben: Chäästaal, Frooi Uussicht, Grüobini, Totuflieji.(. . .) Schweizer, die sich in zwei oder drei Fremdsprachen ungeniert ausdrückenkönnen, sind plötzlich befangen, wenn sie Deutsch sprechen sollen.Als Konsequenz wählen sie eine Vermeidungsstrategie: Es gibt glaubhafteBerichte über Schweizer Geschäftsleute, die sich mit Deutschen lieber aufEnglisch unterhalten. Das Schweizer Fernsehen hat auf das erbärmliche Gestammelseiner Wettermoderatoren so reagiert, dass es ihnen im DezemberDialekt verordnet hat. «Die hochdeutschen Ausdrücke beim Wetter wirkenoftmals ‹abgehoben›, akademisch und zum Teil auch missverständlich», sagteChefredaktor Ueli Haldimann, und kam zum Schluss, der Dialekt sei nicht nurpersönlicher, sondern gar präziser. Eine verquere Logik: Wer in Hochdeutschungeübt ist, dem fällt es selbstverständlich schwer, sich darin präzise auszudrücken.Weil wir also kein Hochdeutsch können, ist es eine Fremdsprache, undweil es eine Fremdsprache ist, müssen wir es auch nicht besser beherrschen.Volk der Sprachneurotiker. Die Zahl der Deutschstunden an Schweizer Gymnasienhat sich in den letzten Jahrzehnten drastisch reduziert. In Primarschulenund im Kindergarten sollen die Kinder jetzt den unverkrampften Umgang mitHochdeutsch lernen. Ein Auszug aus dem «Basler Schulblatt» zeigt, was für einKrampf das ist: «Standarddeutsch soll nicht eine erduldete Schulsprache sein,sondern vielmehr eine lebendige, vielfältige Sprache, die nach den Regeln derMündlichkeit benutzt wird, weil sie attraktiv und leistungsfähig ist.» Die Tränenkönnten einem kommen, bei all den Vorurteilen, die in diesem Text unterschwelligausgeräumt werden müssten. Unser Verhältnis zum Hochdeutschen istweniger ein Fall für die Pädagogen als einer für den Psychiater.aus: Das Magazin 06/<strong>2006</strong>, Matthieu von Rohr40 41