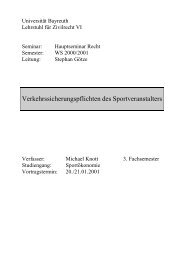Das Verbot dynamischer Satzungsverweisungen - sportrecht.org
Das Verbot dynamischer Satzungsverweisungen - sportrecht.org
Das Verbot dynamischer Satzungsverweisungen - sportrecht.org
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
c) Modifizierte Normentheorie<br />
Die ursprüngliche Normentheorie fand weder direkten Eingang in das BGB 32 , noch lag sie jemals<br />
einer höchstrichterlichen Entscheidung unmittelbar zu Grunde. 33 Aus dem Grundgedanken<br />
der reinen Normentheorie und dem rechtsgeschäftlichen Ansatzpunkt des Vertragsmodells hat<br />
sich jedoch das korporationsrechtliche Modell entwickelt. 34 Dieses geht davon aus, dass die Satzung<br />
zum Zeitpunkt der Vereinsgründung eine vertragliche Wesensart aufweise, 35 also zunächst<br />
als ein von den Gründungsmitgliedern geschlossener Vertrag anzusehen sei. 36 Auf diesen findet<br />
auch § 139 BGB Anwendung, so dass etwa die Nichtigkeit einzelner Satzungsbestimmungen zu<br />
einer Gesamtnichtigkeit der Satzung führen kann. 37 Mit der Entstehung des Vereins löst sich<br />
jedoch die Satzung von der Person der Gründer 38 , so dass die Satzung fortan als Verfassung zu<br />
betrachten ist. 39 Sie erlangt quasi unabhängiges rechtliches Eigenleben und objektiviert fortan<br />
das rechtliche Wollen des Vereins als der Zusammenfassung seiner Mitglieder. 40 Folglich sind<br />
Wille und Interesse der Vereinsgründer für den weiteren Bestand der Satzung unbeachtlich. Eine<br />
auf Teilnichtigkeit gem. § 139 BGB beruhende Rechtsfolge kann ab diesem Zeitpunkt damit<br />
nicht mehr eintreten. 41 <strong>Das</strong> sog. korporationsrechtliche Modell vollzieht die Entwicklung des<br />
Vereins am genauesten nach, so dass diesem Ansatz im Ergebnis zuzustimmen ist.<br />
4. Schranken der Satzungsautonomie<br />
Die Aufteilung des Meinungsspektrums zur Einordnung vereinsrechtlicher Regelungen beschreibt<br />
zugleich den divergierenden Umfang gerichtlicher Nachprüfbarkeit. Während nach der<br />
Normentheorie die gerichtliche Nachprüfbarkeit nur eingeschränkt möglich ist, erlaubt die Vertragstheorie<br />
eine relativ umfassende Überprüfung. 42 Bedingt durch das korporationsrechtliche<br />
Modell und die ständige Rechtsprechung des BGH ist der Spielraum richterlicher Überprüfung<br />
durch die Rechtsprechung eingeschränkt, auch wenn eine Entwicklung zu einer umfassenderen<br />
richterlichen Kontrolle erkennbar ist. 43 Eine Tendenz zur Begrenzung der Vereinsautonomie<br />
32 So ging der Gesetzgeber davon aus, dass die Errichtung eines Vereins und die damit verbundene Feststellung der<br />
Satzung ein Gründungsvertrag sei; vgl. Mugdan, Materialien, S. 403.<br />
33 Teubner, Organisationsdemokratie, S. 25.<br />
34 Palandt/Ellenberger, BGB, § 25 Rn. 3.<br />
35 RGZ 165, 140 (143).<br />
36 BGHZ 47, 172 (179).<br />
37 Janßen, Rechtsschutz, 15.<br />
38 BGHZ 47, 172 (179).<br />
39 RGZ 165, 140 (143); BGHZ 21, 370 (373); zustimmend Meyer-Cording, Anm. z. BGH, Urt. v. 4.10.1956, JZ<br />
1957, S. 124.<br />
40 BGHZ 47, 172 (179).<br />
41 Janßen, Rechtsschutz, 15.<br />
42 Janßen, Rechtsschutz, 12.<br />
43 So ist seit BGHZ 87, 337 (344) eine umfassende Kontrolle der einer Verbandsentscheidung zugrundeliegenden<br />
Tatsachen möglich und nach BGHZ 105, 316 (318), BGH JZ 1995, 461 (463) eine Inhaltskontrolle der Verbands-<br />
6 | S eite