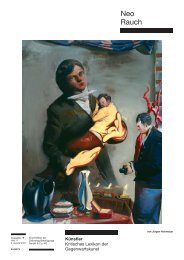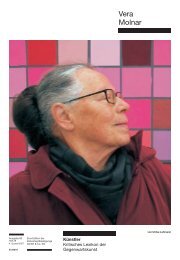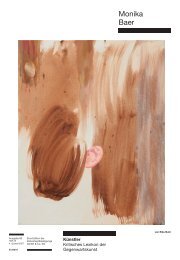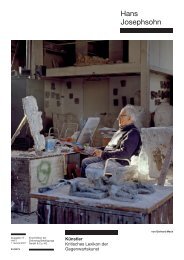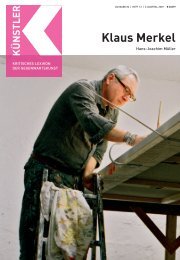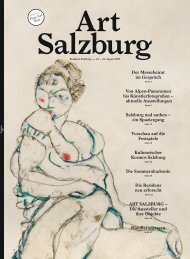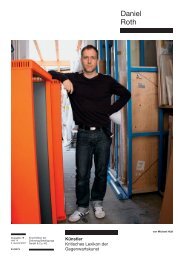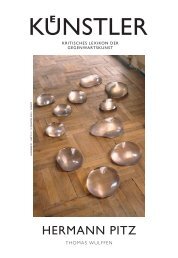Peter Bömmels - Weltkunst
Peter Bömmels - Weltkunst
Peter Bömmels - Weltkunst
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Man darf dieses Werk sicher als ein Schlüsselbild<br />
bezeichnen. Das Thema zieht sich durch das ganze Werk,<br />
in den vielen Zeichnungen in den schwarzen Heftchen,<br />
die <strong>Bömmels</strong> immer zur Hand hat und die inzwischen<br />
fast eine Anthologie seiner grazilen und zarten Blütenlese<br />
ausmachen. Als Autodidakt wagte sich <strong>Peter</strong> <strong>Bömmels</strong><br />
auf immer anderes unbekanntes Terrain – Dachpappe,<br />
Holzfurnier, Stein, Holz und zarte Materialien wie<br />
Haare, auch Glas waren Grund und Anlass genug, alle<br />
Zweifel und Gedanken in eine immer neue Formensprache<br />
umzusetzen.<br />
Steinerne<br />
„1987 experimentierte ich mit Stein,“ erinnert sich der<br />
Künstler, „das hatte ich nicht gelernt.“ Aber er klopfte so<br />
lange auf Sandsteinblöcken herum, bis er ihnen respektable<br />
archaisch anmutende Bildergeschichten abtrotzen<br />
konnte, etwa Der Schnitt (Abschiede sind Schlaraffenländer),<br />
1988/89 (Abb. 7). „Bei dieser Arbeit mit dem Stein,“<br />
sagt <strong>Bömmels</strong>, „habe ich gelernt, was Geduld ist. Das<br />
habe ich nie vergessen.“ Der Kölner Galerist Paul Maenz<br />
verfolgte sehr genau, was die einzelnen Mitglieder der<br />
Mülheimer Freiheit trieben. 1987 überließ er <strong>Peter</strong> <strong>Bömmels</strong><br />
seine exklusiven Räume für eine von mehreren Einzelausstellungen.<br />
„Sieben Steine zur Lage“ war der Titel<br />
und <strong>Bömmels</strong> wuchtete seine behauenen Sandsteine in<br />
das feine Galeriehaus und baute daraus eine neun Meter<br />
lange und ein Meter zwanzig Zentimeter hohe Mauer. Der<br />
Boden der Galerie ertrug erstaunlicherweise das tonnenschwere<br />
Werk und der Sammler <strong>Peter</strong> Ludwig kaufte es<br />
sofort. <strong>Bömmels</strong>: „Er interessierte sich damals besonders<br />
für präkolumbische Kunst und entdeckte, wie er mir<br />
sagte, in meinen Darstellungen eine aztekische Anmutung.“<br />
Die Steineklopferei hatte in diesem Maßstab bald ein<br />
Ende, auch weil der feingliedrige Körper von <strong>Bömmels</strong><br />
dem auf Dauer nicht gewachsen war. Aber es gab ja<br />
auch andere Formate und Materialien zu erkunden. So<br />
entstand 1993 die fast einen halben Meter hohe Fichtenskulptur<br />
mit dem Titel Der Künstler (Abb. 15). Der Kopf ist<br />
von einem Band umschlungen, das sich wie eine Spirale<br />
von der Stirn bis zum Hals herab ringelt. Die Augenhöhlen<br />
sind leer. Als Stellvertreter für den Blick nach<br />
außen ruhen Kugeln auf der Ummantelung der Skulptur.<br />
„Der Künstler, kann man deshalb sagen,“ schreibt der<br />
8<br />
Medientheoretiker Gregor Schwering anlässlich der Ausstellung<br />
„Gratkür-Bilder“ im Herbst 2006 in der Kirche<br />
St. Agnes in Köln, „sieht nichts. Allerdings ist er trotzdem<br />
nicht blind ... er gibt sich als ‚Künstler’ zu erkennen, der<br />
seinen Blick dem Anderen zuweist. Zuerst sehe ich mit<br />
den Augen des Anderen, mein Blick ist das Resultat der<br />
Welt, aus der er aufsteigt und in der er sich bewegt. Das<br />
genau impliziert das Wort Bereitschaft, mit dem <strong>Bömmels</strong><br />
sein Verfahren der Wahrnehmung bezeichnet. Es<br />
ist die Bereitschaft, vor allem aufzunehmen, die Bereitschaft,<br />
das Gegenüber zur Entfaltung kommen zu lassen,<br />
ihm Raum zuzugestehen, das Ich zurückzunehmen.“ 8<br />
Wenn man in die schönen, lakonisch-klugen Augen von<br />
<strong>Peter</strong> <strong>Bömmels</strong> schaut, kann man diese Interpretation<br />
durchaus nachvollziehen. Im Werk des Künstlers gibt es<br />
allerdings keinen offenen Blick auf den Betrachter. Die<br />
Augen seiner Protagonisten sind meistens abgewandt,<br />
geschlossen oder in sich hinein gekehrt oder aber auf<br />
ein unsichtbares Ziel gerichtet. Aber so ist es ja auch<br />
gemeint: beim Betrachten der bedächtig und langsam<br />
entstehenden Bilder liegt der Ball letztlich immer im<br />
Feld des Betrachters. Die Bilder, die <strong>Bömmels</strong> für die<br />
komplexe Befindlichkeit, auch für die Fremdheit der<br />
Geschlechter fand, hat der frühere Rhetorik-Professor<br />
Bazon Brock in einem ausführlichen Essay bereits 1983<br />
gewürdigt. Jenseits des Spaß- und Randalefaktors der<br />
Truppe der Mülheimer Freiheit dechiffrierte Bazon Brock<br />
für „Ikonographie – am Beispiel einiger Arbeiten von<br />
<strong>Peter</strong> <strong>Bömmels</strong>“ 9 die Zeichen und Symbole in der zeitgenössischen<br />
Kunst, das Spezifikum im Werk von <strong>Bömmels</strong>.<br />
Neben Hubert Winkels war es wieder ein Mann,<br />
der eher über den Intellekt, die Sprache und deren Klang<br />
sieht und hört, dem das Werk <strong>Bömmels</strong>‘ so interessant<br />
schien. Bazon Brock setzte sich darin ausführlich mit<br />
der Frage auseinander, ob ein Bild mehr beschreibe als<br />
eine Bildbeschreibung. Er kommt zu dem Schluss: „Die<br />
Bildbeschreibung ist ihrerseits nur möglich, soweit der<br />
Beschreibende bereits zu Thematisierungen fähig ist.<br />
Denn: Nicht die Augen sehen, sondern das Gehirn. Was<br />
beschreibt das Bild mehr als unsere Beschreibung des<br />
Bildes?<br />
Sehende<br />
Antwort: Das Bild, natürlich der Maler, beschreibt<br />
den Anlass zur Ausbildung vieler anderer Thematisie-