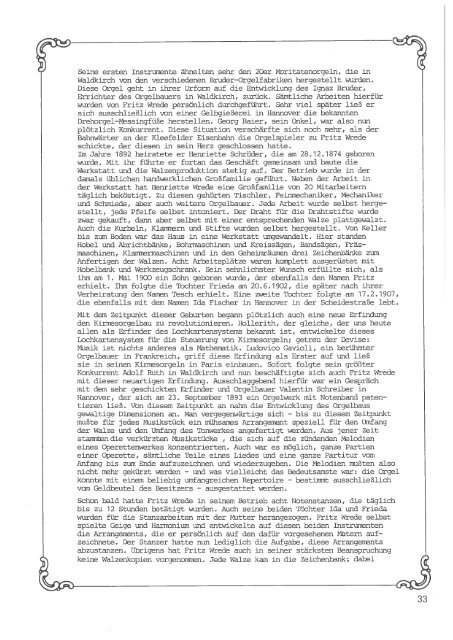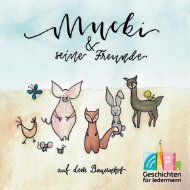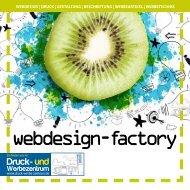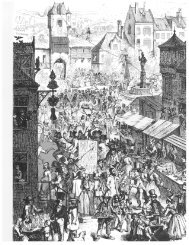Fritz Wrede und der Drehorgelbau in Hannover
Fritz Wrede und der Drehorgelbau in Hannover von Peter G. Schuhknecht
Fritz Wrede und der Drehorgelbau in Hannover von Peter G. Schuhknecht
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Se<strong>in</strong>e ersten Instrurrente ähnelten sehr den 2Der Maritatenorgeln, die <strong>in</strong><br />
Waldkirch von den verschiedenen Bru<strong>der</strong>-Orgelfabriken hergestellt wurden.<br />
Diese Orgel geht <strong>in</strong> ihrer Urform auf die Entwicklung des Ignaz Bru<strong>der</strong>,<br />
Errichter des Orgelbauers <strong>in</strong> Waldkirch, zuri:ick. Sämtliche rbeiten hierfür<br />
wurden von <strong>Fritz</strong> <strong>Wrede</strong> persönlich durchgeführt. Sehr viel später ließ er<br />
sich ausschließlich von e<strong>in</strong>er Gelbgießerei <strong>in</strong> <strong>Hannover</strong> die bekannten<br />
Drehorgel-Mass<strong>in</strong>gfüße herstellen. Georg Baier, se<strong>in</strong> Onkel, war also nun<br />
plötzlich Konkurrent. Diese Situation verschärfte sich noch mehr, als <strong>der</strong><br />
Bahnwärter an <strong>der</strong> Kleefel<strong>der</strong> Eisenbahn die Orgelspieler zu <strong>Fritz</strong> <strong>Wrede</strong><br />
schickte, <strong>der</strong> diesen <strong>in</strong> se<strong>in</strong> Herz geschlossen hatte.<br />
Im Jahre 1892 heiratete er Heririette Schrö<strong>der</strong>, die am 28.12.1874 geboren<br />
wurde. Mit ihr fühxte er fortan das Geschäft geme<strong>in</strong>sam <strong>und</strong> baute die<br />
Werkstatt <strong>und</strong> die Walzenproduktion stetig auf. Der Betrieb wurde <strong>in</strong> <strong>der</strong><br />
damals üblichen handwerklichen Großfamilie geführt. Neben <strong>der</strong> Arbeit <strong>in</strong><br />
<strong>der</strong> Werkstatt hat Henriette <strong>Wrede</strong> e<strong>in</strong>e Großfamilie von 20 Mitarbeitern<br />
täglich beköstigt. Zu diesen gehörten Tischler, Fe<strong>in</strong>mechaniker, Machaniker<br />
<strong>und</strong> Schmiede, aber auch weitere Orgelbauer. Jede Arbeit wurde selbst herge<br />
stellt, jede Pfeife selbst <strong>in</strong>toniert. Der Draht für die Drahtstifte wurde<br />
zwar gekauft, dann aber selbst mit e<strong>in</strong>er entsprechenden Walze plattgewalzt.<br />
Auch die Kurbeln, Klarrirern <strong>und</strong> Stifte wurden selbst hergestellt. Von Keller<br />
bis zum Boden war das Haus <strong>in</strong> e<strong>in</strong>e Werkstatt umgewandelt. Hier standen<br />
Hobel <strong>und</strong> Abrichtbänke, Bohrmasch<strong>in</strong>en <strong>und</strong> Kreissägen, Bandsägen, Fräs<br />
masch<strong>in</strong>en, Klannermasch<strong>in</strong>en <strong>und</strong> <strong>in</strong> den Geheimräunen drei Zeichenbänke zum<br />
Anfertigen <strong>der</strong> Walzen. Acht Arbeitsplätze waren konplett ausgerüstet mit<br />
Hobelbank <strong>und</strong> Werkzeugschrank. Se<strong>in</strong> sehnlichster Wunsch erfüllte sich, als<br />
ihm am 1. Mai 1 9CXJ e<strong>in</strong> Sohn geboren wurde, <strong>der</strong> ebenfalls den Narren <strong>Fritz</strong><br />
erhielt. Ihm folgte die Tochter Frieda am 20.6.1902, die später nach ihrer<br />
Verheiratung den Namen Tesch erhielt. E<strong>in</strong>e zweite Tochter folgte am 17.2.1907,<br />
die ebenfalls mit dem Narren Ida Fischer <strong>in</strong> <strong>Hannover</strong> <strong>in</strong> <strong>der</strong> Scheidestraße lebt.<br />
Mit dem Zeitpunkt dieser Geburten begann plötzlich auch e<strong>in</strong>e neue Erf<strong>in</strong>dung<br />
den Kirmesorgelbau zu revolutionieren. Hollerith, <strong>der</strong> gleiche, <strong>der</strong> uns heute<br />
allen als Erf<strong>in</strong><strong>der</strong> des Lochkartensystems bekannt ist, entwickelte dieses<br />
Lochkartensystem für die Steuerung von Kirrresorgeln; getreu <strong>der</strong> Devise:<br />
Musik ist nichts an<strong>der</strong>es als Mathematik. Ludovico Gavioli, e<strong>in</strong> berühmter<br />
Orgelbauer <strong>in</strong> Frankreich, griff diese Erf<strong>in</strong>dung als Erster auf <strong>und</strong> ließ<br />
sie <strong>in</strong> se<strong>in</strong>en Kiriresorgeln <strong>in</strong> Paris e<strong>in</strong>bauen. Sofort folgte se<strong>in</strong> größter<br />
Konkurrent Adolf Ruth <strong>in</strong> Waldkirch <strong>und</strong> nun beschäftigte sich auch <strong>Fritz</strong> <strong>Wrede</strong><br />
mit dieser neuartigen Erf<strong>in</strong>dung. Ausschlaggebend hierfür war e<strong>in</strong> Gespräch<br />
mit dem sehr geschickten Erf<strong>in</strong><strong>der</strong> <strong>und</strong> Orgelbauer Valent<strong>in</strong> Schreiber <strong>in</strong><br />
<strong>Hannover</strong>, <strong>der</strong> sich am 23. Septei±er 1893 e<strong>in</strong> Orgeiwerk mit Notenband paten<br />
tieren ließ. Von diesem Zeitpunkt an nahm die Entwicklung des Orgelbaus<br />
gewaltige Dimensionen an. Man vergegenwärtige sich - bis zu diesem Zeitpunkt<br />
mußte für jedes Musikstück e<strong>in</strong> mühsames Arrangement speziell für den Umfang<br />
<strong>der</strong> Walze <strong>und</strong> den Umfang des Tonwerkes angefertigt werden. Aus jener Zeit<br />
starrmtmn die verkürzten Musikstücke ‚ die sich auf die zündenden Malodien<br />
e<strong>in</strong>es Operettenwerkes konzentrierten. Auch war es möglich, ganze Partien<br />
e<strong>in</strong>er Operette, sämtliche Teile e<strong>in</strong>es Liedes <strong>und</strong> e<strong>in</strong>e ganze Partitur vom<br />
Anfang bis zum Ende aufzuzeichnen <strong>und</strong> wie<strong>der</strong>zugeben. Die Malodien mußten also<br />
nicht mehi gekürzt werden - <strong>und</strong> was vielleicht das Bedeutsamste war: die Orgel<br />
konnte mit e<strong>in</strong>em beliebig umfangreichen Repertoire — bestirruTrt ausschließlich<br />
var Geldbeutel des Besitzers — ausgestattet werden.<br />
Schon bald hatte <strong>Fritz</strong> <strong>Wrede</strong> <strong>in</strong> se<strong>in</strong>em Betrieb acht Notenstanzen, die täglich<br />
bis zu 12 St<strong>und</strong>en betätigt wurden. Auch se<strong>in</strong>e beiden Töchter Ida <strong>und</strong> Frieda<br />
wurden für die Stanzarbeiten mit <strong>der</strong> Mutter herangezogen. <strong>Fritz</strong> <strong>Wrede</strong> selbst<br />
spielte Geige <strong>und</strong> Harnonium <strong>und</strong> entwickelte auf diesen beiden Instrumenten<br />
die Arrangements, die er persönlich auf den dafür vorgesehenen Mutern auf—<br />
zeichnete. Der Stanzer hatte nun lediglich die Aufgabe, diese Arrangements<br />
abzustanzen. übrigens hat <strong>Fritz</strong> <strong>Wrede</strong> auch <strong>in</strong> se<strong>in</strong>er stärksten Beanspruchung<br />
ke<strong>in</strong>e Walzenkopien vorgenomrren. Jede Walze kam <strong>in</strong> die Zeichenbank; dabei<br />
33