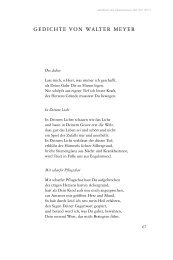139-173_Orpund - DigiBern
139-173_Orpund - DigiBern
139-173_Orpund - DigiBern
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
148 ORPUND/GOTTSTATT<br />
her). 58 Möglicherweise waren Fertigstellung und<br />
Ausstattung der Kirche in vielem noch behelfsmässig.<br />
1295 und bei nachfolgenden Nachrichten ist offen,<br />
ob Kirchen- oder Konventsbauten unterstützt<br />
werden sollten. 1314/15 59 lösen «bereits begonnene,<br />
umfangreiche Bauten» Ablassprivilegien aus. 1326/<br />
1333 steht der Steinmetz AYMO, Burger von Büren<br />
a.A., mit dem Kloster in Verbindung, 1333 treten<br />
Zimmermann SIMON, Steinmetz KONRAD sowie<br />
Meister BURKHARD, der Werkmeister von Bern, als<br />
Zeugen auf, 1343 wurden zwei Steinhauer aus Altreu<br />
SO, BURKHARD und JOHANNES, als Pfründer aufgenommen.<br />
60 Man kann daraus schliessen, dass immer<br />
noch oder wieder gebaut wurde; waren die Erwähnten<br />
teils Laienbrüder? Die Weihe der Kirche<br />
mit drei (nicht benannten) Altären erfolgte 1345. 61<br />
Ein Augustinusaltar kommt <strong>139</strong>8 vor. 62<br />
Der Ostflügel hatte jedenfalls im Norden einen<br />
Vorgängerbau. 63<br />
Isolierte Information: Der Keller des Kloster-Südostrisalits<br />
ergab dendrochronologische Daten um<br />
1370/1380. Gleicher Zeitraum: Im Nekrolog von<br />
Humilimont FR 64 erscheint die Jahrzeit des Gottstatter<br />
Abts «Johannes von Solothurn, der das Kloster<br />
dieses Ortes gebaut hat», aller Wahrscheinlichkeit<br />
nach Johannes Schoebinhut 1354–1381; «claustrum»<br />
bedeutet Kloster-Wohngebäude gesamthaft oder<br />
einzeln. 65 Ausmass und Lokalisierung der Zerstörungen<br />
und Beschädigungen im Guglerkrieg 1375<br />
(S. 145) sind nicht zu fassen; sie wurden anscheinend<br />
bis gegen 1385 behoben; eigentliche Brandschatzungen<br />
sind archäologisch bis jetzt nicht festgestellt.<br />
Nebengebäude befanden sich vielleicht<br />
wie späterhin westlich des Klostergevierts, und es<br />
wäre denkbar, dass vor allem auch diese betroffen<br />
waren. AESCHBACHERS Annahme ist unbelegbar, dass<br />
die Kirche besonders zu Schaden kam, eventuell<br />
sogar die Nidauer Grabstätten bereits damals verschwanden.<br />
Auch spätgotische Bautätigkeit verteilte sich über<br />
mehrere Jahrzehnte. Die Hölzer für das Südostrisalit-Helmdach<br />
wurden im Herbst/Winter 1452/53 gefällt.<br />
Fliesen mit dem Abtwappen Krebs 1486 fanden<br />
sich an diversen Stellen, namentlich auch im Kreuzgang,<br />
dessen nachträgliche Einwölbung (EGGEN-<br />
BERGER) in diesen Zeitraum fallen könnte. 1490 66<br />
stiftete Solothurn ein Glasgemälde von HANS NOLL<br />
«in das closter». 1505 67 beabsichtigte die Abtei, «im<br />
büttenberg an der halden» einen Steinbruch zu «suchen».<br />
Das Westportal der Kirche dürfte dem vorgerückten<br />
15. Jh. angehören, die Neugestaltung des<br />
Kapitelsaals folgte wohl in den 1510er Jahren.<br />
Die so genannte Klosterreformation 1533/34 bedeutete<br />
die Liquidation der nicht als Predigtorte benutzten<br />
Klosterkirchen und gleichzeitig der noch<br />
verbliebenen unnötigen Kapellen sowie der Beinhäuser;<br />
der Seckelmeister sollte «mitt dem werchmeyster<br />
In die clöster rytten vnd anschlachen was<br />
man nitt bedarf schlissen etc.». 68 Dadurch wurde<br />
zweifelsohne auch die Aufhebung der Büttenbergkirche<br />
ausgelöst. Im Gegensatz zu weitaus den meisten<br />
anderen säkularisierten Häusern blieb in Gottstatt<br />
dank der Nutzungskombination Schaffnerei,<br />
Kornwirtschaft, Pfarrpfrund, Kirche das ganze Klostergeviert<br />
bestehen, samt Kreuzgang. Hingegen erfuhr<br />
die auf das ehemalige Laienhaus verkürzte Kirche<br />
einschneidende Änderungen: sie verlor Querhaus<br />
und Chor, erhielt teilweise eine neue Befensterung<br />
und später einen Westturm. Dass zwischen<br />
jenen Abbrüchen und den Terrainaufschüttungen im<br />
Norden und Nordosten ein Zusammenhang bestanden<br />
hätte, ist Spekulation; Letztere können durchaus<br />
andere Gründe gehabt haben. Ob 1535/1537 69 «der<br />
buw» für über 1300 Pfund weitgehend Ufersicherung<br />
betraf («landtveste»), ist nicht auszumachen.<br />
Offen ist auch, ob der hofseitige Treppenturm in<br />
der Mitte des Südflügels (Abb. 183) auf einen spätgotischen<br />
Umbau oder ins nachreformatorische 16. Jh.<br />
zurückging; grössere «Reparationen» am «Schnegg»<br />
1617/18 70 deuten darauf hin, dass er bereits längere<br />
Zeit existierte. Um 1614/1620 erfolgten mehrere Neuund<br />
Umbauten; unter DANIEL HEINTZ II wurden im<br />
«Hof-Nordflügel» das Waschhaus und für die Spendenausteilung<br />
«an einem kumlichen Ort» die Pfisterei<br />
(Pfisterstube, Backofen) neu eingerichtet. Das<br />
Waschhaus wurde <strong>173</strong>0/31 wohl nachträglich eingewölbt.<br />
Annexe im Hof, dann auch aussen sind seit<br />
den 1700er Jahren belegt.<br />
Über den Südflügel, das «Schloss», urteilte NI-<br />
KLAUS SCHILTKNECHT 1728: 71 «dieses gebäüw wirt<br />
über zehen Jahre kaum mehr Halten mögen.» Nebst<br />
der Empfehlung, auf dem Estrich kein Korn mehr zu<br />
lagern, sah der erste Devis provisorische Massnahmen<br />
vor: Der «face gegen garten, von schlechter<br />
Construction, auch gantz krumm», sollte eine An-