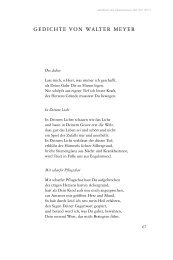139-173_Orpund - DigiBern
139-173_Orpund - DigiBern
139-173_Orpund - DigiBern
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
146 ORPUND/GOTTSTATT<br />
184 –187<br />
<strong>Orpund</strong>. Gottstatt. Siegelbeispiele (alle StAB): links ein Abtssiegel von 1306 (Vorder- und Rückseite); rechts wie häufig<br />
gebräuchlich Konvents- und Abtssiegel nebeneinander, 1370.<br />
WAPPEN, SIEGEL<br />
Abtei- und Landvogteiwappen war der Nidauerschild<br />
(S. 23). 42 – Siegel. 43 Gegen 50 Belege, meist StAB. Konvents-<br />
und Abtssiegel nebeneinander bereits 1279 (FRB III<br />
Nr. 287). Konventssiegel (14./15. Jh.): sitzende Madonna.<br />
Abtsstempel, in der Regel ohne Name («S. ABBATIS ECCLE-<br />
SIE LOCI DEI»), wiederholt ausgewechselt; Bild: stehender<br />
Abt mit dem Stab, seit etwa 1370 auf Damast-Hintergrund.<br />
Vereinzelt ist ein kleines rückseitiges Siegel erhalten<br />
(Kontrasigill, 1306). – Schaffner, Landvögte: die jeweiligen<br />
Privatsiegel.<br />
FUNKTIONEN<br />
Die Begräbniskirche der drei Rudolfe (Standort und<br />
Form der Grablege sind völlig offen) diente auch Bestattungen<br />
von Ministerialen und Stadtbürgern; Jahrzeiten<br />
waren anscheinend zahlreich, Rudolf IV. testierte eine tägliche<br />
Seelenmesse. 44 1300 wird ein Schüler erwähnt. 45<br />
Nach der Reformation wurde das Laienhaus zur Predigtkirche.<br />
Almosnerei und Spendausteilung, insbesondere von<br />
Brotmütschen aus der Pfisterei im Nordflügel, wurden<br />
von den Schaffnern und Landvögten fortgeführt (1806:<br />
«das Schloss mit beiden Flügeln und Bekerey» im Norden<br />
des Hofes). 46 Sie betrieben eine umfangreiche Mattland-,<br />
Heu-, Kornzehnt- und Naturalzinswirtschaft, im 18. Jh.<br />
auch eine Küherei. Ihnen verblieb das Stubenrecht des<br />
Klosters; die Pinte47 befand sich im 17. Jh. sehr wahrscheinlich<br />
über der Kirchenvorhalle, ab 1780 bis zur Aufhebung<br />
1809 im nördlichen Westflügel.<br />
Anfänglich im Pfarrhaus, ab 1801 mietweise im «Schloss»<br />
führten der landesökonomisch interessierte Pfarrer Gottlieb<br />
Samuel Zehender (1756–1840) und sein Sohn Friedrich<br />
Emanuel (1791–1870), hervorragender Obstbaumzüchter,<br />
bis 1833 ein angesehenes Erziehungsinstitut, das<br />
Berner, Waadtländer, Neuenburger Patriziersöhnen und<br />
auch Ausländern eine Alternative zum liberalen Hofwil<br />
bot. 48 Hier war der später berühmte Physiker Georg Simon<br />
Ohm von 1806 bis 1811 Lehrer.<br />
Weniger weiss man über die Heiminstitution des Arztes<br />
François Louis Bovet ab 1855 und die burgerlichen Anstalten<br />
der Stadt Biel von 1873 bis in die 1910er Jahre, 49 im<br />
Kloster das Pfründerhaus, im «neuen» Kornhaus das Waisenhaus;<br />
Letzteres löste die Armenerziehungsanstalt im<br />
Berghaus bei Leubringen ab, die auf das Legat von Schultheiss<br />
Charles Neuhaus zurückging. Nach 1920 kam es zu<br />
aufgeteilten Wohnnutzungen, im Erdgeschoss des Westflügels<br />
auch zu landwirtschaftlichen Schlachthauseinrichtungen.<br />
Der Ostflügel dient seit 1972 als Kirchgemeindehaus.<br />
KLOSTER- UND SCHLOSSDOMÄNEN 50<br />
Streubesitz und recht umfangreiche Zehntrechte verteilten<br />
sich im Raum der Zihl, sonst im unteren Seeland<br />
und in der solothurnischen Nachbarschaft. Dazu gehörten<br />
Mühlen in Brüttelen (1256), Safnern (1295, nebst dem<br />
späteren Hof), Gottstatt und Brügg (1333, nebst Stampfen),<br />
Mett (1351), Hauseigentum in Biel, Vingelz, Alfermee,<br />
Nidau, Sutz, Büren a.A., Kappelen, Bern. Reben, begünstigt<br />
durch den kurzen Wasserweg, lagen in Alfermee,<br />
Tüscherz, Vingelz (bis 1801), Biel, im 14. Jh. auch in<br />
Neuenstadt. 1450 wurden Güter in Klosternähe arrondiert,<br />
wohl das späterhin erwähnte Mattland von sechs Mähdern<br />
auf der Ostseite. Äbte und Landvögte wussten ihre<br />
Fischenzen in der Zihl samt der Insel gegen die Dorfleute<br />
zu verteidigen. Dem Vogt verblieben ausser den Nebengebäuden<br />
im Westen auch die Scheune in Scheuren und<br />
der Hof in Safnern. Auch nach den Umwälzungen blieben<br />
Konvent und mehrere Nebengebäude in ein und derselben<br />
Hand bis 1919; das Kornhaus veräusserte der Staat<br />
erst 1872/73.