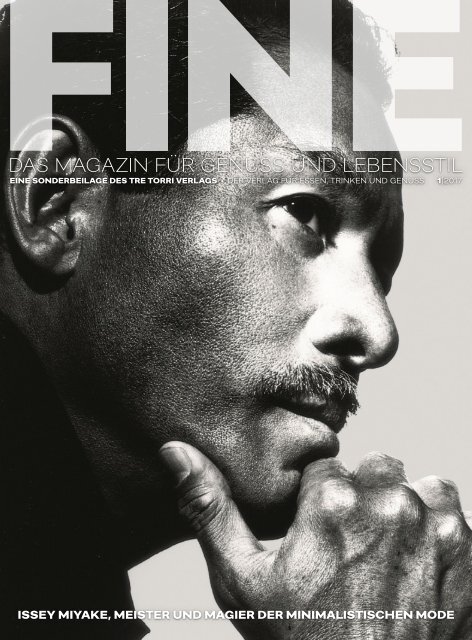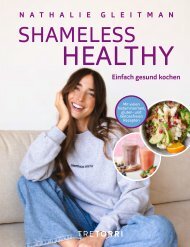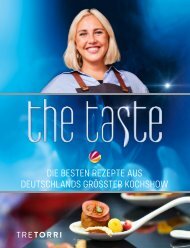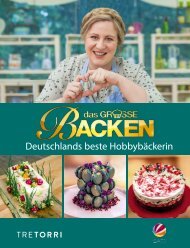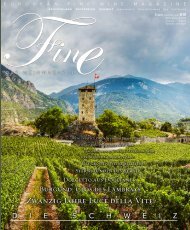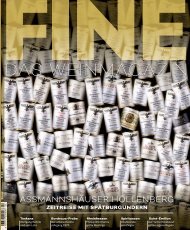FINE DAS MAGAZIN FÜR GENUSS UND LEBENSSTIL
FINE DAS MAGAZIN FÜR GENUSS UND LEBENSSTIL - 1|2017 - Sonderbeilage in der Süddeutschen Zeitung
FINE DAS MAGAZIN FÜR GENUSS UND LEBENSSTIL - 1|2017 - Sonderbeilage in der Süddeutschen Zeitung
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
<strong>DAS</strong> <strong>MAGAZIN</strong> <strong>FÜR</strong> <strong>GENUSS</strong> <strong>UND</strong> <strong>LEBENSSTIL</strong><br />
EINE SONDERBEILAGE DES TRE TORRI VERLAGS · DER VERLAG <strong>FÜR</strong> ESSEN, TRINKEN <strong>UND</strong> <strong>GENUSS</strong> 1 |2017<br />
ISSEY MIYAKE, MEISTER <strong>UND</strong> MAGIER DER MINIMALISTISCHEN MODE
VERLEGER <strong>UND</strong> HERAUSGEBER<br />
Ralf Frenzel<br />
ralf.frenzel@fine-magazines.de<br />
CHEFREDAKTEUR<br />
Thomas Schröder<br />
thomas.schroeder@fine-magazines.de<br />
REDAKTION<br />
Katja Richter<br />
ART DIRECTION<br />
Guido Bittner<br />
MITARBEITER DIESER AUSGABE<br />
Ellen Alpsten, Ralf Bastian, Hannah<br />
Conradt, Uwe Kauss, Krisztina Koenen,<br />
Stefan Pegatzky, Stuart Pigott, Angelika<br />
Ricard-Wolf<br />
FOTOGRAFEN<br />
Guido Bittner, Rui Camilo, Johannes Grau,<br />
Marco Grundt, Christof Herdt<br />
TITEL-FOTO<br />
Issey Miyake – Beaute Prestige<br />
International<br />
VERLAG<br />
Tre Torri Verlag GmbH<br />
Sonnenberger Straße 43<br />
65191 Wiesbaden<br />
www.tretorri.de<br />
Geschäftsführer: Ralf Frenzel<br />
Wilhelm Weil, Hans-Joachim Vauk, Klaus Westrick<br />
zum Beispiel: Was mögen die drei wohl gemeinsam<br />
haben, was könnte sie verbinden? Eines gewiß:<br />
Alle drei sind Meister ihres Fachs – der Winzer, der Schuhmacher,<br />
der Media-Geschäftsmann. Sie alle haben sich mit<br />
dem normal Erwartbaren nicht zufrieden gegeben, haben das<br />
Besondere ihrer Profession gesucht und so ein Maß gesetzt,<br />
an dem andere gemessen werden. Und wie die genialen Modedesigner<br />
Issey Miyake, Narciso Rodriguez, Wolfgang Joop oder<br />
das Pariser Duo Zadig & Voltaire (eigentlich Cecilia Bönström<br />
und Thierry Gillier) samt ihrer Parfüm-Kreateure schöpfen sie<br />
nicht nur selbst aus dem vollen Vorrat ihrer Inspiration; ihre<br />
Produkte, ihre Handlungen und Haltungen inspirieren stets<br />
auch andere. Dieses Heft zeigt Menschen, deren Kreativi tät sie<br />
immer wieder zu Schaffens- und Erfindungslust bewegt. Ein<br />
stumpfer Geist erdenkt eben kein geschliffenes Produkt.<br />
ANZEIGEN<br />
Judith Völkel<br />
Tre Torri Verlag GmbH<br />
+49 611-57 990<br />
anzeigen@fine-magazines.de<br />
DRUCK<br />
Prinovis Ltd. & Co. KG · Nürnberg<br />
<strong>FINE</strong> Das Magazin für Genuss und Lebensstil<br />
ist eine Sonder beilage des Tre Torri Verlags<br />
und erscheint im Verbund mit <strong>FINE</strong><br />
Das Wein magazin viermal Jährlich im ausgesuchten<br />
Zeitschriftenhandel.<br />
Namentlich gekennzeichnete Beiträge geben<br />
nicht unbedingt die Meinung der Redaktion<br />
wieder. Der Verlag haftet nicht für unverlangt<br />
eingereichte Manuskripte, Dateien, Datenträger<br />
und Bilder. Alle in diesem Magazin veröffentlichten<br />
Artikel sind urheberrechtlich geschützt.<br />
6<br />
10<br />
14<br />
18<br />
22<br />
26<br />
28<br />
30<br />
32<br />
38<br />
40<br />
44<br />
INHALT<br />
WEINE <strong>FÜR</strong> JUNGE WELTBÜRGER<br />
Jetzt macht er auch Wein in Rheinhessen: Der Rheingauer Winzer Wilhelm Weil geht neue Wege<br />
SUBTILER VERFÜHRER: NARCISO RODRIGUEZ<br />
Der amerikanische Designer liebt die Nuancen: in der Mode wie bei den Düften<br />
»MEINE WÄHRUNG SIND DIE MEDIEN«<br />
Klaus Westrick, Chef der XLS Media Group, beweist, dass in der modernen Wirtschaft Tauschhandel funktioniert<br />
EIN ATHLET DES PURISMUS<br />
Der japanische Modeschöpfer Issey Miyake ist ein Meister der Reduktion<br />
MEMBERS ONLY<br />
67, Pall Mall – der exklusive Club für Weinliebhaber in London<br />
ROCK ME BABY!<br />
Wie das Label Zadig & Voltaire die Duft- und Fashionszene aufmischt<br />
KARATE-KOSMETIK<br />
Zwei Tänzerinnen boxen ein neues Schönheitsserum von Shiseido in den Markt<br />
VERTEUFELUNG DER REINHEIT<br />
Stuart Pigott ist dagegen, Fehltöne im Wein als authentisch zu verkaufen<br />
<strong>DAS</strong> DEUTSCHE KÜCHENW<strong>UND</strong>ER<br />
Die Kulinarik im Nachkriegs-Deutschland erlebte ihren Aufschwung dank einer europäischen Agrarpolitik<br />
DIE WILDNIS IM BLICK<br />
Für seinen neuen Duft WOW! lässt Joop eine alte Ikone wieder aufleben: Tarzan<br />
SCHUHE <strong>FÜR</strong> EIN GANZES LEBEN<br />
Hans-Joachim Vauk fertigt seit dreißig Jahren feinste Maßschuhe für Kunden in der ganzen Welt<br />
ZURÜCK IN DIE ZUKUNFT<br />
Die trauen sich was: Veuve Clicquot präsentiert »Rich«-Champagner – süß und zum Mixen »on the rocks«<br />
<strong>DAS</strong> <strong>MAGAZIN</strong> <strong>FÜR</strong> <strong>GENUSS</strong> <strong>UND</strong> <strong>LEBENSSTIL</strong> <strong>FINE</strong> 1 | 2017 3
ENTDECKEN SIE IHREN<br />
NEUEN ONLINE SHOP<br />
MIT ÜBER 5 MILLIONEN<br />
ARTIKELN AUF REAL.DE<br />
WEBER MASTER TOUCH GBS<br />
Kugelgrill mit ca. 57 cm Durchmesser,<br />
Deckelthermometer, große Öffnung zum<br />
Nachlegen von Briketts,<br />
Porzellanemaillierter Deckel und Kessel,<br />
großer Hitzeschutz<br />
289,- *<br />
Online-Bestell-Nr.: 339977<br />
* zzgl. 4,95 Versandkosten<br />
Impressum real,- SB-Warenhaus GmbH, Metro-Straße1, 40235 Düsseldorf
Alles für<br />
den Garten<br />
<strong>FÜR</strong> EINE ENTSPANNTE <strong>UND</strong><br />
<strong>GENUSS</strong> VOLLE GARTENSAISON 2017.
6 <strong>FINE</strong> 1 | 2017 <strong>DAS</strong> <strong>MAGAZIN</strong> <strong>FÜR</strong> <strong>GENUSS</strong> <strong>UND</strong> <strong>LEBENSSTIL</strong>
WEINE <strong>FÜR</strong><br />
JUNGE<br />
WELTBÜRGER<br />
Rheinhessischer Wein – erzeugt von einem Rheingauer Winzer: Mit seinem<br />
Projekt »Robert Weil Junior« erregt der berühmte Kiedricher Weinmacher<br />
Wilhelm Weil Aufsehen. Und erfüllt sich zugleich einen Generationenwunsch.<br />
Von RALF BASTIAN<br />
Fotos RUI CAMILO<br />
Foto: Guido Bittner<br />
Als die Nachricht vor wenigen Wochen die Runde machte, zuckten<br />
einige zusammen und dachten: Was macht denn der Weil da? Dass<br />
das Weingut Robert Weil nun auch Wein auf der linken Seite des<br />
Rheins, in Rheinhessen, erzeugt, dürfte eine der größten Überraschungen<br />
dieses Weinjahrs sein. Bis jetzt war das unvorstellbar für<br />
die Familie Weil, es wäre fast einem Sakrileg gleichgekommen: Vier<br />
Generationen lang war sie ausschließlich in Kiedrich, auf der rechten<br />
Seite des Stroms, tätig. Robert Weil, das stand bislang für hundert<br />
Prozent Riesling und für hundert Prozent Rheingau in »Reinstkultur«,<br />
wie Wilhelm Weil, der Gutsdirektor des Weinguts, sagt.<br />
Viele sehen im Weingut Robert Weil sogar ein welt weites Symbol<br />
deutscher Riesling- Kultur. Wer kennt nicht das himmelblaue Etikett,<br />
das für die Faszination des Rieslings steht? Robert Weil – das war<br />
immer ein messerscharf gezogenes, präzis aus gerichtetes Konzept:<br />
Hundert Hektar Riesling, die »im Zirkelschlag« um das Weingut<br />
liegen, etwas anderes kam nicht in Frage. Diesen Weg hat Wilhelm<br />
Weil nun mit dem Jahrgang 2016 ver lassen und drei Burgunder- Weine<br />
von der »left bank«, vom linken Ufer des Rheins, vor gelegt. »Der<br />
Rheingau ist eine wunderbar blühende Wiese«, sagt der Winzer,<br />
»aber es gibt auch noch andere begehrenswerte Welten.«<br />
<strong>DAS</strong> <strong>MAGAZIN</strong> <strong>FÜR</strong> <strong>GENUSS</strong> <strong>UND</strong> <strong>LEBENSSTIL</strong> <strong>FINE</strong> 1 | 2017 7
SUBTILER<br />
Der amerikanische Designer Narciso Rodriguez versteht sich auf<br />
die Kunst der Nuancen. In seiner Mode wie in seinen Parfüms<br />
Von ANGELIKA RICARD-WOLF<br />
Fotos MARCO GR<strong>UND</strong>T<br />
10 <strong>FINE</strong> 1 | 2017 <strong>DAS</strong> <strong>MAGAZIN</strong> <strong>FÜR</strong> <strong>GENUSS</strong> <strong>UND</strong> <strong>LEBENSSTIL</strong>
VERFÜHRER<br />
»Sind Sie der mit den Düften?« fragte der italienische Beamte bei der Passkontrolle. »Ich<br />
bin der Mode macher«, antwortete Narciso Rodriguez. Klar, Parfüms macht er auch. Sehr<br />
erfolgreich sogar. Dass er dafür in einigen Ländern bekannter ist als wegen seiner hin reißend<br />
schönen Fashionlinie, nimmt er gelassen. Schließlich ist es in jedem Fall seine unverwechselbare<br />
Handschrift, die man mit seinem Namen verbindet – die zeitloser Eleganz.<br />
Kaum ein Designer versteht sich so auf die Kunst<br />
subti ler Verführung wie Rodriguez. Das gilt für seine<br />
Düfte wie für seine Mode. Nie würde er etwas entwerfen,<br />
was im übertragenen Sinn »laut« ist. Ein schrilles<br />
Nichts von Kleid etwa, das gerade mal für ein Paparazzi-<br />
Foto auf dem Roten Teppich taugt, aber dann nie wieder<br />
auftaucht, schon gar nicht in den Läden. Oder ein grelles<br />
Parfüm, das seine Trägerin (und ihre Umgebung) erschlägt.<br />
Derlei Effekthascherei liegt ihm nicht. »Ich möchte Dinge<br />
kreieren, die Bestand haben, die bleiben. Die man heute<br />
so gut wie morgen tragen kann, Dinge eben, die lebendig<br />
bleiben.«<br />
Wie gekonnt er die Klaviatur feiner Nuancen beherrscht,<br />
zeigt sich in seinen Mode-Kollektionen, bei denen stets Weiß,<br />
Schwarz und Nude den Ton angeben. Nur selten bricht er<br />
diesen Signatur-Farbcode – wie gerade in der aktuellen Frühjahrslinie.<br />
Darin wagt er sogar mal ein leuchtendes Orange<br />
für einige wenige, ausgesuchte Einzelteile. Grundsätzlich<br />
bestechen seine Outfits durch ihre exzellent geschnittene<br />
Linie, die den Körper fließend umspielt und sublim betont.<br />
Ex-First-Lady Michelle Obama und Film schauspielerinnen<br />
wie Jessica Alba oder Kate Winslet sind seit Jahren treue<br />
Kundinnen.<br />
Zu dieser Mode passt die DNA seiner Düfte. Sie wird<br />
von Musk orchestriert, eine der wichtigsten Basisnoten der<br />
Parfümerie. Schon seinem ersten Damenduft »For her«,<br />
der 2003 herauskam, gibt diese fein holzige Note mit ihrer<br />
fruchtigen Süße Substanz und sinnliche Wärme. »Moschus<br />
ist das Herz jedes meiner Düfte und mein Favorit«, sagt<br />
der Sechsundfünfzigjährige. Er nehme diese Note selbst<br />
gern, »weil sie unglaublich sexy und betörend ist. Ich mag<br />
es, immer mal eine oder mehrere andere Nuancen darüber<br />
zu tragen.«<br />
Seine Lieblingsduftzutat ist daher auch wieder in den<br />
beiden neuesten Parfüms der Marke zu finden. In »Narciso<br />
Eau de Parfum Poudrée« entwickelt sie gemeinsam mit<br />
Jasmin- und Rosenblüten und im Einklang mit Zedernholz<br />
eine zarte Pudrigkeit. Bei »Fleur Musc for her« spielt sie,<br />
wie der Name verspricht, sogar die Hauptrolle – begleitet<br />
vom Aroma rosafarbener Blüten, rosa Pfeffer, Patschuli<br />
und Amber. »Es ist ein Duft, der Charme und Anmut verströmt«<br />
beschreibt Narciso Rodriguez die jüngste Komposition,<br />
den die Parfümeurinnen Calice Becker und Sonia<br />
Constant mit ihm komponiert haben.<br />
Glaube ja nicht einer, die Duftkreation würde der<br />
56-Jährige, der in New York lebt und arbeitet,<br />
komplett anderen überlassen und nur das Endergebnis<br />
abnicken. Er ist aktiv in den Findungsprozess involviert.<br />
Schon aus Prinzip, weil er nach eigenem Bekunden<br />
»pingelig« ist und auch hier – wie im Modeatelier – auf<br />
jedes Detail achtet. Abgesehen davon, sind Parfüms längst<br />
ein Eckpfeiler seines internationalen Erfolgs.<br />
»Die Chance zu haben, Parfüms entwickeln zu können,<br />
spielt auf meinem Lebensweg eine wichtige Rolle«,<br />
sagt er. Denn nur kurz nachdem er sich 2001 mit seinem<br />
<strong>DAS</strong> <strong>MAGAZIN</strong> <strong>FÜR</strong> <strong>GENUSS</strong> <strong>UND</strong> <strong>LEBENSSTIL</strong> <strong>FINE</strong> 1 | 2017 11
Subtiler Verführer | Narciso Rodriguez<br />
eigenen Label selbständig gemacht hatte, kam schon die<br />
Parfümschmiede Beauté Prestige International, kurz BPI,<br />
mit dem Angebot auf ihn zu, für und mit ihm eine Duftlinie<br />
aufzubauen.<br />
Sinnlich, elegant, modern: Das<br />
Herz seiner Düfte ist Moschus, das<br />
Gesicht seines neuen Parfüms ist<br />
Raquel Zimmermann. Das brasilianische<br />
Topmodel verkörpert perfekt<br />
die charismatisch-verführerische<br />
Narcisco-Rodriguez-Frau.<br />
Für Rodriguez, der sein Handwerk an der renommierten<br />
Parsons School in New York gelernt und im Anschluss<br />
für Modemacher wie Nino Cerruti, Donna Karan<br />
und Calvin Klein gearbeitet hat, war das ein Glücksfall. So<br />
konnte er seine Stilvision parallel realisieren, dank gelungener<br />
Duftlancierungen zusätzlich Geld verdienen und seinen<br />
Bekanntheits grad durch den Bonus des Imagetransfers<br />
zwischen Duft und Mode sukzessive auszubauen – nicht<br />
nur für den Moment einer Passkontrolle auf dem Mailänder<br />
Flughafen.<br />
Es war nämlich nicht gerade einfach für ihn, sich zu<br />
jener Zeit als Neuling im Fashionbusiness zu etablieren.<br />
Doch der Sohn kubanischer Einwanderer, der in Newark/<br />
New Jersey zur Welt kam und aufgewachsen ist, vertraute<br />
auf die ihm eigene Beharrlichkeit. Schon als Junge wollte<br />
er »irgendetwas mit den Händen machen, gestalten. Ich<br />
merkte, dass ich ein Talent für Stoffe und Schnitte hatte.«<br />
Sein Berufsweg war damit praktisch vorgezeichnet, allen<br />
Unkenrufe der Familie zum Trotz.<br />
Sie hätte es wissen müssen. Selbstverwirklichung hat<br />
für einen im Sternzeichen des Wassermann Geborenen<br />
wie ihn nun mal oberste Priori tät. »Auch in schwierigsten<br />
Zeiten habe ich zielstrebig alles daran gesetzt, meine<br />
Arbeit voranzutreiben.«<br />
Das tut er heute noch. Jeden Morgen pilgert er von<br />
seinem Apartment in Chelsea, das er mit seinem Partner,<br />
dem Anzeigenleiter Thomas Tolan teilt, zu seinem Studio<br />
am Irving Place. Es liegt in der Nähe des Union Square<br />
mitten in Manhattan. Sein Vorteil beim Fußmarsch: kein<br />
Stau, kein Stress. Sondern Zeit für Müßig-Gang, zum Sehen,<br />
zum Wahrnehmen.<br />
Das macht ihn aus. Er ist ein Zugewandter, den Menschen,<br />
der Natur, den Sachen gegenüber. Dinge, die an<br />
anderen vorbeirauschen – Narciso Rodriguez realisiert<br />
sie. Im Kopf nimmt er sie mit. So manches kauft er im Vorbeigehen.<br />
Was kontinuierlich das kreative Chaos rund um<br />
seinen Schreibtisch vergrößert, auf dem neben Computer,<br />
Laptop, Telefon, gerahmten Fotos, Büchern und stylischen<br />
Musikboxen sogar noch eine Orchidee Platz hat.<br />
»Ich liebe es, Dinge zu sammeln«, sagt der Modemacher<br />
mit Blick auf die rundum angepinnten Fotos (die<br />
der leidenschaftliche Fotograf meist selbst gemacht hat) und<br />
Zeichnungen, auf die Bilder, die auf dem Fußboden stehen<br />
und gegen die Wand lehnen. Sein Faible für kleine Kunstgegenstände<br />
dokumentiert sich in zauberhaften Skulpturen,<br />
die sich vor und zwischen die unzähligen Bücher in<br />
die Regale geschmuggelt haben. Ein Lämmchen, ein Sparschwein<br />
lugen da hervor. Dazwischen liegen ein paar besonders<br />
schöne, von Reisen mitgebrachte Steine, faszinierend<br />
in ihrer Haptik und Farbe.<br />
Inspiration, wohin man schaut. Der Flusskiesel da, wo<br />
hat man dessen kaum wahrnehmbaren Roséton bloß schon<br />
mal gesehen? Ach ja, natürlich, als zarten Überfang auf dem<br />
Flakon von »Eau Poudrée.«<br />
12 <strong>FINE</strong> 1 | 2017 <strong>DAS</strong> <strong>MAGAZIN</strong> <strong>FÜR</strong> <strong>GENUSS</strong> <strong>UND</strong> <strong>LEBENSSTIL</strong>
Von Spezialisten angebaut, geerntet, exportiert und geröstet.
»MEINE<br />
WÄHRUNG<br />
SIND DIE<br />
MEDIEN«<br />
Auch in der modernen monetarisierten Wirtschaftswelt<br />
gibt es Möglichkeiten für Tauschgeschäfte, die<br />
ganz ohne die Vermittlung des Geldes auskommen.<br />
Wie diese Nischen gewinnbringend genutzt werden<br />
können, weiß Klaus Westrick, Gründer und Geschäftsführer<br />
der XLS Media Group.<br />
Von KRISZTINA KOENEN<br />
Fotos CHRISTOF HERDT<br />
Wer überhaupt weiß, was Bartergeschäfte sind, verortet<br />
sie in die Frühzeit der Menschheits geschichte.<br />
Damals, vor der Erfindung des Geldes oder eines<br />
wie auch immer gearteten allgemeinen Äquivalents,<br />
tauschte man eben, was man hatte, gegen Dinge, die<br />
man brauchte. Aber kann es sinnvolle Barter- also<br />
Tauschgeschäfte in unserer durch und durch monetarisierten<br />
Wirtschaft geben? Klaus Westrick beantwortet<br />
die Frage mit einem eindeutigen Ja. Sein Unternehmen,<br />
die XLS Media Group, hat sich auf eben<br />
solche Tauschgeschäfte spezialisiert und dies ganz<br />
offensichtlich mit großem Erfolg.<br />
Das legen die edlen Büroräume in bester Wiesbadener Lage zumindest<br />
nahe, und die Annahme wird vom jugendlich schwungvoll<br />
herbeieilenden Geschäftsführer und Firmengründer gerne<br />
bestätigt. Es sei den meisten Menschen gar nicht bekannt, wie viele<br />
Nischen die moderne Wirtschaft für Tauschgeschäfte biete, sagt er.<br />
Und natürlich dafür, mit diesen Tauschgeschäften Geld zu verdienen.<br />
Am ver breitetsten sind Unternehmen, die – wie auch XLS – im Bereich<br />
Media bartering tätig sind. Das bedeutet: Kunden bezahlen die Werbeleistungen,<br />
die sie benötigen, nicht mit Geld, sondern mit ihren eigenen<br />
Produkten. Gerade weil es um das Ausfüllen von Nischen handelt, haben<br />
Unter nehmen, die solche Geschäfte vermitteln, eine nützliche Funktion.<br />
Von der hohen Warte der Volkswirtschaft aus gesehen sind sie damit<br />
befasst, auf ihrem Gebiet die Reibungsverluste der Markt wirtschaft<br />
zu reduzieren.<br />
Das Geschäftsmodell Mediabarter ist in den Vereinigten Staaten<br />
nach dem Zweiten Weltkrieg entstanden. Die Betriebe, die während des<br />
Krieges für die Rüstung gearbeitet hatten, stellten wieder auf die zivile<br />
Produktion um, hatten aber kaum flüssige Mittel für Werbung. Also<br />
bezahlten sie für ihre Werbeauftritte mit Waren oder Dienst leistungen.<br />
Die so entstandene Barterindustrie sah sich als Clearing stelle für Unternehmen<br />
mit Warenüberschüssen und half ihnen, ihre Waren zu kapitalisieren<br />
und damit mehr Werbe präsenz zu generieren.<br />
Als Klaus Westrick sein Unternehmen im Jahr 2000 gegründet hatte,<br />
passte er das amerikanische Geschäftsmodell den deutschen Verhältnissen<br />
an. Während es in den Vereinigten Staaten üblich war, die Warenleistung<br />
des Kunden in Credits, also Handelsgutschriften auszudrücken,<br />
die dann später bei den Werbeträgern gegen Flächen oder Werbezeiten<br />
ein getauscht werden konnten, hatte sich der Firmengründer für den<br />
reinen Tausch entschieden: Medien gegen Ware. »Unsere Währung<br />
sind die Medien«, erklärt er. Bezahlt werden die Produkte der Hersteller<br />
mit Media volumina, das heißt Fernseh- und Radiospots, Plakataktionen,<br />
Anzeigen in Print medien und natürlich auch in den neuen<br />
elektronischen Medien. Klaus Westrick begründet diese Präferenz für<br />
den reinen Tausch damit, dass dieser für alle Beteiligten transparenter<br />
sei. Transparenz sei in Deutschland, wo Bartergeschäfte auf viele Vorbehalte<br />
treffen, besonders wichtig. Er ist davon überzeugt, dass die Transparenz<br />
einer der Gründe für seinen Erfolg war und auch bleiben wird.<br />
Wie aber muss man sich so ein Bartergeschäft vorstellen? Und wie<br />
kommen die daran interessierten zusammen? Zum Beispiel so: Die Firma<br />
XLS steht im Kontakt mit einem Hersteller von Fernseh geräten, der wegen<br />
eines Modellwechsels tausend Fernseher der vorher gehenden Generation<br />
auf Lager hat. Diese binden Kapital, belegen Lagerkapazitäten und<br />
14 <strong>FINE</strong> 1 | 2017 <strong>DAS</strong> <strong>MAGAZIN</strong> <strong>FÜR</strong> <strong>GENUSS</strong> <strong>UND</strong> <strong>LEBENSSTIL</strong>
Von Ihnen gebrüht.<br />
Der Unterschied heißt Gaggenau.<br />
Sie nehmen sich die Zeit, Ihren handverlesenen, organischen<br />
Arabica-Kaffee auszuwählen, im Hochland von Yirgacheffe<br />
sonnengetrocknet – das ist es Ihnen wert. Denn Sie haben<br />
die Gewissheit, mit dem Brühen des Kaffees das volle Aroma<br />
der Bohne auszuschöpfen.<br />
Das neue Lichtkonzept unseres Espresso-Vollautomaten<br />
rückt Ihren Kaffee in den Mittelpunkt. Und dank intuitivem<br />
TFT-Touch-Display ist es ein Leichtes, diesen nach Ihren<br />
Vorlieben zuzubereiten und Ihre persönliche Kreation zu<br />
speichern; Tasse für Tasse nach Ihrem Geschmack.<br />
Wie Sie Ihren Kaffee auch bevorzugen, genießen Sie ihn.<br />
Informieren Sie sich unter www.gaggenau.com.
»Meine Währung sind die Medien« | Klaus Westrick<br />
Tauschhandel modern:<br />
Um im Bartergeschäft<br />
erfolgreich zu sein,<br />
braucht Klaus Westrick<br />
vor allem drei Dinge –<br />
Kontakte, Kontakte<br />
und Kontakte. Dazu<br />
profunde Medienkenntnis,<br />
professionelles<br />
Markt- und<br />
Branchenwissen und<br />
ein lücken loses Netzwerk.<br />
Sein Handel von<br />
Produkten gegen freie<br />
Werbeflächen in den<br />
Medien floriert.<br />
müssen unter Umständen sogar<br />
abgeschrieben werden. Zugleich<br />
aber möchte das Unternehmen<br />
seine neuen Geräte bewerben.<br />
XLS erwirbt die Geräte zum Großhandels<br />
preis und bezahlt sie mit<br />
Werbezeiten einer Sendergruppe,<br />
bei der das Unternehmen davon<br />
ein größeres Kontingent besitzt.<br />
Der Hersteller hat nun die alten<br />
Geräte verkauft und kann Werbung<br />
für die neuen Geräte schalten,<br />
für die ihm sonst die liquiden<br />
Mittel gefehlt hätten.<br />
Nun wiederum muss XLS die<br />
Geräte verkaufen, ohne seinem<br />
Kunden zu schaden oder ihm<br />
auf dem Markt Konkurrenz zu<br />
machen. Da kommen die guten<br />
Kontakte von Klaus Westrick zu<br />
den Importeuren von Autos ins<br />
Spiel. Die TV-Geräte werden<br />
einem Autoimporteur verkauft,<br />
der diese Geräte für eine Werbeaktion<br />
nutzen will. Er bezahlt XLS<br />
nur zum Teil mit Geld, den anderen<br />
Teil bilden Fahrzeuge, die<br />
auch eingesetzt werden, um die<br />
Werbeaktion des Importeurs im<br />
Radio und auf Plakaten zu finanzieren.<br />
Am Ende profitiert auch<br />
der TV-Produzent, weil durch die<br />
Autowerbung auch seine Marke<br />
öffentlich stärker wahr genommen<br />
wird.<br />
Nicht alle Tauschgeschäfte<br />
sind so komplex wie die gerade<br />
dargestellten. Eine Molkerei, die<br />
ungenutzte Kapazi täten für die Herstellung von Yoghurt hatte, bezahlte<br />
eine großangelegte nationale Plakatwerbeaktion mit diesem Produkt,<br />
das wiederum von XLS an Gefängnisse geliefert wurde. Solche Geschäfte<br />
kommen immer wieder zustande, weil Hersteller von Konsumgütern<br />
häufig Überhänge haben, die Lager blockieren und Kapital binden:<br />
Das betrifft vor allem Saisonware oder Produkte mit einem schnellen<br />
Innovations zyklus wie beispielsweise Unterhaltungselektronik. Sie<br />
möchten die Waren auf anderen Wegen in den Markt bringen, auf jeden<br />
Fall so, dass sie damit dem neueren Produkt keinen Schaden zufügen.<br />
Zugleich haben diese Unternehmen auch einen Bedarf an Media präsenz,<br />
um die neuen Waren zu bewerben.<br />
Die Kernkompetenz von XLS sind die Medien. Diese Kompetenzen<br />
sind durch die intensive Zusammenarbeit mit den Media agenturen<br />
im Laufe der Jahre gewachsen<br />
und heute wesentlich für das<br />
Geschäfts modell. Die Interessen<br />
der Medien am Barter geschäft<br />
hätten ebenfalls mit Überangebot<br />
zu tun, erklärt Klaus Westrick.<br />
»Alle Medien haben freie Kapazitäten«,<br />
sagt er, »und das ist die<br />
Grundlage unseres Geschäfts:<br />
Media ist ein handel bares Gut.<br />
Werbe zeiten und - flächen verfallen,<br />
wenn sie nicht genutzt<br />
werden. Sie sind auch substituierbar:<br />
Eine Zielgruppe kann man bei<br />
RTL genauso erreichen wie bei<br />
ProSiebenSat 1. Deshalb haben die<br />
Medien ein Interesse an unserer<br />
Tätigkeit. Wir handeln mit Werbeflächen<br />
und ermöglichen unseren Kunden, dafür mit Ware zu bezahlen.<br />
Dadurch werden zusätzliche Werbebudgets generiert, was den Interessen<br />
der Medien entspricht.« Es geht also darum, die freien Kapazitäten<br />
der Medien zu vermarkten, und für den Medieneinsatz bis dahin<br />
brachliegendes Kapital zu mobilisieren. Durch die Kunden, die mit<br />
Ware bezahlen, entsteht die begehrte zusätzliche Auslastung.<br />
Westrick kennt sich mit dem Geschäft der Medien aus. Er arbeitet<br />
eng zusammen mit den Medienhäusern, die das Plus an Vermarktung<br />
ihrer Werbeflächen durchaus begrüßen. Die persönlichen und vertraulichen<br />
Kontakte sind über Jahre gewachsen, und so sind Geschäftsmodelle<br />
ent standen, die allen Beteiligten Vorteile bieten. Das war in der<br />
Berufs biographie Westricks nicht vorgezeichnet. Ursprünglich kommt<br />
er aus der Finanzwelt, genau genommen vom Aktien handel. 1996 ist er<br />
dann in den Werbezeiten-Handel eingestiegen, und das war die Initialzündung<br />
für die Entwicklung des neuen Geschäftsmodells.<br />
Seine Tätigkeit erfordert Expertise auf gleich drei Gebieten: im<br />
Bereich der Medien, der Konsumgüter produzierenden Industrie<br />
und der Märkte, auf denen die als Gegenleistung für Mediapräsenz<br />
erworbenen Güter veräußert werden. Diese letztere Aufgabe ist<br />
besonders heikel und erfordert viel Phantasie. Denn der Verkauf darf<br />
nicht zur Selbstkannibalisierung des Kunden führen, er darf den ohnehin<br />
schon gesättigten Markt auf keinen Fall überschwemmen und ihn<br />
noch enger machen. Die Verwertung wird deshalb sorgfältig mit dem<br />
Kunden abgestimmt. Dafür in Frage kommen aus ländische, bis dahin<br />
unbearbeitete Märkte oder geschlossene Kreisläufe, wie innerbetriebliche<br />
Bonusprogramme, Preisausschreiben oder auch Werbeaktionen<br />
wie im Falle der Fernseher für Autokäufer.<br />
Die Zukunftschancen seines Unternehmens sieht Westrick sehr<br />
optimistisch. Durch die Digitalisierung würde die Brutto-Werbefläche<br />
schnell weiter wachsen, während die Netto-Werbebudgets der Unternehmen<br />
eher stagnierten. »Da wir Budgets mobilisieren, Waren kapitalisieren<br />
und so zusätzliche Gelder für die Werbebudgets heben, bleiben<br />
wir für die Mediapartner weiterhin sehr interessant«, erklärt er. Der<br />
Kampf um die Werbegelder werde täglich stärker, ebenso der Bedarf<br />
der Kunden, die Budgets zu optimieren. »Durch unsere Arbeit ist die<br />
Gesamt akzeptanz auf diesem kleinen Werbemarkt gewachsen«, fügt<br />
er weiter hinzu, wobei er sich der Grenzen des Wachstums bewusst ist:<br />
»Wir werden weiterhin eine Nische bleiben.«<br />
Wie erfolgreich XLS in dieser Nische agiert, beweisen die Zahlen,<br />
die erst für das Jahr 2015 vorliegen: Seit der Unternehmensgründung<br />
hat der Marktführer etwa 550 Millionen Euro Umsatz gemacht, 11 500<br />
Automobile verkauft, 55 000 TV-Spots und 44 000 Radiospots geschaltet<br />
– das alles mit nur vier festen Mitarbeitern. Das wichtigste Kapital<br />
von XLS ist das Knowhow, die Kontakte und die sorgsam gepflegten<br />
Beziehungen zu den wichtigen Akteuren auf dem Werbemarkt. Dieser<br />
Aufgabenstellung kommt die Persönlichkeit Klaus Westricks sicherlich<br />
entgegen. Er ist nicht nur eloquent, wenn es gilt, die Vorteile von<br />
Barter geschäften zu schildern, er ist auch der geborene Netzwerker, und<br />
wenn ein Geschäft es erforderlich macht, Vertraulichkeit zu bewahren,<br />
kann er auch unerschütterlich verschwiegen sein.<br />
16 <strong>FINE</strong> 1 | 2017 <strong>DAS</strong> <strong>MAGAZIN</strong> <strong>FÜR</strong> <strong>GENUSS</strong> <strong>UND</strong> <strong>LEBENSSTIL</strong>
Foto: Brigitte Lacombe<br />
EIN ATHLET<br />
Als Meister der Reduktion setzt der japanische Designer Issey Miyake<br />
auf Minimalismus, Klarheit und Zeitlosigkeit – wie seine Mode und seit<br />
fünfundzwanzig Jahren auch seine Parfüms beweisen.<br />
18 <strong>FINE</strong> 1 | 2017 <strong>DAS</strong> <strong>MAGAZIN</strong> <strong>FÜR</strong> <strong>GENUSS</strong> <strong>UND</strong> <strong>LEBENSSTIL</strong>
Der Mann ist beim Kaiser. Privataudienz im Palast. Für ein Tässchen Tee mit dem Tenno versetzt Mode- und Duft-Visionär Issey Miyake<br />
eine Handvoll Journalisten, die eigens für ein Treffen mit ihm nach Japan gereist sind. Eine Frage der Etikette, Majestät geht allemal vor<br />
(Presse-)Volk. Doch diese Einladung sei ihm wirklich gegönnt. Gewährt für seine bahnbrechenden Ideen, die er seit der Gründung seines<br />
eigenen Design-Studios in Tokio 1970 entwickelt und umgesetzt hat. Ein Lebenswerk, dem Nippons National Art Center ver gangenes<br />
Jahr eine umfassende Werkschau widmete. Die hatte auch Throninhaber Akihito gesehen, beeindruckt und zwecks Anerkennung im<br />
Nachhinein zu dieser Einladung bewogen.<br />
Fotos: Beaute Prestige International<br />
Vermutlich war Issey Miyake darüber nicht nur der<br />
Ehre wegen erfreut, sondern auch ein bisschen, weil<br />
er nun eine plausible Ausrede hatte, den Interviewtermin<br />
zu schwänzen. Er steht nicht gern im Mittel punkt,<br />
ist keiner dieser in seiner Branche so verbreiteten Spezies<br />
von Selbstdarstellern, die immer auf Publicity aus sind. Das<br />
war er noch nie. Schon von Anfang an, als er in den frühen<br />
achtziger Jahren als auf gehender Stern in Paris für seine<br />
ausgefallenen und mutigen Kollektionen gefeiert wurde,<br />
tauchte sein voller schwarzer Haarschopf nach dem Defilee<br />
nur kurz aus der Kulisse auf, um sich beim Publikum für<br />
den Beifall zu bedanken. Jetzt, er ist inzwischen grau haarig<br />
und vor ein paar Tagen neunundsiebzig Jahre alt geworden,<br />
macht er sich erst recht rar und schickt stattdessen lieber<br />
seine engste Vertraute vor.<br />
Das ist Midori Kitamura, die vor mehr als vierzig Jahren<br />
als Haus model bei der Marke angefangen hat und heute die<br />
Präsidentin der Miyake Design Studios ist. Formvollendet<br />
übernimmt die große, aparte Japanerin mit dem klassisch<br />
geschnittenen Gesicht und den zu einem Knoten zurückgenommenen<br />
Haaren denn auch an diesem Tag das Kommando.<br />
Sie führt die Gäste durch eine Galerie in der City,<br />
um dort zwischen lauter hauchdünnen Glasobjekten, die<br />
wie dicke Seifen blasen aussehen, das neue Parfüm »Pure«<br />
zu präsentieren. Die klare Duft komposition und der tropfenförmige<br />
Flakon, unter dem wachsamen Kontrollblick des<br />
Meisters vom New Yorker Designer Todd Bracher entworfen,<br />
fügen sich nahtlos in das stringente olfaktorische<br />
Konzept des japanischen Stilisten. Der schuf dafür bereits<br />
1992, also exakt vor fünfundzwanzig Jahren, mit »L’Eau<br />
d’Issey« den Prototyp.<br />
Als Miyake das Parfüm herausbrachte, war es ein absolutes<br />
Feder gewicht im Vergleich zu den damals so beliebten,<br />
opulenten Mischungen wie »Trésor« von Lancôme oder<br />
»Venezia« von Laura Biagiotti. Auch im Auftritt wirkte<br />
der schlichte Glaskegel – im Vergleich zu anderen Flakons<br />
– eher bescheiden. Aber gerade weil dieses Parfüm<br />
so anders roch und aussah, erregte es Aufmerksamkeit und<br />
brachte mit seiner Unbeschwertheit und Transparenz frischen<br />
Wind in die Parfümerie.<br />
Ein Vierteljahrhundert später ist »L’Eau d’Issey« immer<br />
noch ein Bestseller, von dem alle fünf Minuten irgendwo<br />
auf der Welt ein Exemplar verkauft wird. Durch ihn haben<br />
typisch japanische Zutaten wie Nashi-Birne, Lotus, Yuzu<br />
(eine Zitrusart), Bambus oder Ingwer das Portfolio der<br />
Parfümeure erweitert. Eaux wurden wieder modern, mit<br />
ihrer unaufdringlichen Frische gehören sie heute zu den<br />
beliebtesten Duftkonzentrationen.<br />
Eine Entwicklung, ganz im Sinne von Miyake, der aus<br />
einem Land stammt, in dem traditionsgemäß – sieht man<br />
mal von der schrägen Streetfashion in Tokios Trend vierteln<br />
Shibuya oder Harajuku ab – Reduktion und Purismus stilbestimmend<br />
sind. »Wenn ich zurückschaue«, mokiert sich<br />
der sympathische Designer mit den warmen braunen Augen<br />
und einem feinen Lächeln unter dem kessen schmalen<br />
Ober lippen bärtchen, »war es nicht mal so ein Handicap,<br />
in Japan geboren zu sein.« Wohl wahr, denn mit seinem<br />
ausgeprägten Sinn für Minimalismus hat er nicht nur in<br />
der Parfümerie seine Spuren hinterlassen, sondern auch<br />
im Interior- Bereich und vor allem in der Mode.<br />
Alles, was er je entworfen hat, beziehungsweise mit<br />
nie erlahmen dem Enthusiasmus immer noch entwirft,<br />
ist nicht fashionable im eigentlichen Sinn,<br />
sondern futuristisch in Form und Funktion und seiner Zeit<br />
weit voraus. Experimentierfreudig wie kein Zweiter schuf<br />
er bereits als junger Mann Plastik-Bodies, mehr Harnisch<br />
als Bustier, ließ Metall spiralen als »Bodyarmband« um<br />
die Körper der Models wickeln, Stoffe aus mit Baumwolle<br />
überzogener Angelschnur weben, Pullis verkehrt herum<br />
tragen und Kleider aus Taschentüchern nähen. Legendär<br />
auch seine Oversize-Mäntel mit überdimensionaler<br />
Kapuze, die einem Herren- Kimono nachempfunden waren<br />
und heute jedem Preisboxer, der unter Fanfarenklängen<br />
gen Ring schreitet, den ultimativen Gladiatoren status verleihen<br />
würden.<br />
Miyake ist ein Vordenker, ein Forscher was die Entwicklung<br />
neuer Schnitte, Stoffe, Webverfahren und Techniken<br />
angeht. Stets versucht er, ungewöhnliche Materialien<br />
wie Papier, Bambus oder Jute auch für Normalverbraucher<br />
kleidertauglich zu machen. Seine legendären »Pleats<br />
please«-Kollektionen (»Falten bitte«) lässt er beispielsweise<br />
aus Polyester fertigen. Ihr Plissee bekommen die koffertauglichen<br />
Kleidungsstücke erst nach dem Nähen verpasst –<br />
Begehrt: Miyakes Duftklassiker<br />
»L’Eau d’Issey«<br />
verkauft sich weltweit noch<br />
immer im Minuten-Takt.<br />
DES PURISMUS<br />
Von ANGELIKA RICARD-WOLF<br />
<strong>DAS</strong> <strong>MAGAZIN</strong> <strong>FÜR</strong> <strong>GENUSS</strong> <strong>UND</strong> <strong>LEBENSSTIL</strong> <strong>FINE</strong> 1 | 2017 19
Ein Athlet des Purismus | Issey Miyake<br />
Wegweisend: Eine<br />
Retrospektive in Tokio<br />
zeigte kürzlich vom<br />
Linen Jumpsuit bis zum<br />
Gewand aus Pferdehaar<br />
avantgardis tische<br />
Schöpfungen des japanischen<br />
Designers.<br />
Fotos: Hiroshi Iwasaki<br />
so hält es dauerhaft. »132.5« ist die Bezeichnung einer Art<br />
Origami-Mode. Aus einem flachen Quadrat entfaltet sich<br />
ein einziges, raffiniert geschnittenes Stück Stoff zu einem<br />
tragbaren Gewand – vorausgesetzt, man ver heddert sich<br />
darin nicht beim Anziehen.<br />
Die ungewöhnliche Arbeitsweise von Issey Miyake<br />
nennt man auf Japanisch »Mono-zukuri«. Es bedeutet<br />
so viel wie »Dinge fertigen«. Akribisch – bis sie<br />
ausgereift sind. Miyake »fertigt« denn auch keine Mode,<br />
sondern ein Bekleidungsstück. Keine Lampe, sondern einen<br />
Leuchtkörper. Kein Parfüm, sondern ein Duftwasser. Keinen<br />
Flakon, sondern ein Behältnis.<br />
»Natürlich gab es harte Zeiten, in denen das, was ich<br />
entworfen habe, nicht verstanden wurde«, sagt er, »aber ich<br />
Taufrisch: Der neue<br />
Duft »Pure« im<br />
tropfen förmigen<br />
Flakon fügt sich<br />
ganz in die Miyake-<br />
Tradition – optisch<br />
wie olfaktorisch.<br />
habe versucht, mir mein Anderssein zum Vorteil zu machen.<br />
Dadurch bin ich den unterschiedlichsten Menschen begegnet.«<br />
Grafikern, Architekten und Tänzern, Lichtkünstlern,<br />
Wissenschaftlern und Sportlern: Mit allen hat er zusammengearbeitet,<br />
sich von deren Metiers inspirieren lassen und<br />
mit ihnen oder für sie Neues erdacht und entworfen. Bauwerke,<br />
Druck techniken, Taschen, Kostüme, Lampen und<br />
mit dem Uniform- Projekt sogar die komplette Ausstattung<br />
der Olympia-Mannschaft von Litauen, das nach dem<br />
Zerfall der Sowjetunion erstmals ein eigenes Team aufstellen<br />
konnte. »Ich wollte immer herausfinden, was ich entdecken<br />
und erschaffen konnte, um damit das Leben vieler<br />
Menschen zu berühren und nicht nur das einiger weniger«,<br />
beschreibt er seine Motivation als Designer.<br />
Diesen, seinen ganz eigenen Weg konsequent zu gehen,<br />
hat er früh lernen müssen. Als siebenjähriger Junge, er<br />
radelte gerade zur Schule, verlor Miyake durch den Atomangriff<br />
der Amerikaner auf Hiro shima einen großen Teil seiner<br />
Familie. Seine Mutter erlag den Folgen des Anschlags, er<br />
selbst litt als Jugendlicher an einer Knochenmark erkrankung,<br />
durch die sein rechtes Bein steif blieb. Seine Träume von<br />
einer Laufbahn als Athlet musste er deshalb aufgeben. Das<br />
Talent und die sportliche Statur dazu hätte er gehabt. Stattdessen<br />
studierte er Grafik und Design an der Tama-Universität<br />
in Tokyo.<br />
Im Anschluss ging er Anfang der sechziger Jahre nach<br />
Paris, um die Feinheiten der Haute Couture kennenzulernen.<br />
Dort arbeitete er für Guy Laroche und Hubert de<br />
Givenchy, später für Geoffrey Beene in New York. Ein Intermezzo,<br />
Lehrjahre im besten Sinne. Denn als Couturier im<br />
herkömmlichen Sinn versteht er sich ganz und gar nicht.<br />
Mode püppchen wurden und werden bei ihm und seinen<br />
diversen Kollektionen nicht fündig. »Die Menschen brauchen<br />
japanische Designer, weil sie eine andere Art Ästhetik<br />
haben«, sagt er – ohne jede Spur von Eitelkeit.<br />
In Tokios feiner Einkaufszeile Omotesando Avenue reiht<br />
sich Shop an Shop, in denen seine »andere Art Ästhetik«<br />
anhand seiner zahl reichen, nicht eben preiswerten<br />
Linien stylisch präsentiert wird. Mit zarten Vogeldrucken<br />
auf gefälteltem Stoff liegen bei »me« T-Shirts und Blusen<br />
im Schaufenster, bei »Bao Bao« gibt es in allen Farben die<br />
angesagten beweglichen Taschen aus Polyester-Triangeln,<br />
bei »Pleats please« tanzen Inkas über das Plissee. Und<br />
auch die Männer kommen mit transparenten Shrink-Sakkos<br />
nicht zu kurz. Lauter modernis tische Linien, die für<br />
Frauen und Männer mit ausgeprägtem Selbstbewusstsein<br />
und Sinn für Funktionalität gemacht sind. Miyake zu tragen<br />
ist ein Statement.<br />
Mit seiner Konzentration auf das Positive und Schöne<br />
ist es Issey Miyake – zumindest nach außen – gelungen,<br />
die schrecklichen Erlebnisse seiner Kindheit zu kompensieren.<br />
Statt über die Vergangenheit zu sprechen, hat er<br />
sich der Zukunft verschrieben. »Ich habe es hinbekommen<br />
zu überleben, weil ich Dinge gemacht habe«, meint<br />
er rück blickend. Er sagt Dinge, nicht Design oder Mode<br />
oder Parfüm.<br />
Ob man den Namen des Schöpfers dieser »Dinge«<br />
kenne, sei ihm egal. So wie er den Namen eines Designers<br />
für absolut nebensächlich hält. »Was zählt ist das, was er<br />
erschafft.« Wenn das so ist, sollte Issey Miyake möglichst<br />
vielen ein Begriff sein.<br />
20 <strong>FINE</strong> 1 | 2017 <strong>DAS</strong> <strong>MAGAZIN</strong> <strong>FÜR</strong> <strong>GENUSS</strong> <strong>UND</strong> <strong>LEBENSSTIL</strong>
Walsheimer Straße 18 · 76829 Landau-Nußdorf · Tel: 06341-61754 · E-mail: bauerwein@web.de · www.bauerwein.de<br />
WEINGUT<br />
EMIL BAUER<br />
& SÖHNE
MEMBERS<br />
ONLY<br />
67, PALL MALL – DER<br />
EXKLUSIVE CLUB<br />
<strong>FÜR</strong> WEINLIEBHABER<br />
Von ELLEN ALPSTEN Fotos CHRISTOF HERDT<br />
Variatio delectat, Abwechslung macht Spaß: Das ist<br />
seit eh und je der Leitfaden des Londoner Lebens, und<br />
die zahlreichen Privatclubs in Englands Hauptstadt<br />
bilden da keine Ausnahme. Ob Gentlemen oder Ladies<br />
only, mit rechter, linker oder liberaler Gesinnung, ob<br />
echt englischer Kreativer, Herzog oder internationaler<br />
Medien-Mogul – bisher fand noch jeder einen Club<br />
nach seinem Geschmack. Dem Geschmack huldigt nun<br />
ein Neuankömmling auf der Londoner Club Szene in<br />
ganz besonderer Weise: 67, Pall Mall – benannt nach<br />
der Adresse des Hauses nahe dem St James’s Palace<br />
und dem Green Park – ist ein Members- only- Club<br />
für Weinliebhaber.<br />
Allein das von der Architektenlegende Sir Edward Lutyens entworfene<br />
und unter Denkmal schutz stehende Gebäude ist spektakulär:<br />
Das ehemalige Haupt quartier der Londoner Privatbank<br />
Hambros stand Jahrzehnte lang leer. Grant Ashton, der Gründer des<br />
Clubs, verzieht jedoch das Gesicht, wenn man ihn auf den architektonischen<br />
Schatz anspricht, und sagt düster: »Alle haben mich gewarnt,<br />
dieses Wagnis einzugehen. Zu Recht, wenn man sieht, wie viel Zeit und<br />
Geld dieses Projekt verschlungen hat!« Dann aber lacht er – denn er<br />
ist ein Mann, der gern lacht, feiert und Wein trinkt! – und sieht sich<br />
zufrieden um: All die Mühe hat sich gelohnt. Der Speisesaal mit seiner<br />
zehn Meter hohen Decke badet in golde nem süd-westlichen Licht, das<br />
das Interieur wie Pfauenfedern schimmern lässt. Die Innen einrichterin<br />
Simone McEwan erklärt: »Wir wollten den Art-Deco-Charakter des<br />
Raums beibehalten. So habe ich zwar die Eichenholz vertäfelungen<br />
bewahrt, und man sitzt auch immer noch auf Ledersesseln. Aber ich<br />
habe das Ganze mit vielen anderen, feminineren Elementen gemischt<br />
und aufgelockert.«<br />
Eine kluge Wahl, denn Grant Ashton will gerade junge, solvente<br />
Frauen als Mitglieder werben. »Banker um die Vierzig und mit<br />
Geheimrats ecken haben wir genug«, sagt er an der Bar seines Hauses,<br />
einem langen Marmortresen vor opulent bestückten, verglasten Weinregalen.<br />
Viele der Flaschen lagen einst in Grant Ashtons eigenem Keller –<br />
als er noch der gestresste Eigentümer eines Londoner Hedge-Fonds war.<br />
Dann kam einiges zusammen. »Mein Bruder ist technischer Direktor<br />
bei Ronnie Scott’s, einem der bekanntesten Jazz-Clubs von London.<br />
Also erhielt ich Einblick in die Gastronomie und die Club-Szene.« Was<br />
noch? Grant Ashton, Geldmann bis auf die Knochen, grinst: »Außerdem<br />
hatte ich einfach die Nase voll davon, in einem Restau rant einen<br />
geradezu wahnwitzigen Aufschlag auf eine Flasche Wein zu bezahlen,<br />
22 <strong>FINE</strong> 1 | 2017 <strong>DAS</strong> <strong>MAGAZIN</strong> <strong>FÜR</strong> <strong>GENUSS</strong> <strong>UND</strong> <strong>LEBENSSTIL</strong>
selbst wenn sie außergewöhnlich war. Und ich wollte an einem gemütlichen<br />
Freitagabend daheim nicht gerade meine erlesenste Flasche zu<br />
einem Teller Spaghetti Bolognese öffnen.«<br />
Was tun? Grant Ashton überlegte, eine kleine Wein-Bar zu<br />
eröffnen: irgendwo in Marylebone vielleicht, dem intellektuellsten<br />
und noch verstecktesten der inneren Londoner<br />
Stadtviertel. Eine Art Absatzmarkt für seinen eigenen Weinkeller wie<br />
auch den seiner Freunde. Die waren von der Idee so begeistert, dass sie<br />
wuchs und wuchs: Am Ende hatte Grant Ashton (der ausgesprochen<br />
über zeugend sein kann) neununddreißig Investoren. Im Herbst 2015<br />
war es dann soweit: 67, Pall Mall öffnete seine Pforten – oder seine<br />
meterhohen doppel- flügeligen Türen –, und Grant Ashton konnte<br />
gemeinsam mit seinem Manager Niels Sherry, der sich seine Lorbeeren<br />
sowohl im Savoy als auch in Ian Schragers Hotels verdient hat,<br />
sowie dem Top-Sommelier Ronan Sayburn erste Mitglieder aus aller<br />
Welt begrüßen.<br />
Denn schon vor der Eröffnung war die Liste für neue Mitglieder<br />
fast komplett – mehr als zwölfhundert sollen es nicht werden – und<br />
neue Anträge stapeln sich auf Ashtons Schreibtisch. »Unsere Liste ist<br />
wunderbar bunt gemischt. Bankiers und Hedgefonds-Manager, aber<br />
auch Weingutsbesitzer, Mode designer, Schriftsteller, Händler oder<br />
private Weinliebhaber. Das einzige Kriterium, das für mich zählt, ist<br />
die Leidenschaft für, wie auch die Neugier auf den Wein. Es geht nicht<br />
um Alter, Wissen, Geld oder die Größe des Weinkellers. Ich will eine<br />
dynamische und hoffentlich junge Mischung.«<br />
Passioniert: Für Chef und Gründer Grant<br />
Ashton ist 67, Pall Mall eine Mischung<br />
aus Geschäft und Vergnügen. Im Herbst<br />
2015 eröffnete der Weinkenner und<br />
frühere Eigentümer eines Hedgefonds<br />
den exklusiven internationalen Club<br />
im Herzen des historischen Londoner<br />
Stadtteils St James’s.<br />
<strong>DAS</strong> <strong>MAGAZIN</strong> <strong>FÜR</strong> <strong>GENUSS</strong> <strong>UND</strong> <strong>LEBENSSTIL</strong> <strong>FINE</strong> 1 | 2017 23
ROCK ME<br />
Cecilia Bönström und Thierry Gillier mischen mit ihrem<br />
Label Zadig & Voltaire die Duft- und Fashionszene auf<br />
Von ANGELIKA RICARD-WOLF<br />
Sie war ein Model, und sie sieht gut aus. Cecilia Bönström ist langbeinig,<br />
blond, schmal. Mit ihren sechsundvierzig Jahren verkörpert<br />
sie perfekt die Frau, die sie als Chefdesignerin der französischen<br />
Lifestyle-Marke Zadig & Voltaire auch anzieht: diesen leicht schlaksigen,<br />
aber dennoch ewig mädchenhaft wirkenden Jane-Birkin-Typ.<br />
Seit elf Jahren prägt das<br />
Ex-Model Cecilia Bönström<br />
den Stil der rockig-femininen<br />
Modemarke Zadig & Voltaire<br />
und feiert so auf dem<br />
Laufsteg noch heute<br />
Erfolge.<br />
Der liebt es lässig. Bloß nicht gestylt aussehen, sondern so, als<br />
habe man Jeans, Top, Lederjacke oder Pulli schnell aus dem<br />
Schrank gegriffen und übergeworfen, bevor man in die Boots<br />
oder Sneaker steigt und die Wohnung verlässt. Klar, das Top ist aus<br />
Seide, der Oversize-Pulli aus hauchdünnem Federkaschmir und ein<br />
Schlangenrelief prägt die roséfarbenen Ziegenleder-Boots – aber das<br />
sehen nur Eingeweihte auf den ersten, alle anderen, wenn überhaupt,<br />
auf den zweiten Blick. Easy luxury nennt man diesen unaufgeregten,<br />
leicht abgerockt wirkenden Style auf hohem Niveau. Ein bisschen<br />
Vintage, ein Hauch androgyn, ein wenig Bohémien, aber immer fashionable<br />
und unglaublich sexy.<br />
Ein unvergleichlicher Mix, den man erstmal hinkriegen muss. Cecilia<br />
Bönström hat ihn quasi verinnerlicht. Fünfzehn Jahre war die gebürtige<br />
Schwedin bei einer legendären Elite-Agentur unter Vertrag, ist für Gucci,<br />
Prada und Co. über die Catwalks gelaufen und hat unzählige Shootings<br />
für Spitzenfotografen und Magazine absolviert. Wer, wenn nicht sie,<br />
wüsste nicht genau, was die Kolleginnen backstage am liebsten tragen?<br />
Abgesehen davon hatte ihre kreative Mutter sie und ihre Zwillingsschwester<br />
(die immer noch modelt) schon als Kinder an eine Art Freestyle<br />
gewöhnt. Denn es war damals auch in Gothenburg, wie Göteborg<br />
einmal hieß, nicht üblich, zwei blondbezopfte Mädchen mal mit<br />
apfelgrünen Zottelstiefeln, mal mit riesigen weißen Hüten zur Schule<br />
zu schicken. Das prägt.<br />
Trotzdem hatte Cecilia Bönström ziemlichen Bammel, als sie aufgrund<br />
der Erkenntnis »Ich kann ja nicht ewig modeln« all ihren Mut<br />
zusammennahm, um sich bei Zadig & Voltaire als Modeaspirantin vorzustellen.<br />
Da wollte sie arbeiten, die Marke hatte es ihr angetan, die<br />
schicke Simplizität der Läden, der Klamotten.<br />
Also das Ideenbuch unter den Arm geklemmt und nix wie hin ins<br />
Zentrum der Marke an der Avenue d’Iéna mitten in Paris. Das war 2003,<br />
und sie war dreiunddreißig. Prompt bekam sie einen Job als Assistentin,<br />
drei Jahre später den als Chefdesignerin. Sie rockte den Laden –<br />
und den Chef. Mit Firmengründer Thierry Gillier ist sie inzwischen<br />
ver heiratet. Das Paar hat drei Söhne.<br />
This is her. So ist sie. Da liegt es nahe, dem neuen Damenparfüm der<br />
Marke diesen Namen zu geben. Denn der ist laut Werbeslogan »für die<br />
freie, rebellische Frau« entworfen. Dazu passt, fanden die Parfümeure<br />
Sidonie Lancesseur und Michel Almairac, eine »rockige Jasminnote«,<br />
die mit Nuancen von Kastanie, Vanille, Sandelholz und – versteht sich –<br />
Fotos: Zadig & Voltaire<br />
26 <strong>FINE</strong> 1 | 2017 <strong>DAS</strong> <strong>MAGAZIN</strong> <strong>FÜR</strong> <strong>GENUSS</strong> <strong>UND</strong> <strong>LEBENSSTIL</strong>
BABY!<br />
einer Prise Pfeffer abgerundet wird. Fragt man Cecilia Bönström, welche<br />
Art Frau sie sich vorgestellt habe, als sie dieses Parfüm in Auftrag gab,<br />
antwortet sie: »Eine Frau, die sehr jung ist. Im Geist. Nicht unbedingt<br />
nach Jahren. Feminin, aber modern. Nicht süß, nicht romantisch. Sie<br />
weiß, was sie will, aber sie ist dabei relaxed. Nonchalant.«<br />
Eigenschaften, denen Thierry Gillier nicht widerstehen konnte,<br />
als er sie 2003 einstellte. Diese Schwedin sah eben verdammt gut aus,<br />
und binnen Kurzem entpuppte sie sich auch noch als Naturtalent für<br />
Mode und Design. Sie war wie geschaffen, um ihn ebenso wie sein<br />
Label zu umgarnen.<br />
Gillier hatte es schon 1997 gegründet. Ein logischer Schritt für<br />
den damals 38-jährigen Franzosen. So modisch vorbelastet,<br />
wie er ist (er stammt aus einer Strickwarenhersteller-Dynastie,<br />
die auch die Marke Lacoste mitbegründete), war eine Fashion-Karriere<br />
praktisch programmiert. Nach einem Studium an der Parsons School,<br />
der berühmten Designer-Schmiede in New York, arbeitete er unter<br />
anderem für Thierry Mugler und Yves Saint Laurent.<br />
Deren große Zeit als namhafte Couturiers begann Anfang der neunziger<br />
Jahre abzulaufen. Gillier hatte das früh erkannt, sich längst neuen<br />
Aufgaben zugewandt und mehrere Mode-Läden eröffnet, in denen es<br />
verschiedene Marken zu kaufen gab. Aus der Zusammenarbeit mit einem<br />
schottischen Kaschmirproduzenten entwickelte sich zuerst eine legere<br />
Pullover-Kollektion, die erweitert wurde und aus der das eigene Label<br />
entstand: Zadig & Voltaire.<br />
Wie um alles in der Welt ist er bloß auf diesen Namen gekommen?<br />
Kein Zufall, wohl eher Methode. Zadig ist der Titelheld eines Romans,<br />
den der französische Philosoph und Schriftsteller Voltaire 1747<br />
ver öffent lichte. Es ist die Geschichte eines jungen Mannes, der nach<br />
allerhand Verwicklungen dank himmlischer Fügung ein Happy End<br />
erfährt. Ihr Titel lautet »Zadig ou la destinée«, Zadig oder das Schicksal,<br />
die Bestimmung.<br />
Ganz im Sinne Voltaires steckt in dem Namen eine hintergründige<br />
Ironie, mit der Gillier seinen rebellischen Look damals auf den Mainstream<br />
losgelassen hat. Ob er damit Erfolg haben würde oder nicht …<br />
Schicksal eben!<br />
Ein bisschen Hasardeur: das darf ’s schon sein für ihn – auch wenn<br />
er seine umfangreiche Sammlung zeitgenössischer Kunst mit einer Neuerwerbung<br />
vergrößert. »Ich muss immer etwas zu weit gehen«, sagte<br />
er einmal in einem Interview über seinen Mut als Käufer und Sammler.<br />
Und fügte zum besseren Vergleich einen Nachsatz hinzu: »Genau wie<br />
bei der Arbeit, wie im Beruf.«<br />
This is him. So ist er. Einer der wagt, um zu gewinnen. Diese Aura<br />
unterstreicht nun ein Herrenduft gleichen Namens mit Auszügen aus<br />
Grapefruit, Pfeffer, Weihrauch, Sandelholz und Vanille. Es ist eine<br />
Komposition der Parfümeure Nathalie Larson und Aurelien Guichard.<br />
»This is him« oder »This is her« eignen sich übrigens hin wie her zum<br />
Mixen. »Sie harmonieren absolut perfekt miteinander«, beschreibt<br />
Cecilia Bönström die Eaux de Toilette.<br />
So wie dieses Powerpaar, das sich gesucht und gefunden zu haben<br />
scheint. Zwanzig Jahre nach der Markengründung führt es ein Firmenimperium<br />
mit Kollektionen für Damen, Herren und Kinder, unterhält<br />
dreihundert Boutiquen in vierundzwanzig Ländern der Welt und zählt<br />
zu den hundert reichsten Familien Frankreichs.<br />
Wer sein Label Zadig nennt, kann dem Schicksal eben vertrauen.<br />
Stand doch schon bei Voltaire.<br />
Die Entwürfe des<br />
französischen Rock-<br />
Chic-Labels Zadig &<br />
Voltaire vereinen<br />
immer einen Hauch<br />
Grunge mit einer Prise<br />
Rock’n’Roll und einem<br />
Touch Pariser Chic.<br />
<strong>DAS</strong> <strong>MAGAZIN</strong> <strong>FÜR</strong> <strong>GENUSS</strong> <strong>UND</strong> <strong>LEBENSSTIL</strong> <strong>FINE</strong> 1 | 2017 27
KARATE-KOSMETIK<br />
Wie zwei Tänzerinnen in Beauty-Mission ein Schönheitsserum in den Markt boxen<br />
Von ANGELIKA RICARD-WOLF<br />
»Stark, unterhaltsam, großartig«. Jason Sutton ist vom Werbeclip für das Gesichtspflegeserum<br />
»Ultimune Power Infusion Concentrate« von Shiseido total begeistert. Dabei vergisst<br />
der renommierte Fotograf und Regisseur vor lauter Enthusiasmus vollkommen sein<br />
angeborenes britisches Understatement – den Spot hat er nämlich selbst gedreht.<br />
Aber der Mann hat ja Recht. Es ist wirklich außergewöhnlich,<br />
was er da als Werbung für ein Kosmetikprodukt<br />
zur Immunstärkung der Haut wortwörtlich<br />
auf die Beine gestellt hat.<br />
Es sind deren vier, und sie gehören den beiden Japanerinnen<br />
Aya Sato und Bambi Naka. Unter dem Namen<br />
»Ayabambi« genießen die beiden wegen ihres einzigartigen<br />
Tanzstils in der Musik- und Fashionszene Kultstatus.<br />
Bands engagieren sie für ihre Video-Clips, Modemacher<br />
für ihre Kampagnen und Schauen, Madonna holt sie<br />
als Showact zu sich auf die Bühne. Doch für Shiseido und<br />
unter Suttons Obhut tanzen sie auch mal dreißig Sekunden<br />
aus der Reihe, um der Power eines Wirkstoffkonzentrats<br />
Ausdruck zu verleihen.<br />
Alles Eurhythmie oder was? Weit gefehlt. Hier geht<br />
es in Kung-Fu-Manier zur Sache. Der Schwarz-Weiß-Clip<br />
besticht mit Scherenschnitt-Optik und rasanten Cuts, die<br />
perfekt zum atemraubenden Bewegungsablauf passen,<br />
den Aya und Bambi aufs Studioparkett legen. Jede Bewegung<br />
sitzt. Abgezirkelt, exakt, im Sekundentakt. Das Ganze<br />
mal zwei, immer synchron! Rhythmik in Perfektion ist das<br />
Marken zeichen des Duos. Dass die beiden ihre Namen zu<br />
einem verschmolzen haben, spiegelt ihre Verbundenheit.<br />
Im Privat leben wie auf der Bühne.<br />
Die zwei jungen Frauen aus Yokohama, die sich zufällig<br />
beim Vortanzen kennenlernten, sind seit drei Jahren ein<br />
Paar und seit zwei Jahren absolute Stars auf Youtube. Ihre<br />
Clips werden millionenfach geklickt. Was an ihrer prägnanten<br />
Performance liegt. Sie ist vom Voguing beeinflusst,<br />
einer streng linearen Tanzform mit rechtwinkligen Arm-<br />
Ungeschützt ist zarte Haut den Unbilden der Umwelt ausgesetzt, Ultimune<br />
von Shiseido wehrt die täglichen Attacken unbezwingbar wie mit Kampfhandschuhen<br />
ab.<br />
und Beinbewegungen, die in der Subkultur der Ballrooms<br />
im New Yorker Stadtteil Harlem in den achtziger Jahren<br />
entstand. Zusammen mit Tutting, dem Street- Dance- Stil<br />
der Funk- und Hip-Hop-Tänzer und Industrial-Gothic-<br />
Einflüssen ergeben sich daraus faszinierende Bewegungsabläufe,<br />
die so schnell aufeinander folgen, als wären sie im<br />
Zeitraffer gedreht.<br />
Der »Ultimune«-Auftritt bedient sich dieser Elemente,<br />
ist so elegant wie kraftvoll und zusätzlich von Karate- und<br />
Kung-Fu-Anleihen geprägt, die Ayabambi voller Absicht<br />
eingebaut hat. Sinnbildlich dienen die Kampfsportbewegungen<br />
als schlagender Beweis für die Selbstverteidigung,<br />
zu der »Ultimune« der Haut mit einem ausgeklügelten<br />
Wirkstoffomplex verhelfen soll. Dahinter verbirgt<br />
sich ein Mix aus Ginkgo-Biloba-Blattextrakt, Perilla, einem<br />
Sesamblatt und wildem Thymian, dazu ausersehen, die<br />
Langerhans-Zellen in der Haut zu animieren, ihre Abwehrkräfte<br />
zu stärken und die Barriereschutzfunktion der Haut<br />
zu verbessern.<br />
Ein Serum mit – wenn auch avantgardistisch verpackter<br />
– Martial Art in den Markt zu pushen, ist mehr als ungewöhnlich.<br />
Macht aber Sinn. Oder ist es vielleicht nicht die<br />
Haut und gerade die ungeschützte im Gesicht, die sich gegen<br />
Wind, Regen, UV-Strahlen, Smog und andere Umwelteinflüsse<br />
verteidigen, sich quasi durchs Leben boxen muss?<br />
Eben.<br />
Eine Message, die Aya Sato und Bambi Naka mit ihrer<br />
ausdrucksstarken Körpersprache in bewegte Bilder<br />
übersetzen. Shiseido bricht mit diesem Spot bewusst<br />
die klassischen Codes der Kosmetikwerbung, auch um eine<br />
jüngere Zielgruppe anzusprechen. Dennoch hat Regisseur<br />
Sutton darauf geachtet, traditionelle japanische Kulturelemente<br />
subtil in den Film einzuarbeiten. Die weiß gekalkten<br />
Gesichter und die ausdrucksvoll schwarz umrahmten<br />
Augen der beiden Tänzerinnen sind eine gekonnte<br />
Mischung aus überkommener Kabuki-Ästhetik und modernem<br />
Gothic-Look. Trotz dieses grafisch wirkenden Makeups<br />
entsprechen die Protagonistinnen noch der japanischen<br />
Idealvorstellung von einer jungen Frau. Sie sehen<br />
»kawaii« aus, was man mit »süß« übersetzen könnte. Ihre<br />
Outfits sind zwar aus Leder und erinnern an die Kluft der<br />
Samurai, doch sie wirken dank zarter Schleier schwerelos.<br />
Wie der rasant durchchoreografierte Tanz von Aya<br />
Sato und Bambi Naka. Schließlich hatten sich die Zwei in<br />
bester Samurai-Pflichterfüllung auf den Dreh vorbereitet –<br />
mit jeder Menge Karate-Videos.<br />
Fotos: Shiseido<br />
28 <strong>FINE</strong> 1 | 2017 <strong>DAS</strong> <strong>MAGAZIN</strong> <strong>FÜR</strong> <strong>GENUSS</strong> <strong>UND</strong> <strong>LEBENSSTIL</strong>
DER KLEINE JOHNSON<br />
Nr. 1-Bestseller<br />
unter den Weinguides<br />
Seit 40 Jahren liefert der weltweit<br />
meistverkaufte Weinführer<br />
Genießern, Weinkennern und<br />
denen, die es werden wollen,<br />
ausführliche Informationen<br />
zu über 15.000 Weinen, Jahrgängen,<br />
Winzern und aktuellen<br />
Weinthemen.<br />
19,99 € [D]/20,60 € [A]<br />
ISBN 978-3-8338-5721-8<br />
www.hallwag.de
DIE VERTEUFELUN<br />
Weinkritiker Stuart Pigott findet dumm und falsch, Fehltöne im Wein als Zeichen von<br />
Drehen wir die Uhr ein paar Jahre zurück,<br />
in die hellen, modernen Räumlichkeiten der<br />
Weinhandlung Kössler & Ulbricht in Nürnberg.<br />
Martin Kössler hatte eine Gruppe von<br />
Stammkunden vor sich und war sichtbar gut<br />
gelaunt. Er strahlte ein souveränes Selbstvertrauen<br />
aus. Das machte seine Worte umso<br />
überraschender und schockierender für mich.<br />
Er sprach plötzlich von der »übertriebenen<br />
Sauberkeit der Weine von Weingütern wie<br />
Robert Weil im Rheingau und Dönnhoff<br />
an der Nahe«. Ich gab Kontra, doch solche<br />
Stimmen wurden immer zahlreicher, in manchen<br />
Kreisen haben sie eine gewisse Selbstverständlichkeit<br />
erlangt. Warum ist das so?<br />
Gehen wir der Sache auf den Grund.<br />
Nicht umsonst wird Deutschland weltweit mit Sauberkeit<br />
und Ordnung assoziiert, obgleich hier heute<br />
endlich alles etwas weniger Sagrotan-süchtig wirkt<br />
und deutlich mehr kreatives Chaos wachsen darf. Meine<br />
ersten Eindrücke von Westdeutschland bekam ich Mitte der<br />
1970er-Jahre in der Chemiestadt Ludwigshafen am Rhein,<br />
und selbst die waren von allgegenwärtiger Sauberkeit und<br />
Ordnung geprägt. Damals habe ich auch zum ersten Mal<br />
deutschen Wein getrunken – vor allem Pfälzer Riesling und<br />
Müller-Thurgau –, und der frische, klare und frucht betonte<br />
Geschmack passte zu meinem allgemeinen Eindruck.<br />
Als ich Anfang der 1980er-Jahre begann, mich in den<br />
deutschen Wein richtig zu vertiefen, begriff ich die Kernprobleme<br />
des Weinbaus hierzulande. In der damaligen<br />
klimatischen Situation war es unmöglich, in Deutschland<br />
regel mäßig gute Weine zu erzeugen. Ich weine den<br />
dünnen, grünen und sauren Weinen aus den unreifen Jahrgängen<br />
1977, 1978, 1980 und 1984 keine Träne nach. Hinzu<br />
kamen die oft üppigen Erträge (Stichwort chemischer<br />
Stickstoffdünger) und die nachlässige Weinbergspflege,<br />
die zu Fäulnis und dadurch zu unsauberen Weinen führte.<br />
Im Keller wurden die Weine dann verarztet. Mithilfe von<br />
Schönungs mitteln bekam man sie zwar sauber, doch das<br />
nahm ihnen oft auch den letzten Rest an positiven Aromen.<br />
Das Ziel der guten Winzer bestand verständlicherweise<br />
in möglichst reifen Trauben und wenig korrektiven Eingriffen<br />
im Wein.<br />
Inzwischen ist das Problem unsauberer Weine dank<br />
besserer Arbeit im Weinberg – die wichtigste Errungenschaft<br />
der Geisenheimer und anderer deutscher Weinbauschulen!<br />
– weitgehend gelöst. Wie der Jahrgang 2014<br />
gezeigt hat, entfernen sämtliche guten deutschen Winzer<br />
bei Fäulnis problemen die betroffenen Trauben durch<br />
aufwendige Selektionen während der Lese. Das erhöht<br />
die Kosten und reduziert die Erntemenge, führt aber fast<br />
immer zu sauberen Weinen, die sich mit Freude trinken lassen.<br />
Und dank der Klimaerwärmung werden die Trauben<br />
jedes Jahr mehr oder minder reif. Dies und der enorm gestiegene<br />
Ehrgeiz der Winzer sind die Hauptgründe, warum der<br />
deutsche Wein im internationalen Vergleich inzwischen so<br />
gut positio niert ist.<br />
Zugleich hat eine Revolution in der Keller technik stattgefunden,<br />
die weltweit zu einem großen Qualitätssprung<br />
bei günstigen Alltagsweinen führte. Wie<br />
Jancis Robinson gern bemerkt: »Noch nie war der Unterschied<br />
in der Qualität zwischen den einfachsten und den<br />
besten Weinen so gering.« Richtig schlechte Weine gibt<br />
es nur noch selten, und der Hauptgrund dafür ist menschliches<br />
Versagen (etwa nicht korrekt gereinigte Schläuche<br />
oder Geräte im Keller). Die Weine im Supermarktregal<br />
sind zwar oft banal, aber sie sind trotzdem frisch, klar und<br />
fruchtbetont. Auch gesellschaftliche Trends tragen zu der<br />
steigenden Popularität des Weins in vielen Ländern bei.<br />
Spontangärung des Weins ist nie<br />
ohne Risiko. Aber im Keller von<br />
Moselwinzer Joh. Jos. Prüm und<br />
anderen führt sie zu wunder bar<br />
filigranen Rieslingen.<br />
Foto: Guido Bittner<br />
30 <strong>FINE</strong> 1 | 2017 <strong>DAS</strong> <strong>MAGAZIN</strong> <strong>FÜR</strong> <strong>GENUSS</strong> <strong>UND</strong> <strong>LEBENSSTIL</strong>
G DER REINHEIT<br />
Authentizität zu werten.<br />
Eine bestimmte Gruppe in der internationalen Weinszene<br />
hingegen hat darauf konträr reagiert, hat »frisch, klar und<br />
fruchtbetont« mit industrieller Produktion gleichgestellt<br />
und diesen Weintypus deswegen regelrecht verteufelt.<br />
Hier liegt der Ursprung der »Natural«-Wein- Bewegung,<br />
die sich massiv in die entgegensetzte Richtung bewegt,<br />
möglichst weit weg von moderner Technik. Auf der einen<br />
Seite sind dadurch einige sehr originelle Gewächse entstanden,<br />
und die stilis tische Vielfalt des Weins hat sich deutlich<br />
vergrößert. Auf der anderen Seite stehen Weine mit<br />
klassischen Weinfehlern, also Weine, die den alten »Weinschmutz«<br />
zurückbringen. In der »Natural«-Weinszene wird<br />
dies allerdings gern als Zeichen von Authentizität gefeiert.<br />
Die Anhänger dieser Bewegung neigen dazu, solche<br />
Töne als natürlich und daher unantastbar zu betrachten,<br />
was zu einer tendenziell unkritischen Haltung gegenüber<br />
den betreffenden kellerwirtschaftlichen Problemen führt:<br />
Diese Gewächse gelten gerade deswegen als cool, weil sie<br />
nicht klar, frisch und fruchtbetont schmecken.<br />
Eine deutlich abgemilderte Variante dieser Tendenz<br />
stellt die Verherrlichung der Spontan gärung dar,<br />
einer Gärung ohne zugesetzte gezüchtete Hefen.<br />
Diese Reinzuchthefen werden von einem beachtlichen<br />
Teil der Weinszene als neue und industrielle Mittel verteufelt,<br />
obwohl sie bereits im späten 19. Jahrhundert vor<br />
der Industrialisierung des Weinbaus zum Einsatz kamen.<br />
Eine gelungene Spontangärung in einem Keller, in<br />
dem erstklassige Trauben sauber ver arbeitet werden, ist<br />
eine wunderbare Sache, wie etwa die Weine der Betriebe<br />
Joh. Jos. Prüm in Bernkastel-Wehlen/Mosel, Zehnthof<br />
Luckert in Sulzfeld/Franken oder Koehler-Ruprecht in Kallstadt/Pfalz<br />
beweisen. Die Jungweine aus diesen Gütern zeigen<br />
eine ziemlich konstante hefige Note, die einen wichtigen<br />
Bestandteil ihrer besonderen Persönlichkeit darstellt.<br />
Solche höchst eigenständigen Weine sind in ihrer Jugend<br />
nicht einfach zu verstehen, machen sich aber großartig<br />
auf der Flasche.<br />
Viele »Sponti«-Verfechter suchen hände ringend nach<br />
dem Sponti-Ton im Wein, also einer mehr oder weniger<br />
stinkigen sulfidischen Note. Sie beruht auf gestressten Hefen,<br />
die sich langsam und schwächelnd durch die Gärung quälen.<br />
Für manche Weintypen ist genau dies der ideale Gärverlauf,<br />
wie das Beispiel der restsüßen Rieslinge vom Weingut Joh.<br />
Jos. Prüm zeigt; es handelt sich um die filigransten deutschen<br />
Rieslinge überhaupt mit immenser Lagerfähigkeit.<br />
Aber genau wie manche »Natural«-Weine unharmonisch<br />
(vor allem zu tanninlastig) wirken, kann eine Sponti-Note<br />
zu dominant sein. Das passiert, wenn sich ein bösartiger<br />
Hefestamm durchsetzt, und wird noch verstärkt, wenn<br />
fäulnisbefallene Trauben im Spiel sind. Ein Wein, der aufdringlich<br />
nach verbranntem Gummi riecht, bereitet keine<br />
Freude. Doch offenbar suchen manche nach genau solchen<br />
Tönen in mehr oder weniger ausgeprägter Form.<br />
Dies sind zusammengefasst die unmittel baren Hintergründe<br />
zu Äußerungen wie jener eingangs zitierten von<br />
Martin Kössler. Seine Worte klingen allerdings richtig<br />
milde im Vergleich zu dem, was heute kursiert. Weingüter<br />
wie Robert Weil und Dönnhoff werden inzwischen<br />
von manchen gnadenlos in die Pfanne gehauen, weil ihre<br />
Weine, »too clean,« zu sauber, sind! Aus der verständlichen<br />
Suche nach Weinen, die in Weinberg und Keller<br />
weniger mani puliert werden, sind dogmatische Wein-<br />
Weltanschauungen entstanden, die schon missionarisch<br />
eifernde Züge tragen.<br />
Problematisch wird es meiner Meinung nach, wenn<br />
die Dogmatiker grundsätzlich von allen Winzern<br />
die gleiche »puristische« Arbeitsweise einfordern,<br />
wenn sich alle ständig einigen simplen Regeln unterordnen<br />
sollen. Die Besonder heiten spezieller Weinbauorte und die<br />
genetischen Eigenarten bestimmter Rebsorten werden<br />
dabei komplett ignoriert, weil sie alles viel zu kompliziert<br />
machen würden und damit dem zwang haften Streben nach<br />
einer moralisch ein fachen Welt im Weg stehen.<br />
Ein Teil der Weinszene hat das Prinzip der Toleranz<br />
für diverse Weinstile und des Respekts für unterschiedliche<br />
Geschmäcker schon auf gegeben und damit einen grundsätzlichen<br />
Aspekt der Demokratie. Es mag sein, dass dies<br />
nicht bewusst vorangetrieben wurde, aber wenn bestimmte<br />
Weine nicht nur technisch als richtig oder falsch bewertet<br />
werden, sondern eine moralische Dimension hinzukommt,<br />
dann spielt es eigentlich keine Rolle, wie man<br />
dahin gekommen ist.<br />
Betrachten wir die Weingüter Robert Weil und Dönnhoff,<br />
die besonders häufig angegriffen werden, etwas genauer, um<br />
zu sehen, wie das alles konkret funktioniert. Als ich 1986<br />
das Weingut Robert Weil zum ersten Mal besuchte, war es<br />
ein eher kleiner Familienbetrieb. Wenig später wurde es<br />
vom Getränkekonzern Suntory übernommen, bis heute<br />
Hauptaktionär, mit Robert Weils Sohn Wilhelm als Direktor.<br />
Das Gut ist inzwischen auf neunzig Hektar angewachsen<br />
und produziert allein vom trocknen Gutsriesling jährlich<br />
mehrere hunderttausend Flaschen.<br />
Damit sind bereits einige Punkte genannt, die häufig<br />
als »Industrialisierung« dargestellt werden.<br />
Trotzdem schmecke ich erhebliche Unterschiede<br />
zwischen den Jahrgängen der Weil-Weine; die 2013er<br />
Kollektion etwa fand ich allgemein sehr gut balanciert<br />
und strahlend in ihrer Art. Die Lagenweine sind außerdem<br />
immer ganz klar erkennbar, und mir persönlich gefallen<br />
die rassigen, schlanken Weine aus dem Turmberg mit ihrer<br />
an weiße Pfirsiche erinnernden Note besonders gut. Das<br />
ist nicht gerade das, was ich unter Gleichmacherei oder<br />
Nivellierung verstehe.<br />
Dass mir gelegentlich Weine aus anderen, kleineren<br />
Rheingauer Gütern wie Eva Fricke in Eltville, Fred Prinz<br />
in Hallgarten oder Peter Jakob Kühn in Oestrich noch<br />
besser gefallen, ändert daran nichts. Keiner dieser drei<br />
Betriebe ist ein »deutsches Riesling- Château« mit globaler<br />
Aus strahlung, wie ein Kollege mir gegenüber das<br />
Weingut Robert Weil nach dem letzten großen Umbau<br />
beschrieb. Wer das Gut herunterredet, lehnt es auch aus<br />
irgend welchen politischen und/oder moralischen Gründen<br />
ab und lässt sich in seiner Argumentation von selektiver<br />
Wahrnehmung leiten.<br />
Bei dem echten Familienweingut H. Dönnhoff wird das<br />
alles noch krasser. Auch hier ist man in den letzten zwanzig<br />
Jahren auf fünfundzwanzig Hektar und somit kräftig gewachsen.<br />
Aber der allgemeine Stimmungsumschwung mancher<br />
Kreise scheint mehr mit dem Generations wechsel von<br />
Helmut Dönnhoff auf seinen Sohn Cornelius zu tun zu haben.<br />
Der anfangs schüchterne Cornelius wurde zur Projektionsfläche<br />
manch paranoider Fantasien in der Weinszene, für<br />
die auf den märchenhaften Aufstieg (Helmut) zwangs läufig<br />
der Untergang (Cornelius) folgt.<br />
Cornelius mache die Weine zu weich und zu voluminös,<br />
habe ich oft gehört, obwohl diese Veränderung viel eher<br />
auf der Klimaerwärmung beruht. Darauf folgt dann häufig:<br />
»Und die Weine sind viel zu clean.« Was bedeutet: Sie passen<br />
definitiv nicht in die Kategorie der »Natural«-Weine,<br />
haben meist auch nicht einmal die gesuchte Sponti-Note<br />
zu bieten. Dieses Gerede begann, als die Jahrgänge 2011<br />
und 2012 auf den Markt kamen und sich herumsprach,<br />
dass Cornelius Dönnhoff die Keller arbeit übernommen<br />
hatte. Häufig wurden die Dönnhoff- Rieslinge der Jahrgänge<br />
2008 und 2010 als schlanke, mineralische »Helmut-Weine«<br />
gelobt, während die üppigeren Rieslinge aus 2011 und 2012<br />
als »Cornelius- Weine« geschmäht wurden. In Wahrheit<br />
sind aber alle waschechte »Cornelius- Weine«, weil der<br />
schon 2007 die Kellerarbeit übernommen hat!<br />
Vor einigen Monate fand eine Vertikalprobe der<br />
trocknen und restsüßen Dönnhoff- Rieslinge in der<br />
Cordobar in Berlin statt. Als die Großen Gewächse<br />
aus den Lagen Hermannshöhle und Felsenberg der Jahrgänge<br />
2010 bis 2014 begutachtet wurden, zehn strahlende,<br />
filigrane, trockne Rieslinge, kam das Gespräch auf die<br />
besondere Weinstilistik des Hauses. Alle Anwesenden<br />
waren begeistert von der klaren Art der Weine, bis jemand<br />
bemerkte, dass es diesbezüglich wohl Gegenstimmen gebe.<br />
Bei Cornelius Dönnhoff, der diese Stilistik von seinem<br />
Vater übernommen hat, traf dies offensichtlich einen Nerv.<br />
»Ich glaube, dass die Klarheit unserer Weine mit der<br />
Geschwindigkeit zu tun hat, mit der wir die Trauben verarbeiten«,<br />
erklärte er, »wir wollen unbedingt diese Klarheit<br />
und arbeiten gezielt darauf hin. Wir machen die Weine so,<br />
wie wir glauben, dass sie schmecken sollen.« Und genau<br />
das ist es, was das Ziel jedes begabten Winzers sein sollte,<br />
welche Stilistik er auch immer anstrebt. Nur so entstehen<br />
Spitzenweine. Und bestimmt nicht durch Dogmen.<br />
<strong>DAS</strong> <strong>MAGAZIN</strong> <strong>FÜR</strong> <strong>GENUSS</strong> <strong>UND</strong> <strong>LEBENSSTIL</strong> <strong>FINE</strong> 1 | 2017 31
DER KALTE KRIEG,<br />
FRANKREICHS BAUERN <strong>UND</strong><br />
<strong>DAS</strong> DEUTSCHE<br />
KÜCHENW<strong>UND</strong>ER<br />
Vor sechzig Jahren wurden die Römischen Verträge ratifiziert: Der 25. März 1957, der den Beginn der<br />
Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft markiert, ist nicht zuletzt auch für Feinschmecker ein denkwürdiger<br />
Tag. Dank der »Gemeinsamen Agrarpolitik« fanden von da an landwirtschaftliche Produkte<br />
aus Frankreich immer mehr den Weg ins Wirtschaftswunder-Deutschland. Was für unsere kulinarische<br />
Bildung zunächst ein Segen war, hatte aber auch fatale Folgen.<br />
Von STEFAN PEGATZKY<br />
Foto: Rainer Zenz via Wikimedia Commons<br />
Am Anfang war der Hunger. Nachdem Nazi-Deutschland besiegt war<br />
und die Alliierten das Land in Besatzungszonen aufgeteilt hatten,<br />
brach die Versorgung zusammen. Am schlimmsten war es im Frühsommer<br />
1947, als die Frühkartoffelernte wegen mangelhaftem Saatgut<br />
ausfiel und lang erwartete Weizenimporte ausblieben. Selbst in<br />
den letzten Kriegswochen hatte ein passabler Ernährungs standard<br />
aufrechterhalten werden können. Nun fiel der Kalorienspiegel pro<br />
Person mancherorts unter tausend – etwa die Hälfte der durchschnittlich<br />
benötigten Tagesration und deutlich unter der Grenze<br />
zu extremer Unterernährung. Die Menschen sammelten Bucheckern<br />
im Wald oder kochten Wassersuppe aus Kartoffelschalen,<br />
sofern sie welche finden konnten. Erst 1952 sollte sich die Nahrungsmittel<br />
situation in Westdeutschland normalisieren. Der Hunger verschwand,<br />
das Trauma blieb.<br />
32 <strong>FINE</strong> 1 | 2017 <strong>DAS</strong> <strong>MAGAZIN</strong> <strong>FÜR</strong> <strong>GENUSS</strong> <strong>UND</strong> <strong>LEBENSSTIL</strong>
Fotos: Französische Kochkunst – von den großen Meistern der Küche. Genf: H. Studer S. A. 1953 Foto: Hedwig Maria Stuber: Ich helf dir kochen – was allen schmeckt.<br />
Die Normalisierung war auch der weltpolitischen<br />
Situation geschuldet. Unmittelbar nach Ende des<br />
Krieges war Deutschland zwar besiegt, aber immer<br />
noch »Feindstaat« und wurde entsprechend behandelt.<br />
Doch die beginnende Blockbildung gegen die UdSSR, aber<br />
auch die Einsicht, dass das besiegte Deutschland nur als<br />
ein gebundener Partner zu kontrollieren sei, änderte die<br />
Perspektive. Ab 1947 begann die eigentliche Arbeit an der<br />
europäischen Integration, die sowohl auf die Verhinderung<br />
einer erneuten Vormachtstellung Deutschlands als auch<br />
auf die Eindämmung der sowjetischen Aggression zielte.<br />
Erster Meilenstein auf diesem Weg war 1951 die Montanunion,<br />
der gemeinsame Markt für die kriegs wichtigen<br />
Schlüssel industrien Kohle und Stahl. Diese von Frankreich<br />
aus gehende Initiative bot den ehemaligen Kriegs gegnern<br />
eine Win-Win-Situation: Sie verhinderte ein erneutes Aufrüsten<br />
Deutschlands – und ermöglichte dem noch unter<br />
inter nationaler Kontrolle stehendem Ruhrgebiet einen<br />
wirtschaftlichen Neubeginn.<br />
Die Erinnerung an die Missernten von 1947 war der<br />
Grund, warum zur gleichen Zeit auch über einen gemeinsamen<br />
europäischen Wirtschaftsraum für Agrar erzeugnisse,<br />
den »Pool Vert«, nachgedacht wurde. Tatsächlich war die<br />
Versorgung der Bevölkerung nach dem Zweiten Weltkrieg<br />
auch in Frankreich problematisch gewesen und konnte<br />
nur durch Lebensmittelversorgungen der Amerikaner<br />
sicher gestellt werden. Die aber ließen sich diese Hilfe in<br />
harten Dollar bezahlen, wodurch Mittel für den Ankauf<br />
dringend benötigter Investitionsgüter fehlten und das chronische<br />
Zahlungs bilanzdefizit Frankreichs noch vergrößert<br />
wurde. Nach Beginn des Koreakrieges drängten zudem<br />
die Vereinigten Staaten ihre europäischen Bündnis partner,<br />
eine Selbstversorgung zu erreichen, da im Kriegsfall die<br />
Transport kapazitäten für Nahrungsmittel nicht ausreichen<br />
würden. So setzte sich in Paris die Erkenntnis durch, dass<br />
die Situation nur durch eine dramatische Intensivierung der<br />
Produktion und die Erschließung neuer Exportmärkte gelöst<br />
werden konnte – vor allem in die junge Bundes republik,<br />
wo der wirtschaftliche Aufschwung mächtig Fahrt aufnahm.<br />
Was die Montanunion für die deutsche Wirtschaft war, sollte<br />
der gemeinsame Agrarmarkt für die französische sein.<br />
Für die Grande Nation waren das völlig neue Überlegungen.<br />
Das ländliche, agrarisch geprägte Frankreich<br />
mit seinen kleinen Familienbetrieben bildete den innersten<br />
Kern der nationalen Identität des Landes, die »France<br />
profonde«, die ganz unabhängig von Paris und dessen<br />
intellektuellen Debatten existierte. Der Herzog von Sully<br />
hatte im 16. Jahrhundert das Wort geprägt, wonach »Ackerbau<br />
und Viehzucht die beiden nährenden Brüste Frankreichs«<br />
– les deux mamelles de France – seien. Und daran<br />
hatte sich bis ins 20. Jahrhundert nicht viel geändert. Um<br />
1950 arbeiteten noch immer circa dreißig Prozent der französischen<br />
Erwerbstätigen in der Landwirtschaft, wogegen<br />
es in Deutschland zwanzig und in den Niederlanden nur<br />
dreizehn Prozent waren. Die aber waren, worauf warnende<br />
Stimmen seit Jahrzehnten hingewiesen hatten, wesentlich<br />
produktiver, von Farmern in Übersee, in den USA, Argentinien<br />
oder Neuseeland ganz zu schweigen.<br />
Darauf brauchte man lange Zeit keine Rücksicht zu<br />
nehmen, weil Frankreichs Agrarwirtschaft in einen romantischen,<br />
fast sakralen Nebel gehüllt war. Die »Vocation<br />
Agricole de la France«, die göttliche Berufung der französischen<br />
Landwirtschaft, galt als eine der wesentlichen Stützpfeiler<br />
der sprichwörtlichen Grandeur unseres Nachbarlandes.<br />
Soviel nationaler Chauvinismus diesen Mythos<br />
auch beflügelt haben mag – völlig grundlos war er nicht.<br />
Denn in Frankreich hatte sich mit der Erfindung der Haute<br />
Cuisine am Hofe von Versailles ein wichtiger Schritt im Prozess<br />
unserer Zivilisation vollzogen. 1654 hatte Nicolas de<br />
Bonnefons in seinem Buch »Les délices de la campagne«<br />
das grundlegende Prinzip der modernen Kulinarik formuliert:<br />
»Es muss, so sage ich, die Kohlsuppe nach Kohl schmecken,<br />
die Lauchsuppe nach Lauch, die Rübchen suppe nach<br />
Rübchen und so fort … Und was ich über die Suppe sage,<br />
muss allgemein gelten und als Gesetz für alles, was man isst.«<br />
Das war ein Bruch mit den Kochtraditionen des Mittelalters,<br />
wo jeder Eigengeschmack bis zur Unkenntlichkeit<br />
überdeckt worden war. Und mehr noch: Mit der Ent deckung<br />
des Eigengeschmacks eines Produktes hatte Bonnefons die<br />
Lebensmittel von ihrer reinen Ernährungsfunktion emanzipiert.<br />
Hinter ihn trat selbst die feudale Rangordnung des<br />
Produkts (an der Spitze Adler oder Steinbock) oder die<br />
barocke Kuriositätensehnsucht (wie Pfauenpasteten) mehr<br />
und mehr zurück. Die neue Kategorie des Eigengeschmacks<br />
bildete von nun an die »Entwicklungsachse« ( Jean-Pierre<br />
Poulain) der Kulinaristik − von Marie-Antoine Carême<br />
über Jean Anthelme Brillat-Savarin und Auguste Escoffier,<br />
die zehn Gebote der »Nouvelle Cuisine« von Henri Gault<br />
und Christian Millau bis hin zu Alain Ducasse. Von nun an<br />
beruhte die Raffinesse der französischen Küche auf dem<br />
Geschmack der Lebensmittel. Das machte sie, die sich im<br />
Prinzip bis dahin wenig von den Küchen ihrer Nachbarländer<br />
unterschieden hatte, einzigartig.<br />
Der Eigengeschmack bildete zugleich ein völlig neues<br />
Beurteilungssystem für die Produkte der höfischen<br />
Lieferanten. Hatte man zuvor allenfalls über die<br />
Verbindung von Herkunft und Geschmack bei Wein und<br />
Käse diskutiert, so wird von nun an in der französischen<br />
Literatur mit Leidenschaft auch über die Herkunft der besten<br />
Masthühner oder Austern gestritten. Die Bauern richten<br />
sich nach den neuen Anforderungen der hohen Herren –<br />
und nicht nur im Umkreis der Krone. Denn von Versailles<br />
aus, dem Zentrum des barocken Absolutismus, schwappt die<br />
neue Mode, wie alles, was am Hof der Bourbonen erdacht<br />
wird, in konzentrischen Kreisen an all die kleineren Höfe<br />
der Provinzen. So entstand in vielen Regionen Frankreichs<br />
so etwas wie ein unsichtbarer Pakt zwischen Bauern und<br />
Gourmets – ein Pakt, der selbst die Revolution über dauerte,<br />
nach der die ehemaligen Leibköche der Aristokraten die<br />
ersten Restaurants eröffnen und die Gastronomie für das<br />
neue Bürgertum neu erfinden. Es entstand jenes französische<br />
»Savoir Vivre«, von dem Heinrich Heine in den Reisebildern<br />
schrieb: »Man lebt in lauter Lust und Pläsier, so<br />
recht wie Gott in Frankreich. Man speist von Morgen bis<br />
Abend, und die Küche ist so gut …«<br />
Das war in Deutschland anders. Hier herrschte kein<br />
sinnen froher Katholizismus, der das Essen heiligte, weil<br />
man sich in ihm etwas von der Substanz Gottes aneignete,<br />
sondern in weiten Teilen die Reformation. Welche Auswirkungen<br />
diese auf die deutsche Küche hatte, hat Peter in<br />
Armes Deutschland: Toast<br />
Hawaii, Sardellen-Ei, gefüllte<br />
Tomaten und »Fliegenpilze« –<br />
so zaghaft wagte die deutsche<br />
Kulinarik ihren Nachkriegsstart.<br />
Pariser Köche exzellierten schon<br />
mit Kreationen wie Galantine<br />
de Faisan, Poularde glacée<br />
und Langouste à la Parisienne.<br />
Glückliches Frankreich!<br />
<strong>DAS</strong> <strong>MAGAZIN</strong> <strong>FÜR</strong> <strong>GENUSS</strong> <strong>UND</strong> <strong>LEBENSSTIL</strong> <strong>FINE</strong> 1 | 2017 33
Der erste Fernsehkoch<br />
Frankreichs: Von 1954 an führte<br />
Küchenchef Raymond Oliver seine<br />
Zuschauerinnen viele Jahre lang<br />
in die Geheimnisse der Haute<br />
Cuisine ein. Er war zugleich Inhaber<br />
des Pariser Gourmet-Tempels<br />
»Le Grand Véfour« im Palais Royal.<br />
seiner »Kulturgeschichte der deutschen Küche« dar gestellt.<br />
Die »Freiheit des Christenmenschen« verwarf zwar die<br />
katholischen Fastengebote, aber gebot doch jedermann<br />
»mäßig, nüchtern und züchtig zu leben«. In der Sitte des<br />
bescheidenen Abendbrots wurde das Nachtmahl zur privaten<br />
Veranstaltung, Auswärtsessen galt als Verschwendung.<br />
Hausmannskost wurde zum Inbegriff der guten Küche, also<br />
das, was durch landwirtschaftliche Selbstversorgung hergestellt<br />
werden konnte. Auswärtige Delikatessen dagegen<br />
zeugten von Hochmut.<br />
Das reformatorische Ethos der Enthaltsamkeit wurde<br />
verstärkt durch die vielen Kriege auf deutschem<br />
Boden: die Bauernkriege, der Dreißig jährige<br />
Krieg, der Pfälzische Erbfolge- und der Siebenjährige<br />
Krieg, die Napoleonischen und die Deutschen Einigungskriege,<br />
ganz zu schweigen von denen, die danach kommen<br />
sollten. Es ist kein Wunder, dass diese Notzeiten auch bei<br />
den Eliten Vorstellungen von Entsagung und »strengem<br />
Glück« (Thomas Mann) formten, in denen wenig Platz<br />
für sinnliche Genüsse war. Schwäbischer Pietismus und<br />
an holländisch- calvinistischem Gedankengut inspiriertes<br />
preußisches Ethos werden Leitideologien Deutschlands<br />
auf dem Weg in die Moderne – mit entsprechendem Einfluss<br />
auf die deutsche Küche. Nur in einigen vom Katholizismus<br />
geprägten Regionen, zumeist in grenznahen Gebieten<br />
in West- und Süddeutschland, sowie in einigen prosperierenden,<br />
latent glaubensneutralen Handels- und See städten<br />
überlebt eine nennenswerte deutsche Küchenkultur.<br />
Beides, die permanente Drohung wirtschaftlicher Not<br />
wie die religiös grundierte Entsagungsethik hinterließ tiefe<br />
Spuren in der deutschen Landwirtschaft. Produziert wurden<br />
überwiegend Grundnahrungsmittel, ins besondere in den<br />
großen Gütern »Ostelbiens«. Mit der einen Ausnahme des<br />
Weinbaus vornehmlich im Mittel- und Ober rhein, die sich<br />
durch die Kleinbauernstruktur stark von den übrigen agrarischen<br />
Regionen in Deutschland unterschied und wo sich<br />
der Riesling als Leitrebe durchsetzen konnte, entschied<br />
man sich im Zweifelsfall für einfache und schnell zu produzierende<br />
Produkte in großen Volumina. Die Geflügelzucht<br />
in Deutschland etwa favorisierte traditionell die<br />
eier legenden Rassen, während in Frankreich die Vervollkommnung<br />
der aufwendiger zu haltenden Fleischrassen im<br />
Vordergrund stand. Ähnlich in der Rinderzucht: Hier standen<br />
die »Milchrassen« im Vordergrund, in Frankreich dagegen<br />
ebenfalls die Fleischrassen – was bis heute zur Folge<br />
hat, dass deutsche Schlachthöfe dem Verbraucher zumeist<br />
nur qualitativ deutlich schlechteres Jungbullenfleisch liefern,<br />
während in Frankreich besseres Färsen- und Ochsenfleisch<br />
von geeigneteren Rassen angeboten wird.<br />
Ungeachtet dieser Gegebenheiten stand auch in<br />
Deutschland die Agrarromantik in hohem Kurs. Der Dichter<br />
der Befreiungskriege, Ernst-Moritz Arndt, erblickte<br />
im Bauernstand den kraftvollen und sittlichen Urzustand<br />
des Menschen: Noch nicht entartet durch westliche Zivilisation<br />
und welschen Tand sei er der treueste Verteidiger<br />
des Vaterlandes – eine Ideologie, die noch in den Reden<br />
des Reichsbauernführers Walther Darré im Dritten Reich<br />
widerklingen sollte. Doch während Arndt vom Bauern als<br />
Damm gegen die Revolution und der eigentlichen Zukunft<br />
der deutschen Nation schwadronierte, hatte längst auch in<br />
der Landwirtschaft die Moderne begonnen.<br />
England hatte bereits im frühen 18. Jahrhundert mit<br />
dem High Farming begonnen, einer Vier-Felder-<br />
Wirtschaft ohne Brachen mit intensiver Düngung.<br />
Am Ende des Jahrhunderts begann dort zudem, ausgelöst<br />
nicht zuletzt durch den Bevölkerungsdruck der zunehmend<br />
industriell geprägten Gesellschaft, die moderne Nutztierzucht,<br />
in der in lokale Landschläge Rassen aus Fernost eingekreuzt<br />
wurden, um deren Leistungsfähigkeit zu erhöhen.<br />
Deutschland folgte mit deutlicher Verspätung und weniger in<br />
der Praxis als in der Theorie: Albrecht Daniel Thaers Lehre<br />
der »Rationellen Landwirtschaft« gilt als die Begründung<br />
der modernen Agrarwissenschaft. Dennoch fehlte hierzulande<br />
das, was im 19. und frühen 20. Jahrhundert etwa<br />
die Landwirtschaft von Dänemark und den Niederlanden<br />
so leistungsfähig machen sollte, die Verklammerung von<br />
Fachausbildung und landwirtschaftlicher Intensivierung.<br />
Seit 1880 erschienen in Deutschland erste Schriften zur<br />
»Krise der Landwirtschaft«. Tatsächlich wurden die heimischen<br />
Märkte immer stärker von massiven Exporten insbesondere<br />
aus Übersee bedroht, die Frage von Schutzzöllen<br />
beherrschte die Politik des jungen Deutschen Reiches und<br />
seiner europäischen Nachbarn. Zugleich führt der massive<br />
Arbeitskräfteabbau in der Landwirtschaft zur Verarmung<br />
weiter Teile der europäischen Landbevölkerung. Soziale<br />
Unruhen waren die Folge. In den Jahren der Weltwirtschaftskrise<br />
gelang es den politischen Parteien in vielen europäischen<br />
Ländern – nicht nur in Deutschland – nicht mehr,<br />
den sich zunehmend radikalisierenden Bauernstand an<br />
sich zu binden. Es waren diese Erfahrungen, die die jungen<br />
Demokratien Nachkriegseuropas – nicht nur in Deutschland,<br />
auch in Frankreich und Italien hatte es ja politische<br />
Systemwechsel gegeben – dazu bewegten, mit hohen Subventionen<br />
um die Loyalität besonders der ländlichen Bevölkerung<br />
zu werben, etwa indem der Einkommensindex an<br />
den der Industriearbeiterschaft gekoppelt wurde.<br />
Für das Frankreich der Vierten Republik, deren Politiker<br />
unablässig von der Landwirtschaft als dem zentralen<br />
nationalen Interesse des Landes sprachen, war also um<br />
1950 die Frage einer grundsätzlichen Neuorientierung der<br />
Agrarwirtschaft, möglichst im europäischen Rahmen, eine<br />
Frage des politischen Überlebens. Doch das Europa der<br />
Sechs, das sich in der Montanunion, der Europäischen<br />
Gemeinschaft für Kohle und Stahl, zu bilden begonnen<br />
hatte, verfügte über völlig unterschiedliche wirtschaftliche<br />
Zielsetzungen und Agrarsysteme. Die marktliberalen<br />
Nieder lande favorisierten für ihre hochmoderne, exportorientierte<br />
Landwirtschaft möglichst niedrige Zölle. In<br />
Frankreich war dagegen traditionell der Staat ein wesentlicher<br />
Akteur der Wirtschaftspolitik, der seinen Wirtschaftsraum<br />
durch hohe Zölle schützte. Italien war hingegen ein<br />
Fotos: alchetron.com/Raymond-Oliver-1360076-W<br />
Der erste Fernsehkoch Deutschlands:<br />
Er hatte nie Kochen gelernt. Clemens<br />
Wilmenrod war Schauspieler in prekärer<br />
Lage gewesen. Aber seit 1953 zeigte<br />
er elf Jahre lang in seiner populären<br />
TV-Sendung den deutschen Hausfrauen,<br />
dass das Improvisieren am<br />
Herd Teil der Kochkunst ist.<br />
Fotos: ullstein bild - Röhnert<br />
34 <strong>FINE</strong> 1 | 2017 <strong>DAS</strong> <strong>MAGAZIN</strong> <strong>FÜR</strong> <strong>GENUSS</strong> <strong>UND</strong> <strong>LEBENSSTIL</strong>
Fotos: ullstein bild – sobotha und ullstein bild<br />
Prachtschau der Agrarwirtschaft: Der<br />
Internationalen Grünen Woche 1957<br />
in Berlin macht auch Kanzler Konrad<br />
Adenauer seine Aufwartung, begrüßt<br />
vom »Regierenden« Otto Suhr und<br />
dem Präsidenten der Berliner Abgeordnetenkammer<br />
Willy Brandt. Landwirtschaft<br />
war jetzt Gegenstand<br />
hoher europäischer Politik.<br />
direkter Konkurrent, dem es vor allem um Mittel aus einem<br />
möglichen Investitionsfonds zur Entwicklung des rückständigen<br />
Südens und um Arbeitnehmerfreizügigkeit ging.<br />
Und Deutschland, der Erzfeind, neigte eigentlich der liberalen<br />
Position der Niederlande zu, wenngleich die existierenden<br />
heimischen Marktordnungen für Lebensmittel im<br />
Grunde protektionistischer Natur waren.<br />
Dass sich Belgien, Deutschland, Frankreich, Italien,<br />
Luxemburg und die Niederlande schließlich nach<br />
Jahren der Verhandlungen einigten, ist eine außerordentliche<br />
politische Leistung. Sie ist ohne den Hintergrund<br />
des Kalten Krieges und Ereignisse wie den Koreakrieg, die<br />
drohende Annäherung der Bundesrepublik an die UdSSR<br />
nach dem Besuch Adenauers in Moskau 1952, Frankreichs<br />
Verlust von Indochina 1954 und die Suezkrise von 1956<br />
undenkbar. Den führenden Politikern in Frankreich war klar<br />
geworden, dass die Nation keine Weltmacht mehr war und<br />
dass, um es mit de Gaulle zu sagen, die Geschichte Frankreich<br />
»die Ehe mit Deutschland« auf erlegt habe. Immerhin<br />
war es eine »Gemeinsame Agrar politik« nach französischem<br />
Modell: massiv subventioniert und dirigistisch.<br />
Adenauer glaubte für Deutschland an dieser Stelle nachgeben<br />
zu können, weil er längst die Weichen dafür gestellt<br />
sah, dass die Zukunft des Landes in der Industrie- und<br />
Dienstleistungsgesellschaft liegen würde. Und er wusste,<br />
dass der gemeinsame Markt ein entscheidender Meilenstein<br />
war auf dem Weg zur Wieder gewinnung der nationalen<br />
Souveränität.<br />
Die unmittelbaren Folgen für den deutschen Verbraucher<br />
waren hoch erfreulich. Frankreich gab sich erhebliche<br />
Mühe, Deutschland als Exportland für seine Agrarerzeugnisse<br />
und Lebensmittel zu erschließen. Dass dem<br />
Erfolg beschieden sein würde, war bei den unterschiedlichen<br />
Mentalitäten und der Vorgeschichte kaum abzusehen.<br />
Wo in unseren Breiten noch Bücher erschienen mit Titeln<br />
wie »Das Kochen mit knappen Mitteln« (1946), gründeten<br />
in Frankreich die führenden Gourmets ihrer Zeit die Zeitschrift<br />
»Cuisine et Vins de France« (1947). Einige Jahre<br />
später, 1953/54, trat im französischen Fernsehen Raymond<br />
Oliver als Fernsehkoch auf – zur gleichen Zeit wie bei uns<br />
Clemens Wilmenrod. Mit dem Unterschied, dass Oliver<br />
Chefkoch des mit drei Guide-Michelin-Sternen geadelten<br />
»Grand Véfour« in Paris war, Wilmenrod aber ein erfolgloser<br />
Schauspieler, der der Nachwelt so unsterbliche Rezepte<br />
wie den »Toast Hawaii« hinterlassen hat.<br />
Als es aber Anfang der 1960er-Jahre mit den ersten<br />
gemeinsamen europäischen Marktordnungen ernst wurde,<br />
verstärkte Frankreich seine Export-Anstrengungen. 1961 rief<br />
die Grande Nation die Sopexa ins Leben, die Gesellschaft<br />
für den Export von Agrargütern und Lebensmitteln. Mit<br />
zahlreichen Marketinginstrumenten sollte sie in wichtigen<br />
ausländischen Märkten den Verkauf französischer Waren<br />
ankurbeln. Und seit Deutschland Export partner Nummer<br />
eins geworden war, wurden die Anstrengungen hier zulande<br />
− seit 1962 von Düsseldorf, dem ersten Auslands büro der<br />
Sopexa, sowie von verschiedenen Zweigstellen aus − besonders<br />
nachhaltig betrieben. Schon 1960 hatte die Zeitschrift<br />
»Cuisine et Vins de France« einen deutschen Ableger, den<br />
»Feinschmecker« gegründet, und die zahlreichen Nennungen<br />
der Sopexa im Zusammenhang von Berichten über<br />
Messen und Verkaufsaktionen von Käse und Wein sowie<br />
nicht zuletzt als Lieferant von Bildmaterial legen den Schluss<br />
nahe, dass hier die Publizistik und der Außenhandel unseres<br />
Nachbarlandes Hand in Hand arbeiteten.<br />
Der Widerstand in der deutschen Gesellschaft war<br />
erheblich, doch die Erfolge blieben nicht aus. 1964 wurde,<br />
nach fünfzigjähriger Unterbrechung, in Deutschland wieder<br />
ein »Guide Michelin« publiziert, der dann von 1966 an auch<br />
an Restaurants in Deutschland seine berühmten Sterne vergab.<br />
Seit den 1970er-Jahren verkündeten Kritiker wie Klaus<br />
Besser, Gert von Paczensky und Wolfram Siebeck das Lob<br />
der »Nouvelle Cuisine«. 1980 schließlich erhielt Eckart<br />
Witzigmann in seinem Restaurant »Aubergine« in München<br />
als erster Koch in Deutschland den dritten Stern. Ein<br />
Triumph für Witzigmann – aber nicht nur. Denn die Küche<br />
in der »Aubergine« war bis ins Mark Französisch und die<br />
Grundprodukte stammten zumeist vom legendären Großmarkt<br />
Paris-Rungis. Das deutsche Küchen wunder schlüpfte<br />
aus Eierschalen in den Farben der Trikolore.<br />
Unterdessen war aus der »Gemeinsamen Agrarpolitik«<br />
ein Monstrum geworden. Die Schaffung<br />
eines gemeinsamen Marktes bedeutete im<br />
Europa der Sechs das Startsignal für die »Modernisierung<br />
der Agrarstrukturen«, was zur Ausräumung von Landschaften<br />
und zu intensiven Flurbereinigungen führte, um<br />
großflächige industrielle, das heißt maschinenunterstützte<br />
Land nutzung zu ermöglichen. Zusätzlich belasten extensive<br />
Düngung und Pestizideinsatz die Natur, insbesondere in den<br />
1970er- Jahren. Die kleinen bäuerlichen Familien strukturen<br />
wichen vielerorts modernen Agrarfabriken. Damit verbunden<br />
war der Untergang der traditionellen dörflichen Strukturen.<br />
Die moderne Nutztierzucht und -haltung nahm in<br />
vielen Fällen die Form von Tier quälerei an. Was einmal<br />
als sinnvolle Modernisierung begonnen hatte, nahm maßlose<br />
Formen eines entfesselten Agro business an. Durch<br />
garantierte Abnahmepreise angefeuert, entstand eine bald<br />
sprich wörtlich gewordene gewaltige Über produktion in<br />
Form von Butter bergen und Milchseen. Das alles geschah in<br />
Deutschland rücksichtsloser als in Frankreich – der schmerzhafte<br />
Weg zum Fortschritt, die Anpassung an eine Produktion<br />
vornehmlich nach Quantität und nicht nach Qualität<br />
aber sollte auch Frankreichs Land wirtschaft grundlegend<br />
verändern.<br />
In Deutschland begann mit der »Gemeinsamen Agrarordnung«<br />
das eigentliche Ende der traditionellen Landwirtschaft,<br />
eine Entwicklung, die bereits im deutschen<br />
Kaiserreich um 1900 mit der Entscheidung für den Industrieund<br />
gegen den Agrarstaat eingeläutet worden war – heute<br />
beträgt der Anteil der Landwirtschaft an der Bruttowertschöpfung<br />
der deutschen Wirtschaft gerade einmal 0,6 Prozent.<br />
Aber auch für die französische Landwirtschaft war<br />
die »Gemeinsame Agrarordnung« ein Pyrrhussieg. Ohne<br />
sie hätte es die »Trentes Glorieuses«, die drei prosperierenden<br />
Jahrzehnte in Frankreich zwischen 1945 und 1975,<br />
nicht gegeben. Die Agrarexporte bildeten die wichtigste<br />
Säule des Außen handels – Staatspräsident Giscard d’Estaing<br />
prägte den Begriff vom »pétrole vert«, dem grünen Öl −,<br />
doch französische Produkte wurden immer austauschbarer.<br />
In den Siebzigerjahren begann Italien − und seit dem<br />
EU-Beitritt von 1986 auch Spanien – mit seinen Agrarprodukten,<br />
aber auch mit der kulinarischen Kultur, Frankreich<br />
in den Schatten zu stellen. Heute, wo die Speziali täten<br />
der Welt global verfügbar sind und sich die Kulinarik immer<br />
hektischer neue Spotlights sucht − gestern Barcelona, heute<br />
Kopenhagen, morgen Peru – verblasst immer mehr, dass<br />
Frankreich das eigentliche Vaterland eines jeden wahren<br />
Feinschmeckers ist. Im Weinbau hat unser Nachbarland seit<br />
den späten Neunzigerjahren verstanden, das Steuer energisch<br />
wieder herumzureißen. Es bleibt abzuwarten, ob<br />
auch andere Bereiche der französischen Agrar wirtschaft<br />
wieder dem auf höchste Qualität verpflichteten Kurs folgen<br />
werden.<br />
Kochbücher werden Bestseller:<br />
Die Lust am besseren<br />
Essen inspirierte auch<br />
den Buchmarkt. Und als<br />
1964 der erste deutsche<br />
Guide Michelin erschien,<br />
war der Bann gebrochen.<br />
Peu à peu wurden die<br />
Deutschen auch bei Tisch<br />
wieder wer.<br />
<strong>DAS</strong> <strong>MAGAZIN</strong> <strong>FÜR</strong> <strong>GENUSS</strong> <strong>UND</strong> <strong>LEBENSSTIL</strong> <strong>FINE</strong> 1 | 2017 35
NEUES VON DEN<br />
<strong>GENUSS</strong>WERKERN<br />
EINE KULTURGESCHICHTE<br />
ÜBER DEUTSCHES ESSEN<br />
Von ritterlichen Banketten<br />
der Minnesängerzeit bis zum<br />
Streetfood der Gegenwart.<br />
Tre Torri Verlag GmbH | Sonnenberger Straße 43 | 65191 Wiesbaden | info@tretorri.de | www.tretorri.de<br />
EINE HOMMAGE AN EINEN DER<br />
GRÖSSTEN KÖCHE UNSERES LANDES<br />
35 der wichtigsten Rezepte von Hans Haas – visualisiert<br />
in authentischen, großformatigen Fotografien, die vermitteln,<br />
wie der Gast den jeweiligen Teller im Tantris tatsächlich<br />
erlebt. Begleitet von kurzen Essays, die die besondere<br />
Eigenart der Haas’schen Küche verdeutlichen.<br />
240 SEITEN | 39,90 €<br />
432 SEITEN | 39,90 €
<strong>DAS</strong> IST DOCH<br />
ALLES GESCHMACKSSACHE<br />
Der bekannte Restaurantkritiker und Kolumnist Jürgen Dollase<br />
entwickelt eine völlig neue Vorstellung von Essen. Er nimmt Sie mit<br />
auf eine sensorische Reise, auf der sich Ihre Rezeption von Essen<br />
entscheidend verändern wird. Im Zentrum der Geschmacksschule<br />
stehen von Meisterköchen speziell komponierte „Löffelgerichte“<br />
und ein fünfgängiges Löffelmenü. Illustriert wird dies durch außergewöhnliche<br />
Darstellungen der Geschmacksverläufe sowie abgerundet<br />
durch ebenso spannende wie moderne Rezeptbeispiele.<br />
Noch nie war es so einfach und gleichzeitig so vielfältig, Geschmack<br />
zu erleben. Es ist an der Zeit, das Verhältnis zu Essen neu zu positionieren<br />
und zu überprüfen, was unsere Geschmacksnerven alles hergeben.<br />
Und wie ausgeprägt Genuss beim Essen wirklich sein kann.<br />
240 SEITEN | 39,90 €<br />
EINLEITUNG<br />
6 | 7<br />
SENSIBILISIERUNG 32 | 33<br />
VON ESSEN<br />
<strong>UND</strong> SCHMECKEN<br />
<strong>UND</strong> DER<br />
GESCHMACKSSCHULE<br />
BEISPIEL 1<br />
Nehmen Sie nun einen Löffel,<br />
füllen Sie ihn wie jeweils beschrieben<br />
und versuchen Sie, die beschriebenen<br />
geschmacklichen<br />
Effekte nachzuvollziehen.<br />
JEDER VON UNS HAT BEIM ESSEN SO SEINE RITU-<br />
Diese Fähigkeit ist ganz offensichtlich zuschaltbar.<br />
EIN DURCHGANG<br />
STUFE 1<br />
STUFE 2<br />
STUFE 3<br />
STUFE 4<br />
STUFE 5<br />
ALE, <strong>UND</strong> JEDER WEISS ZIEMLICH GENAU, WIE ER<br />
Man kann essen und reden oder sich beim Essen eine<br />
AUS GANZ NORMALEN<br />
Füllen Sie den Boden des Löffels<br />
Füllen Sie den Boden des Löffels<br />
Füllen Sie den Boden des Löffels<br />
Füllen Sie den Boden des Löffels mit<br />
Füllen Sie den Boden des Löffels<br />
DAMIT UMGEHEN KANN. MANCHMAL IST ES EBEN<br />
TV-Sendung ansehen und würde am Ende kaum eine<br />
VORRÄTEN, KALT<br />
mit etwas Joghurt.<br />
mit etwas Joghurt und geben<br />
mit etwas Joghurt und geben Sie<br />
etwas Joghurt und geben Sie vorne<br />
mit etwas Joghurt und geben Sie<br />
NUR EINE REINE NAHRUNGSAUFNAHME, DIE MAN<br />
MIT DEN GANZ SICHEREN DINGEN ERLEDIGT,<br />
VON DENEN MAN WEISS, WIE SIE SCHMECKEN<br />
Frage beantworten können, die etwas mit dem Essen zu<br />
tun hat. Waren da Oliven auf der Pizza? Oder irgendwelche<br />
Kräuter? Ich habe einmal in einem sehr guten<br />
ZUTATEN<br />
DEGUSTATIONSNOTIZ<br />
Zuerst empfindet man die Kälte<br />
Sie vorne und hinten etwas<br />
Konfitüre dazu.<br />
vorne und hinten etwas Konfitüre<br />
dazu. Dann legen Sie vier kleine<br />
Apfelwürfel darauf.<br />
und hinten etwas Konfitüre dazu.<br />
Legen Sie vier kleine Apfelwürfel<br />
und ein Walnussviertel darauf.<br />
vorne und hinten etwas Konfitüre<br />
dazu. Legen Sie vier kleine Apfelwürfel<br />
und ein Walnussviertel darauf<br />
<strong>UND</strong> MIT DENEN MAN KEINERLEI „BÖSE“ ÜBER-<br />
Restaurant gegessen, und zwar bei der Präsentation ei-<br />
JOGHURT, natur oder ganz<br />
des Joghurts. Der Kälteeindruck<br />
DEGUSTATIONSNOTIZ<br />
und beschließen Sie den Löffel mit<br />
RASCHUNGEN ERLEBT.<br />
nes neuen Kochbuchs eines sehr kreativen Kochs, den<br />
schwach aromatisiert, kalt aus dem<br />
gehört zu den wichtigsten Wahr-<br />
Wieder steht am Anfang die<br />
DEGUSTATIONSNOTIZ<br />
DEGUSTATIONSNOTIZ<br />
einem Stückchen Zwieback.<br />
ich sehr schätze. Es gab einige Gerichte, ich saß mit<br />
Kühlschrank<br />
nehmungen. Ist etwas im Mund<br />
Kälte des Joghurts. Weil Joghurt<br />
Die neue Zutat Apfelwürfel macht<br />
Mit dem Nussstückchen kommt<br />
Wenn wir das Essen nicht völlig unter Kontrolle haben –<br />
interessanten Leuten am Tisch, und die Unterhaltung<br />
sehr kalt, kann man andere Dinge<br />
und Konfitüre oder Gelee aber<br />
sich selbstverständlich sofort<br />
nun ein ganz deutlicher Kross-<br />
DEGUSTATIONSNOTIZ<br />
also zum Beispiel beim Essen außer Haus –, suchen wir<br />
war sehr angeregt. Am Ende des Essens wusste ich<br />
KONFITÜRE ODER GELEE,<br />
nicht gleichzeitig wahrnehmen,<br />
die gleiche Textur haben (beide<br />
bemerkbar. Sie ist für einen ganz<br />
Effekt hinzu, der zunächst auch alles<br />
Das extrem krosse Stückchen<br />
fast immer das, was in unser “Beuteschema“ passt und<br />
nicht, was ich gegessen hatte! Und das, obwohl es sich<br />
die Sorte ist ziemlich egal<br />
bis das kalte Objekt wieder<br />
haben vergleichsweise wenig<br />
sanften Kross-Effekt zuständig,<br />
andere dominiert. Die Wirkung<br />
Zwieback sorgt für eine totale<br />
werden dann vielleicht kurz und knapp registrieren, ob<br />
in diesem Restaurant wirklich lohnt, auf jedes Detail zu<br />
einigermaßen in der Nähe der<br />
Widerstand und schmelzen),<br />
der aber noch nicht das Apfel-<br />
eines krossen Elementes im Mund<br />
Dominanz des Kross-Effekts zu<br />
das Essen unseren Erwartungen entspricht, so ungefähr<br />
achten. Was Schmecken bedeuten kann, kennen Sie<br />
APFELWÜRFEL von etwa<br />
Körpertemperatur angekommen<br />
vermischen sie sich sehr schnell.<br />
aroma wirklich deutlich macht.<br />
ist fast immer so groß, dass die feine<br />
Beginn. Vor lauter Krachen kann<br />
entspricht, nicht entspricht oder vielleicht auch einmal<br />
vielleicht am ehesten von Weinproben her. Da redet<br />
5 x 5 mm, von einem eher sauren,<br />
ist. Natürlich setzt der Joghurt<br />
Wir können sie – vor allem dann,<br />
Beim Zerkauen ergibt sich ein<br />
Aromenwahrnehmung zurück-<br />
man keine weiteren Dinge regis-<br />
viel besser ist, als wir es erwartet haben. Je größer<br />
dann vielleicht jemand von feinen Quittennoten, die im<br />
ziemlich festen Apfel, am besten<br />
unseren Zähnen auch keinerlei<br />
wenn sich der Joghurt erwärmt<br />
Akkord mit Joghurt und Konfi-<br />
stehen muss, bis der Effekt nicht<br />
trieren. Danach spielt sich alles<br />
die Abweichungen sind – egal in welche Richtung –,<br />
Abgang (also dann, wenn man schluckt) verschiedene<br />
mit etwas Schale. Geeignet ist<br />
Widerstand entgegen. Wir emp-<br />
hat – von der Textur her kaum<br />
türe, der aber nur eine kurze Zeit<br />
mehr so stark ist. Weil ein Nuss-<br />
so ab wie bei Stufe 4, mit dem<br />
desto eher werden wir uns einmal einen Moment auf<br />
exotische Blütenaromen entwickeln. Sie werden das<br />
z. B. Granny Smith<br />
finden ihn als schmelzend, weil<br />
auseinander halten. Und weil sie<br />
anhält. Dann schmelzen Joghurt<br />
stückchen aber nicht nur zu Beginn<br />
Unterschied, dass die weniger<br />
das Essen konzentrieren und „hinschmecken“, um was<br />
vielleicht für bizarr halten und an die vielen Witze den-<br />
er sich quasi sofort – und ohne<br />
sich vermischen, haben wir auch<br />
und Konfitüre endgültig weg.<br />
kross ist, sondern auch etwas, auf<br />
krosse Nuss am Anfang vom<br />
es sich denn da eigentlich handelt. „Oh, dieses Durch-<br />
ken, die man über die Weinsprache macht. Sie werden<br />
ETWAS NUSS, und zwar ent-<br />
Kauen oder größere Mund-<br />
ein Mischaroma, in diesem Falle<br />
Übrig bleibt allein der Apfel,<br />
dem man längere Zeit kaut, hält sich<br />
Zwieback übertüncht wird, so wie<br />
einander von verschiedenen Gemüsesorten schmeckt<br />
aber vielleicht auch zwei wichtige Dinge erkennen,<br />
weder Walnussstückchen oder<br />
bewegungen – aus dem Mund in<br />
einen süßen Joghurt. Wir bemer-<br />
das Apfel aroma und die leicht<br />
das Nussaroma recht lange Zeit. Es<br />
der noch weniger krosse Apfel-<br />
aber gut!“, heißt es dann vielleicht, manchmal aber auch<br />
nämlich erstens, dass sich solche Aromen tatsächlich im<br />
Stücke von der Pekannuss, beide<br />
Richtung Speiseröhre entfernt.<br />
ken in diesem Zusammenhang<br />
faserige Textur des Apfels.<br />
kommt also nach dem ersten Kross-<br />
würfel bei Stufe 4 von der Nuss<br />
„Das schmeckt ja furchtbar, das kann ich nicht essen!“<br />
Wein finden, und zweitens, dass man bisweilen größere<br />
Sorten haben eine ähnliche Textur<br />
Ein leichter Druck mit der Zunge<br />
einen weiteren zeitlichen Verlauf.<br />
Effekt zu einer Akkordbildung mit<br />
überdeckt wurde. Im Gegensatz<br />
Wir benutzen also eine Fähigkeit, die wir offensichtlich<br />
Probleme hat, das, was man offensichtlich schmecken<br />
reicht dazu aus.<br />
Er geht von der Kältewahrneh-<br />
den anderen Elementen, wobei sich<br />
zur Nuss wird der Zwieback aber<br />
alle besitzen. Wir schmecken, wo wir sonst nur essen.<br />
kann, auch mit passenden Worten auszudrücken.<br />
STÜCKCHEN VON<br />
mung über die Verschmelzung<br />
die „schwächeren“ Elemente, wie<br />
viel schneller zerlegt und ist nicht<br />
ZWIEBACK, in der Dicke halbiert<br />
zur Süße der Konfitüre.<br />
Joghurt und Konfitüre, als Erste<br />
so nachhaltig, dass er im weiteren<br />
verflüchtigen. Am Schluss bleibt ein<br />
Verlauf eine größere Rolle spielen<br />
Rest von Apfel und Nuss übrig.<br />
würde.<br />
GESCHMACKSSCHULE<br />
LÖFFELGERICHTE 104 | 105<br />
2<br />
VON AROMEN, TEMPERATUREN<br />
<strong>UND</strong> TEXTUREN<br />
KARTOFFEL,<br />
KERBEL,<br />
SEEHASENROGEN<br />
ZUTATEN<br />
KARTOFFELN<br />
eher längliche Kartoffeln von<br />
etwa 6 cm Länge und rund 2 cm<br />
Höhe (damit sie mit Schale<br />
verwendet werden können.<br />
Notfalls geht es natürlich auch<br />
mit zurechtgeschnittenen<br />
„normalen“ Kartoffeln)<br />
Salzwasser (16 g Salz pro Liter)<br />
WEITERE ZUTATEN<br />
gut gekühlte Crème double oder<br />
französische Crème fraîche von<br />
mindestens 30 % Fettgehalt<br />
eine Handvoll fein gezupfte<br />
Kerbelblätter<br />
Seehasenrogen („falscher Kaviar“/<br />
„Deutscher Kaviar“), gut gekühlt<br />
ZUBEREITUNG<br />
Kartoffeln waschen und mit Schale garen (Messertest: Wenn ein spitzes<br />
Messer nicht mehr in der Kartoffel stecken bleibt, sind sie gar). Passend<br />
zum Löffel zurechtschneiden (s. Bild).<br />
ANRICHTEN<br />
Kartoffel auf den Löffelboden setzen, darauf einen guten TL Crème<br />
double und die gleiche Menge Seehasenrogen. Über alles großzügig<br />
Kerbel streuen.<br />
ANMERKUNG<br />
Trinken Sie dazu einen eiskalten Oude Genever.<br />
DEGUSTATIONSNOTIZ<br />
Über dem die ganze Zeit durchlaufenden Basisgeschmack von der Kartoffel ergibt sich nach kurzer Zeit ein<br />
intensiver Eindruck von Seehasenrogen, weil dieser erst angewärmt werden muss. Die fette Crème double schmilzt<br />
dagegen leichter und füllt den ganzen Mundraum. Der Nachhall kommt vor allem von der Textur der zerkauten<br />
Kräuter. Falls Sie den Genever dazu trinken, gibt es noch einmal eine komplette Reaktion mit allen Elementen,<br />
vor allem mit dem Seehasenrogen.<br />
CRÈME DOUBLE<br />
SEEHASENROGEN<br />
KERBEL<br />
KARTOFFEL<br />
KERBEL<br />
SEEHASENROGEN<br />
KARTOFFEL<br />
KERBEL<br />
CRÈME DOUBLE
DIE WILDNIS<br />
Mit der Kampagne für seinen neuen Herrenduft lässt Joop eine<br />
alte Ikone wieder auferstehen: Tarzan, den König des Dschungels.<br />
Von HANNAH CONRADT<br />
Eine Zeitungsschlagzeile aus dem Jahr 1924 kündet von einer Sensation: Ein junger Lord<br />
ist nach fünfundzwanzig Jahren im Dschungel gefunden worden und kehrt nun nach Hause<br />
zurück. Wir sehen ihn auf dem Rücksitz einer Limousine vor seinem Schloss vorfahren<br />
und den Willkommensgruß eines Butlers schroff zurückweisen. Wir sehen, wie er sich<br />
widerwillig den Bart und die langen, verfilzten Haare abschneiden lässt. Die dreckigen<br />
Lumpen werden gegen einen frischen Maßanzug getauscht, noch ein Spritzer Parfüm<br />
und die Rückkehr in die Zivilisation scheint abgeschlossen. Oder doch nicht? Der intensive<br />
Blick des Protagonisten lässt den Zuschauer erahnen, dass man zwar den Mann aus<br />
der Wildnis holen kann, die Wildnis jedoch immer ein Teil des Mannes bleibt.<br />
Soweit die Geschichte, die uns der Werbespot für den<br />
neuen Herrenduft Wow! von Joop erzählt. Und natürlich<br />
soll es vor allem der erwähnte letzte Spritzer<br />
Parfüm sein, der die Ambivalenz seines Trägers besonders<br />
betont: Dieser Mann mag wie ein Gentleman gekleidet sein,<br />
disting uiert, den Konventionen seines Standes verpflichtet,<br />
doch im Innern bleibt er ein wilder Freigeist. Inspiration<br />
für den Werbespot, für den Olivier Dahan, bekannt durch<br />
seinen Oscar-prämierten Film »La vie en rose«, Regie<br />
führte, war unverkennbar die Legende von Tarzan. Jenem<br />
von Edgar Rice Burroughs erdachten Adligen, der als Kind<br />
im Dschungel seine Eltern verliert und dann von Affen groß-<br />
gezogen wird, mit markantem Schrei und beeindruckendem<br />
Lianenschwung zum König des Dschungels avanciert<br />
und sich schließlich in die furchtlose Forschertochter Jane<br />
verliebt. Ihr folgt er schließlich zurück nach England, sie<br />
heiraten und bekommen einen Sohn. Doch das Leben des<br />
britischen Adels bleibt Tarzan fremd, er sehnt sich nach<br />
seiner eigentlichen Heimat. Schließlich folgt er dem Ruf<br />
der Wildnis und kehrt mit Jane in den Dschungel zurück.<br />
Zunächst als Kurzgeschichte in einer Zeitschrift erschienen,<br />
machten die Geschichten um Tarzan ab 1914 als Buchveröffentlichungen<br />
Karriere. Auch als Filmstoff hat es Tarzan<br />
in mehr als einhundert verschiedenen Versionen auf die<br />
Leinwand geschafft, erstmals im Jahr 1918 mit Gordon<br />
Griffith in der Hauptrolle. Kurz darauf ergatterte der amerikanische<br />
Footballspieler James Pierce die Rolle des Tarzan<br />
und wenig später auch das Herz der Tochter von Tarzan-<br />
Erfinder Edgar Rice Burroughs. Johnny Weissmüller und Lex<br />
Barker wurden durch ihre Rolle als König des Dschungels zu<br />
Hollywoodstars und prägten mit ihrer Darstellung und vor<br />
allem ihrer physischen Präsenz die Vorstellung von wilder,<br />
unverstellter Männlichkeit. 2016 kam Tarzan nach einer<br />
längeren Pause erneut in die Kinos, mit über wältigender<br />
Animationstechnik und mit Alexander Skarsgård in der<br />
Hauptrolle. Es dürfte wenige Figuren geben, die Filmemacher<br />
und Zuschauer über ein ganzes Jahrhundert hinweg<br />
so inspiriert und bewegt haben wie Tarzan.<br />
Fotos: Joop<br />
38 <strong>FINE</strong> 1 | 2017 <strong>DAS</strong> <strong>MAGAZIN</strong> <strong>FÜR</strong> <strong>GENUSS</strong> <strong>UND</strong> <strong>LEBENSSTIL</strong>
IM BLICK<br />
Auch als literarischer Topos hat die Geschichte vom<br />
»Wolfskind«, also dem Helden, der von wilden Tieren<br />
aufgezogen wird, eine lange Tradition. Die Legende von<br />
Romulus und Remus geht auf eine solche Erzählung zurück.<br />
Rudyard Kiplings Dschungelbuch hat mit Mogli ebenfalls<br />
einen Helden, der als Mensch nie wirklich in den Dschungel,<br />
als Dschungelkind aber auch nie wirklich in das Menschendorf<br />
gehört. Sowohl Tarzan als auch Mogli sind so faszinierende<br />
Figuren, weil sie Außenseiter sind, zerrissen zwischen<br />
zwei Welten. Und weil wir durch sie nicht nur unsere eskapistischen<br />
Sehnsüchte gespiegelt sehen, sondern uns der<br />
existentiellen Frage aussetzen, was das Menschsein eigentlich<br />
ausmacht. Und auf welche Konventionen und Annehmlichkeiten<br />
der Zivilisation wir möglicherweise verzichten<br />
könnten, um ein ganz und gar freies Leben in und mit der<br />
Natur zu führen.<br />
Gut möglich, dass sich der Parfümeur Christophe<br />
Raynard von dieser Sehnsucht nach Exotik und<br />
Abenteuer leiten ließ, als er den neuen Signature-<br />
Herren-Duft des Hauses Joop entwarf: Frisch und kühl<br />
in der Kopfnote durch Bergamotte, Kardamon und Veilchen,<br />
geheimnisvoll sinnlich in der Herznote durch Geranie,<br />
Vetiver und Tannenbalsam, in der holzigen Basisnote setzen<br />
Kaschmir, Vanille und Tonkabohne markante und kraftvolle<br />
Akzente. »Seine luxuriöse deutsche Handschrift zusammen<br />
mit einer starken Männlichkeit und einem Touch unkonventionellen<br />
Überschwangs« mache den Duft in seinen<br />
Augen so einzigartig, so Raynard. Acht Monate lang hat er<br />
an seiner Komposition gearbeitet und auf seinen Reisen<br />
vor allem durch Indien reichlich Inspiration gesammelt.<br />
Bleibt zu hoffen, dass sich dieser Überschwang und diese<br />
Hinwendung zum Unkonventionellen auch auf die Träger<br />
von Wow! überträgt.<br />
Ein bisschen Wildheit unterm Maßanzug hat schließlich<br />
noch keinem geschadet.<br />
Die Zähmung des Widerspenstigen: Um den<br />
ungebändigten Urwald-Zottel in einen veritablen<br />
Gentle man zu verwandeln, braucht es nur einen<br />
Friseur, einen Schneider und – für das Beste im<br />
Mann – einen Herrenduft. Der Effekt: WOW!<br />
<strong>DAS</strong> <strong>MAGAZIN</strong> <strong>FÜR</strong> <strong>GENUSS</strong> <strong>UND</strong> <strong>LEBENSSTIL</strong> <strong>FINE</strong> 1 | 2017 39
SCHUHE<br />
<strong>FÜR</strong> EIN<br />
GANZES<br />
LEBEN<br />
40 <strong>FINE</strong> 1 | 2017 <strong>DAS</strong> <strong>MAGAZIN</strong> <strong>FÜR</strong> <strong>GENUSS</strong> <strong>UND</strong> <strong>LEBENSSTIL</strong>
Am liebsten bleibt er bei seinen Leisten. Das edle Schuhwerk, das Hans-Joachim Vauk<br />
in seiner Werkstatt produziert, kann so viel wie ein Kleinwagen kosten. Aber sollte der<br />
Mensch seinen Füßen, die ihn durch ein langes Leben tragen, nicht das Allerbeste gönnen?<br />
Von UWE KAUSS<br />
Fotos JOHANNES GRAU<br />
Wenn Hans-Joachim Vauk in seinem winzigen Büro zum antiken Schreibtisch geht, muss er an einem Kleiderständer vorbei, an dem<br />
sein Leben hängt. Diesmal bleibt er stehen, greift eine schwarze, seidenweich fallende Bahn, schließt die Augen, saugt den Duft mit<br />
der Nase ein und sagt: »Dieses Leder hat eine wirklich gute Qualität. Mit so etwas kann ich arbeiten.« Die Bahn aus zart-rauem Pekari,<br />
einem aus Südamerika stammenden Nabelschwein, ist so leicht, man könnte daraus ein Polohemd schneidern. Hans-Joachim Vauk<br />
wird es aber als Oberleder für Maßschuhe verwenden. Seit rund dreißig Jahren fertigt er eben solche in seiner Werkstatt in Neumünster<br />
nördlich von Hamburg. 1977 hat er sie bezogen, und seit damals hat sich in den geduckten Räumen unterm steilen Ziegeldach mit kleinen<br />
Fenstern, wuchtigen Maschinen und der harzigen Duftmelange aus Leder, Klebstoff, Holz, Stahl und Staub nichts verändert. Die<br />
Kaffee maschine faucht, an der Wand hängt ein großer Wandkalender mit Landschaftsmotiven. Nebenan liefert das Radio den Soundtrack<br />
zum Hämmern, Kleben, Schneiden, Schleifen und Fräsen.<br />
Der siebzigjährige Hans-Joachim Vauk ist einer der<br />
letzten – und besten – Maßschuhmacher Deutschlands.<br />
Die schwere Krise der Schuhmacherbetriebe<br />
seit den 1980er-Jahre ist an seiner Werkstatt vorbei gezogen.<br />
2007 verzeichnete die Handwerksrolle noch rund 3500<br />
Meisterwerkstätten, 2015 waren es nur noch knapp 2450.<br />
Von ihnen arbeiten nur noch wenige Dutzend als Maßschuhmacher.<br />
Doch die Uhren in Vauks Werkstatt schlagen<br />
in ihrem eigenen Rhythmus. Computer gibt es in seinen<br />
Räumen nicht, dafür Hämmer, scharfe Messer, Zangen,<br />
Nägel, dicke Nadeln und Feinwerkzeuge. »Mit meinem<br />
Notebook mache ich Online-Banking, ab und zu suche<br />
ich eine Information. Aber bei der Arbeit ist es nutzlos.«<br />
Seine Kundenliste ist längst international, selbst amerikanische<br />
Kunden treffen sich beim Businesstrip mit ihm,<br />
um neue Schuhe abzuholen oder in Auftrag zu geben. Auch<br />
viele Prominente sind darunter. Doch Namen nennt Hans-<br />
Joachim Vauk nie. Seine norddeutsche Begründung: »Der<br />
Maßschuh wird dadurch ja nicht besser.« Achtzigtausend<br />
Kilometer fährt er pro Jahr quer durch Deutschland, um<br />
in Luxushotels, bei Herrenausstattern oder Maßanzugmachern<br />
seine Kunden mit Schuhen zu versehen. Ob Sylt,<br />
Berlin, Potsdam, Düsseldorf, Frankfurt oder München:<br />
Von Freitag früh bis Sonntagabend ist er unterwegs zu den<br />
Kunden. »Würde ich in Neumünster auf sie warten, wäre<br />
das Geschäft längst am Ende.« Also setzt er sich in seinen<br />
Kombi mit Modellschuhen, Ledermustern und den Werkzeugen<br />
zum Vermessen der Füße. Nur ein Wochenende im<br />
Monat nimmt sich Vauk frei. An einem normalen Montagmittag<br />
steht er wieder in Neumünster in der Werkstatt und<br />
schleift, poliert, färbt oder cremt sieben-, achtmal die halbfertigen<br />
Schuhe ein. Um acht Uhr morgens schließt er die<br />
Werkstatt auf, erst gegen 20 Uhr verlässt er sie. Nur einen<br />
kleinen Luxus gönnt er sich: »Ich mache eine Stunde Mittagspause,<br />
das reicht für ein kurzes Schläfchen.«<br />
Heute arbeitet Vauk mit zwei Meistern und einem<br />
Gesellen an den Maßschuhen, die erst nach knapp fünfzig<br />
Stunden Arbeitszeit und rund zweihundert Arbeitsschritten<br />
bereit sind, getragen zu werden. »Dazu kommen<br />
die Ruhezeiten, in denen sich das Leder an die Form und<br />
Spannung des Schuhs anpasst«, erklärt Hans-Joachim Vauk<br />
den Zeitraum, »zudem arbeiten wir mit Klebstoff und mit<br />
Wasser. Die schließen sich aus, es geht nur eins nach dem<br />
anderen. Dazu muss auch die Farbe gut trocknen.« Jeder<br />
Schritt wird ausschließlich mit geübter Hand ausgeführt.<br />
So dauert es sechs bis neun Monate beim ersten Paar bis<br />
zur Liefe rung in einem Beutel aus Wolle und Kaschmir, mit<br />
passend gefertigten Spannern, französischer Schuhcreme<br />
und feiner Polierbürste.<br />
Nach dem Vermessen der individuellen Tritt spur<br />
des Kunden entstehen in einer Spezialwerkstatt<br />
im Ostharz zunächst die Leisten, die hölzernen<br />
Modell abbildungen der Füße. Nur so lassen sich die Druckverhältnisse<br />
präzise nachvollziehen, die den Fuß beim<br />
Gehen belasten. Daraus fertigen Vauk und seine Mit arbeiter<br />
zunächst den Probeschuh, der äußerlich nur wenig mit<br />
dem späteren Modell zu tun hat. Er hat nur einen Zweck:<br />
Den Leisten präzise zu korrigieren, damit der Schuh später<br />
sitzt wie ein Strumpf. Erst nach Anprobe und Korrektur<br />
<strong>DAS</strong> <strong>MAGAZIN</strong> <strong>FÜR</strong> <strong>GENUSS</strong> <strong>UND</strong> <strong>LEBENSSTIL</strong> <strong>FINE</strong> 1 | 2017 41
Schuhe für ein ganzes Leben | Hans-Joachim Vauk<br />
machen sich die Maßschuhmacher aus Neumünster an die<br />
Arbeit. Wer das zweite Paar bestellt, wartet nur etwa vier<br />
bis fünf Monate, da die Leisten in der Werkstatt schon vorhanden<br />
sind.<br />
Das sind die Arbeiten, die<br />
Hans-Joachim Vauk liebt:<br />
Zwicken, den Rahmen<br />
einstechen, die Ferse klopfen,<br />
den Absatz schleifen. Nach<br />
bald zweihundert Fertigungsschritten<br />
ist das über<br />
die Leisten gearbeitete<br />
Maßschuhpaar fertig. Das<br />
Ergebnis lässt sich sehen und<br />
seinen Träger schweben.<br />
Über tausend Leistenpaare reihen sich inzwischen,<br />
penibel alphabetisch sortiert, in deckenhohen<br />
Regalen aus Dachlatten. Viele haben hier schon<br />
seit fünfundzwanzig oder dreißig Jahren ihren Platz. »Ich<br />
habe Kunden, die haben fünfzig Paar Maßmodelle in ihren<br />
Schränken. Andere tragen zwanzig Jahre lang ein Paar und<br />
lassen es bei uns immer wieder reparieren oder auf arbeiten«,<br />
sagt Vauk und blickt durch seine randlose Brille auf die<br />
penibel polierten Mustermodelle. Sie stehen in einem dunklen<br />
Regal, das seinem Schreibtisch gegenüber in die Wand<br />
eingebaut ist: Full Brogues, Half Brogues, Oxford, Derby<br />
und Norweger in Schwarz, Braun, Bordeaux oder Cognac.<br />
Diese Herrenschuhformen und -farben hätten sich in hundert<br />
Jahren kaum verändert, erzählt Vauk. »Aber damit können<br />
wir spielen und individuelle Wünsche einbeziehen.«<br />
In Hamburg würden zu neunzig Prozent schwarze Schuhe<br />
in Auftrag gegeben. Je weiter ihn seine Reisen nach Süden<br />
bringen, umso mehr Farbe komme ins Spiel: »In München<br />
ist Bordeaux und Cognac sehr gefragt.«<br />
Häufig würden die Kunden dafür Kalbsleder aus dem<br />
Bayerischen Wald wählen, aber auch Pekari, Hirsch, Wasserbüffel<br />
und viele weitere Sorten hält er vorrätig. Vauk breitet<br />
eine lange Lederbahn auf dem historisch anmutenden Nähmaschinentisch<br />
aus und deutet auf die Farb muster: »Wir<br />
verwenden von jeder Bahn nur die besten, gleich farbenen<br />
Teile für den Schuh. Die Bereiche mit den Wachstumsstreifen<br />
sind nicht gut genug. Aus ihnen fertigen wir höchstens<br />
Probe schuhe.« In seinem klimatisierten Lager hängen<br />
vierzig oder fünfzig Jahre alte Leder bahnen. Doch auch nach<br />
so langer Zeit sei kein Qualitäts unterschied erkennbar. Im<br />
Gegenteil: »Die Tiere sind damals viel langsamer als heute<br />
gewachsen. Das erzeugt eine hervorragende, gleichmäßige<br />
Qualität, die heute nur noch sehr schwer zu bekommen<br />
ist.« 3500 bis 4000 Euro kostet das erste Paar, das zweite ist<br />
einige hundert Euro günstiger. Bei guter Pflege lassen sich<br />
diese Schuhe fünfzehn bis über dreißig Jahre lang tragen.<br />
In Vauks Werkstatt gibt es keine Massenware, keine in<br />
der Fabrik vorproduzierten Teile. Auch die in deutschen<br />
Büros übliche Hektik hat in seiner Werkstatt keinen Platz.<br />
»Stress ist schädlich für die Schuhe – und für uns«, betont<br />
er mit strenger Stimme. »Ich stelle ein Paar gerne mal einen<br />
Tag zur Seite, schaue später ein Detail noch mal an und korrigiere<br />
es. Oft lasse ich auch meine Mitarbeiter draufgucken,<br />
ob sie etwas anpassen würden.« Das geschieht fast wie im<br />
Familienrat: Seine Mitarbeiter hat Vauk, der 1979 seine<br />
Meisterprüfung absolvierte, selbst ausgebildet. Einer seiner<br />
Meister arbeitet schon seit über dreißig Jahren für ihn.<br />
Doch Vauks Anspruch ist hoch: »Die Person muss in unserem<br />
Beruf mehr wollen. ›Ein bisschen‹ oder ›ganz gut‹<br />
reicht mir nicht. Wir turnen schließlich auf der obersten<br />
Stufe.« Einen doppelten Boden gebe es nicht: »Wer etwa<br />
beim Schleifen abrutscht und das Oberleder eines Schuhs<br />
verkratzt, kann gleich einen neuen bauen.«<br />
Vauk trägt an diesem Tag zur Arbeitsjeans mit Werkstattspuren<br />
ein Paar hochglänzend schwarze Tasselloafer,<br />
ein Halbschuhmodell ohne Schnürung, das vorne mit zwei<br />
Quasten verziert ist. »Die sind derzeit ein wenig aus der<br />
Mode, aber das ändert sich wieder«, sagt Vauk und zuckt<br />
mit den Schultern. Der Schuhmachermeister trägt ausschließlich<br />
selbst gefertigte Schuhe – aus gutem Grund:<br />
»Wenn ich neue Oberledersorten oder Sohlen einsetzen<br />
will, mache ich mir erst mal damit ein Paar und trage es.<br />
Ich muss doch herausfinden, ob das Material gut genug ist,<br />
bevor es ein Kunde erhält.«<br />
Das Leder, das er verarbeitet, stammt von den besten<br />
Gerbereien in Deutschland. »Eine Ledersohle für<br />
die Massenfertigung wird heute an einem Tag<br />
gegerbt. Die Sohlen, die ich verwende, brauchen bis zu<br />
sechsunddreißig Monate. Sie werden damit extrem stabil<br />
und zugleich elastisch.« Wer sportliche Chukka Boots<br />
oder Halbstiefel zum Jagen und Wandern bestellt, kann<br />
auch eine Gummisohle auswählen. Da kommt für Vauk<br />
nur eine in Frage: Die, mit der er schon bei der renommierten<br />
Schweizer Schuhmanufaktur Bally arbeitete. Bei<br />
einem Groß händler hat er sie wiederentdeckt. »Sie ist stabil,<br />
elastisch und dämmt die Trittgeräusche besser als eine<br />
Kreppsohle. Daher eignet sie sich auch gut für Business-<br />
Schuhe zum Tragen im Büro mit Marmorboden.«<br />
Bei Bally wollte er nach seiner Ausbildung in Kiel nur<br />
ein Jahr bleiben. Daraus wurden neun Jahre. Erst 1977 verließ<br />
er die Schweiz wieder. Sein Chef hatte Vauks Talent<br />
erkannt und gefördert. Der junge Schuhmacher erlernte<br />
dort die Handfertigung höchstwertiger Schuhe, leitete später<br />
einige Abteilungen und wurde seine rechte Hand. Es<br />
hätte eine glänzende Karriere werden können, doch Vauk<br />
quälte das Heimweh: »Mir hat die Küste und das Meer<br />
gefehlt«, sagt er. Seine Familie suchte eine Schusterwerkstatt<br />
und fand sie noch im selben Jahr in Neu münster. Bis<br />
heute ist sie sein Zuhause. Bally war zu dieser Zeit einer<br />
der renommiertesten und besten Schuhhersteller der Welt.<br />
Zum Abschied bekam er historische Bally-Schuhe geschenkt,<br />
die heute in einer Vitrine im Büro ihren Platz haben. Da<br />
stehen glamouröse, weiß-schwarze Damenstiefel aus den<br />
1920er-Jahren, winzige Kinderschuhe von 1914 und weitere<br />
Raritäten. Sie sehen aus, als hätte Vauk sie erst vor<br />
einer Woche fertiggestellt.<br />
Zurück in Neumünster fertigte er keine Schuhe mehr,<br />
er reparierte Absätze und Sohlen. Vauk seufzt: »Damals<br />
musste ich komplett von vorn anfangen.« Mit seiner<br />
Boden ständig keit, Verlässlichkeit und gutem Geschäftssinn<br />
beschäftigte er bald sieben Gesellen. Die Fräsen, Nähund<br />
Schleif maschinen in seiner Werkstatt stammen aus dem<br />
damaligen Maschinenpark von Bally. Er bekam sie günstig.<br />
Noch heute tun die schweren Werkzeuge aus den 1950erund<br />
1960er-Jahren zuverlässig ihren Dienst.<br />
Erst zehn Jahre später, Ende der 1980er-Jahre, konnte<br />
er das machen, von dem er schon als Kind geträumt hat:<br />
Maßschuhe fertigen. »Als Zehnjähriger lebte ich mit meiner<br />
Familie in einem winzigen Dorf in der Nähe von Mölln,<br />
nicht weit von der damaligen Zonengrenze. Im Sommer war<br />
ich draußen zum Baden, im Winter saß ich beim Schuster<br />
im Dorf in der Werkstatt. Der fertigte den Jägern ihre Stiefel<br />
an. Bei ihm habe ich ganze Tage verbracht und zugesehen.<br />
Es hat so gut gerochen. Eine schöne Zeit. Da wusste<br />
ich: Eines Tages werde ich Schuhe anfertigen.« Dabei ist<br />
es geblieben. So erhält jeder Kunde, der seine Schuhe trägt,<br />
nicht nur eine präzise, wertvolle Handwerksarbeit. Er trägt<br />
auch ein kleines Stück Leben von Hans-Joachim Vauk.<br />
42 <strong>FINE</strong> 1 | 2017 <strong>DAS</strong> <strong>MAGAZIN</strong> <strong>FÜR</strong> <strong>GENUSS</strong> <strong>UND</strong> <strong>LEBENSSTIL</strong>
Weingut Robert Weil – Riesling Großes Gewächs.<br />
Einer der Großen Weine der Welt.<br />
www.weingut-robert-weil.com
ZURÜCK IN DIE<br />
ZUKUNFT<br />
Viele Jahre hielt sich der Trend zu möglichst trocknem Champagner. Nun scheint das Pendel wieder<br />
in die andere Richtung zu schlagen. Die traditionsreiche Marke Veuve Clicquot hat die neuen »Rich«-<br />
Champagner vorgestellt: richtig süß und zum Mixen »on the rocks«. Die trauen sich was!<br />
Von STEFAN PEGATZKY<br />
Fotos GUIDO BITTNER<br />
Was der Mann<br />
von Welt in seinen<br />
Champagne<br />
Rich tut: Paprika,<br />
Gurke, grüner<br />
Tee, Sellerie oder<br />
Grapefruit zesten.<br />
Vor mir stehen die beiden Flaschen, als hätte sie Scotty aus dem Raumschiff Enterprise<br />
gerade auf die Erde gebeamt. In sternengeprägte Silberfolie eingehüllt, umgibt das Duo<br />
eine Aura von Party-Glamour und Zukunftseuphorie. Damit stoßen die beiden bei mir aber<br />
erst einmal auf Granit. Veuve Clicquot wirbt damit, den Champagner mit dem Rich und<br />
dem Rich Rosé zur Cocktail-Welt hin zu öffnen. Sollen sie doch, denke ich. Mich interessieren<br />
eher neue Mono-Crus oder alte Vintages.<br />
Immerhin regt sich auch Respekt bei mir: Denn die trauen<br />
sich was! Das erste Mal seit Jahrzehnten bringt eine<br />
größere Maison einen echten »Doux« auf den Markt,<br />
einen Champagner mit einer Restsüße von mehr als fünfzig<br />
Gramm pro Liter – sowohl der Rich als auch der Rich<br />
Rosé weisen eine Wert von sechzig Gramm auf. Dabei wurde<br />
noch bis spät ins neunzehnte Jahrhundert die ganze Welt<br />
von Reims und Epernay aus mit Champagnern von hoher<br />
Dosage versorgt, insbesondere Skandinavien und Russland.<br />
Flaschen vom 1840er Veuve Clicquot, die man jüngst vor<br />
den Åland-Inseln geborgen hat, weisen einen Restzucker<br />
von 150 Gramm pro Liter auf, also zweieinhalbmal so viel<br />
wie die Champagner Rich von 2017.<br />
Tatsächlich waren Champagner historisch gesehen<br />
länger süß, als dass sie trocken waren. Und das waren nicht<br />
die schlechtesten Zeiten. »Während der rosigen Soupers<br />
der Libertins«, heißt es in einer Erinnerung an das sinnliche<br />
achtzehnte Jahrhundert, »feierte man mit Delikatesse<br />
die glückliche Verbindung von Périgord-Trüffeln und süßen<br />
Champagnern, den bevorzugten Komplizen sanfter Liebesspiele.«<br />
Nur ganz allmählich wurde der Champagner trockner.<br />
Zunächst in Frankreich, wo Champagner immer öfter<br />
ein ernstzunehmender Essensbegleiter wurde, und dann<br />
besonders in England, wo »Brut« als neuer Stil in den<br />
1870er-Jahren modern wurde. Doch noch 1899 notierte H.L.<br />
Feuerheerd in »The Gentlemen’s Cellar and Butler’s Guide«,<br />
dass auf dem Kontinent auf einen trockenen Champagner<br />
Hunderte von süßen kämen. Dementsprechend unterschied<br />
man lediglich zwischen zwei Sorten von Champagnern, den<br />
trocknen, die jeweils nach Grad ihrer Trockenheit gekennzeichnet<br />
wurden, und den süßen, die auf dem Konti nent<br />
ohne sonderliche Bezeichnung vertrieben wurden, in England<br />
aber Namen wie »full« oder »rich« erhielten.<br />
Süßer Champagner wurde aber auch damals schon<br />
möglichst angefroren oder mit Eiswürfeln getrunken.<br />
In den 1880er-Jahren machte in der Pariser<br />
Oper der »Soyer« Furore, ein Champagner, den man aus<br />
angeeisten Gläsern mit einem Strohhalm trank. Der Schritt<br />
zum Cocktail war nicht weit. Gemischt wurde mit Früchten<br />
oder Likören, mit Guinness oder Coca Cola. Genauso<br />
alt freilich ist die Debatte, ob es sich bei einem »Kir Royal«<br />
44 <strong>FINE</strong> 1 | 2017 <strong>DAS</strong> <strong>MAGAZIN</strong> <strong>FÜR</strong> <strong>GENUSS</strong> <strong>UND</strong> <strong>LEBENSSTIL</strong>
Zurück in die Zukunft | Veuve Clicquot Rich<br />
Was die Dame von Welt<br />
mit dem Rich Rosé aufgießt:<br />
Ananas, Hibiskus,<br />
Ingwer, Erdbeeren oder<br />
Limettenzesten.<br />
oder einem »Black Velvet« um ein Sakrileg handelt. Ausgerechnet<br />
ein Amerikaner schien dann 1977 den Streit ein<br />
für alle Mal beendet zu haben. »Society for the prevention<br />
of cruelty to champagne«, Gesellschaft zur Verhinderung<br />
von Grausamkeiten gegen den Champagner, war die<br />
flammende Streitschrift des Weinkritikers Frank J. Prial<br />
im New York Times Magazine überschrieben, in denen er<br />
jede Verwendung des Champagners in Cocktail-Zubereitungen<br />
aufs Schärfste verdammte.<br />
Zugleich schien sich auch das Zeitalter der Champagner<br />
mit hoher Restsüße dem Ende zuzuneigen. Zucker,<br />
so hieß das Verdikt, überdecke den Eigengeschmack der<br />
Weine – zumal nicht wenige Produzenten die Süße tatsächlich<br />
dazu benutzten, Qualitätsmängel wie einen allzu hohen<br />
Anteil an Presswein zu kaschieren. Nur noch in winzigen<br />
Nischen überlebten Abfüllungen, die vor allem in Frankreich<br />
zur Gänsestopfleber oder zum Dessert getrunken wurden.<br />
Das Haus Roederer war in den 1980er-Jahren das letzte,<br />
das mit dem Carte Blanche auch einen süßen Champa gner<br />
anbot, manche sagen, auf besonderen Wunsch der britischen<br />
Queen Mum.<br />
Und dann präsentierte Lanson 2009 den White Label<br />
Sec – »am besten mit Himbeeren oder Minzblättern« − und<br />
Moët & Chandon im Jahr darauf den Ice Impérial Demi-<br />
Sec – »bitte mit Eiswürfeln«. Beide präsentierten sich<br />
aufregend innovativ und knüpften zugleich mit 28 beziehungsweise<br />
45 Gramm Restsüße pro Liter an die klassische<br />
Zeit der halbtrocknen Champagner an. Die Rich Champagner<br />
von Veuve Clicquot bilden nun die Synthese aus<br />
dem Mix-Appeal des Lanson und dem eisgekühlten Moët.<br />
Und sie legen in Sachen Dosage noch eine Schippe drauf,<br />
wobei Veuve Clicquot seine jüngsten Sprösslinge schon dem<br />
Namen nach ganz in die alte Tradition der süßen Champagner<br />
einreiht (nicht zu verwechseln übrigens mit dem klassischen<br />
Demi-Sec-Vintage-Champagner »Rich Réserve«,<br />
den Veuve Clicquot ebenfalls anbietet).<br />
In allen drei Fällen aber werden von den Produzenten<br />
nicht mehr ältere Damen als Zielpublikum anvisiert<br />
und noch nicht einmal die klassischen Champagner-<br />
Konsumenten, sondern Bartender und Clubgänger. Eine<br />
Generation, von der die großen Häuser der Champagne<br />
fürchten, dass sie den Kontakt zu ihr verlieren, und der sie,<br />
wie es im Kultur bereich heißt, »niederschwellige Angebote«<br />
machen müssen, um sie zu gewinnen. Weil dieses Angebot<br />
aber gleichbedeutend ist mit einem »Zurück in die Zukunft«,<br />
einem Wiederentdecken alter, fast vergessener Ursprünge<br />
der Region, sollten auch Champagner- Connaisseure den<br />
jungen Süßen mit einiger Neugier begegnen.<br />
Bei der Vorbereitung zum Tasting regt sich tatsächlich<br />
der Experimentiergeist in mir. Nicht zuletzt<br />
finde ich Gelegenheit, die Hardy-Rodenstock-<br />
Süßweingläser wieder einmal einzusetzen, die denen, die<br />
Veuve Clicquot empfiehlt, als Vorbild gedient zu haben<br />
scheinen. Brav bereite ich alle Zutaten vor, die die Maison<br />
als Ingredien zien für die neue »Mixology« angibt: Gurken,<br />
Sellerie und Paprika, Ananas und Ingwer, dazu Limonenund<br />
Grapefruit zesten sowie verschiedene Teesorten. Als<br />
Bonus gesellen sich Erdbeeren sowie Hibiskusblüten aus<br />
dem Sudan dazu. Schließlich macht es zweimal Plopp, und<br />
die Flaschen sind endlich offen.<br />
Zum Kalibrieren probiere ich Rich und Rosé zunächst<br />
klassisch »ohne alles«. Der Rich überrascht durch eine<br />
merklich verhaltenere Süße als erwartet. In der Nase dominiert<br />
die primäre Frucht des Pinot-Meunier, die sich auf<br />
einen soliden Pinot-Noir-Hintergrund stützen kann. An diesen<br />
positiven Eindruck kommt der Rich Rosé zunächst nicht<br />
heran – trotz der im Prinzip identischen Grundcuvée aus<br />
45 Prozent Pinot Noir, 40 Prozent Meunier und 15 Prozent<br />
Chardonnay, zu der allerdings noch 16 Prozent Rotwein aus<br />
Pinot-Noir-Trauben kommt. Die Farbe ist leuchtend Pink –<br />
also das ziemliche Gegenteil eines klassisch- seriösen Rosés –<br />
und das Bukett wird von einer bonbonhaften Fruchtigkeit<br />
dominiert. Regelrecht ver blüffend wirkt dann die Zugabe<br />
der Eiswürfel: Beide Weine finden aus einer anfänglich<br />
etwas behäbigen Breite ein schönes Gleichgewicht. Und<br />
mehr noch: Die Kälte bewirkt eine Änderung der Textur,<br />
indem sie wie mit dem Zauberstab die Perlage der<br />
Champagner reduziert und sie wunderbar kribbelig-cremig<br />
wirken lässt.<br />
Der erste finale Mix ist dann der Champagner- Gurken-<br />
Cocktail: Und da ist schon ein erstes »Wow!« fällig. Das<br />
an sich eher dezente Gurkenaroma wird vom Champagner<br />
wie auf ein Podest gestellt. Selbst die Bitternote der Schalen<br />
wird perfekt abgebildet und setzt einen feinen Kontra punkt.<br />
Beim Stangensellerie dominieren erdige Noten, während<br />
der Paprika (die deutsche Veuve- Clicquot-Homepage übersetzt<br />
hier »Pepper« falsch mit Pfeffer − den sollte man<br />
nicht in den Champagner mixen) etwas polarisiert, weil<br />
die Nase auf einmal an unreifen Sauvignon Blanc erinnert.<br />
Der Ingwer bringt dem Rosé würzigen Pep, aber auch eine<br />
leichte Seifigkeit. Die Ananas bleibt, wie auch die Erd beeren,<br />
im Rich unauffällig, während sie im Rosé für wunderschöne<br />
Farbverläufe sorgt. Sowohl farblich wie aromatisch überzeugend<br />
dann die Kombination mit den Limonenzesten<br />
im Rosé – während sie im Rich lediglich Assoziationen an<br />
Gin-Tonic erweckt. Noch stärker wirken die Grapefruitzesten:<br />
Es entsteht ein überaus komplexes Bouquet, das<br />
an edle Parfüms erinnert.<br />
Grüner Tee bleibt, zumindest bei dem von mir benutzten<br />
Ausgangsprodukt, bei beiden Weinen unauffällig, bei<br />
schwarzem Tee dominieren die Gerbstoffe etwas zu sehr<br />
über die Eleganz. Der Earl Grey im Rich aber ist eine Offenbarung:<br />
Die kühle Bergamotte-Note fächert sich vielfältig<br />
auf, ohne den Champagner zu überdecken. Zu den zitronigen<br />
Noten kommt eine Idee von Minze, Baumharz und<br />
Kiefernnadeln. Und regelrecht spektakulär wirkt sich die<br />
Zugabe von Hibiskusblüten in den Rich Rosé aus: Die blutroten<br />
Schlieren zwischen Eis und Pink erinnern an dramatische<br />
Sonnenuntergänge im Spätherbst, wobei die herben<br />
Fruchtaromen des Malvengewächses die sanfte Melancholie<br />
der Assoziation noch vertiefen. Eine kleine Verkostung<br />
verwandelt sich so in eine faszinierende Demonstration<br />
der unerschöpflichen Vielseitigkeit des Champagners.<br />
46 <strong>FINE</strong> 1 | 2017 <strong>DAS</strong> <strong>MAGAZIN</strong> <strong>FÜR</strong> <strong>GENUSS</strong> <strong>UND</strong> <strong>LEBENSSTIL</strong>
MEISTERSTÜCKE<br />
<strong>FÜR</strong> MÄNNER<br />
254 SEITEN<br />
VIELE ABBILDUNGEN<br />
22 X 28 CM<br />
HARDCOVER<br />
€ 39,90 (D)<br />
BAND 1 | BEEF! STEAKS<br />
Porterhouse, T-Bone, Rib Eye<br />
& Co. Der Weg zur perfekten<br />
Fleischzubereitung mit zahlreichen<br />
Rezepten.<br />
ISBN 978-3-944628-48-6<br />
BAND 2 | BEEF! GRILLEN<br />
Der Beweis, dass Grillen viel<br />
mehr sein kann als Kochen.<br />
Mit tollen Rezepten und Infos<br />
über Methoden und Zubehör.<br />
ISBN 978-3-944628-61-5<br />
BAND 3 | BEEF! CRAFT BIER<br />
Deutsche Brautradition und<br />
internationale Craft-Bier-Szene.<br />
Alle wichtigen Bierstile, leckere<br />
Gerichte und detaillierte<br />
Brauanleitungen.<br />
ISBN 978-3-944628-67-7<br />
BAND 4 | BEEF! WURST<br />
Wurstkurs, Zubehör, Zutaten<br />
und Herstellung. Mit Klassikern<br />
wie Hot Dog, Currywurst und<br />
passenden Beilagen.<br />
ISBN 978-3-944628-68-4<br />
BAND 5 | BEEF! NOSE TO TAIL<br />
Von der Schnauze bis zur<br />
Schwanzspitze – die komplette<br />
Verarbeitung des ganzen Tieres<br />
mit zahlreichen Rezepten.<br />
ISBN 978-3-944628-69-1<br />
Tre Torri Verlag GmbH<br />
Sonnenberger Straße 43<br />
65191 Wiesbaden<br />
Weitere Infos unter<br />
www.tretorri.de