Aus der Klinik für kleine Haustiere der Tierärztlichen Hochschule ...
Aus der Klinik für kleine Haustiere der Tierärztlichen Hochschule ...
Aus der Klinik für kleine Haustiere der Tierärztlichen Hochschule ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
III Anatomie_______________________________________________________ 11<br />
3. Tränenapparat<br />
Der Tränenapparat (Abb. 6) kann in einen bildenden (sekretorischen) und einen<br />
ableitenden Anteil unterteilt werden (KASWAN u. MARTIN 1983, KERN 1986). Den<br />
sekretorischen Anteil bilden die Tränen- und die Nickhautdrüse sowie die Drüsen <strong>der</strong><br />
Augenli<strong>der</strong>. Die Tränendrüse, Glandula lacrimalis, liegt innerhalb <strong>der</strong> Orbita dem<br />
Augapfel dorsotemporal auf (SEIFERLE 1991, MURPHY u. POLLOCK 1993). Ihr<br />
abgeplatteter, ovaler Drüsenkörper wird durch bindegewebige Stränge in nur locker<br />
miteinan<strong>der</strong> verbundene Lappen unterteilt. Die <strong>Aus</strong>führungsgänge <strong>der</strong> Tränendrüse<br />
münden im temporalen Anteil des Oberlides in den Konjunktivalsack (PRINCE et al.<br />
1960). Die zweite Tränendrüse des Hundes ist die Nickhautdrüse, Glandula<br />
palpebrae tertiae superficialis, welche den Stiel des Blinzknorpels umgibt (MICHEL<br />
1955, BROMBERG 1980, SEIFERLE 1991). Auch diese Drüse zeigt eine deutliche<br />
Läppchenbildung. Ihre <strong>Aus</strong>führungsgänge münden an <strong>der</strong> bulbusseitigen Innenfläche<br />
des dritten Augenlides nahe dem Grund des Bindehautsackes (MICHEL 1955,<br />
SEIFERLE 1991). Bei beiden Tränendrüsen handelt es sich um tubuloazinös<br />
zusammengesetzte Drüsen (MARTIN et al.1988a, b, LIEBICH 1999) vom serösen<br />
(LIEBICH 1999) bzw. gemischt mukoserösen Typ (PRINCE et al. 1960, KASWAN u.<br />
MARTIN 1983). Die beiden genannten Drüsen produzieren den wässrigen Anteil und<br />
damit 98 Prozent (davon 70 Prozent die Glandula lacrimalis, 30 Prozent die<br />
Nickhautdrüse) des präkornealen Tränenfilms. Dieser wird ergänzt durch das<br />
muköse Sekret <strong>der</strong> konjunktivalen Becherzellen, welches es dem Tränenfilm<br />
ermöglicht an <strong>der</strong> lipophilen Korneaoberfläche zu haften. Das lipophile Sekret <strong>der</strong><br />
Meibomschen und Zeißschen Drüsen, beugt einem Überfließen und einer zu<br />
schnelle Verdunstung des Tränenfilms vor (KASWAN u. MARTIN 1983, KERN 1986,<br />
MURPHY u. POLLOCK 1993, SLATTER 2001). Die Tränenflüssigkeit schützt die<br />
Hornhaut vor <strong>der</strong> <strong>Aus</strong>trocknung und sorgt außerdem <strong>für</strong> die Reinigung <strong>der</strong> Bindehaut<br />
und Hornhaut von Fremdkörpern (SEIFERLE 1991). Der ableitende Anteil des<br />
Tränenapparates wird von den Tränenpunkten, den Tränenröhrchen, dem<br />
Tränensack sowie dem Tränenkanal gebildet (MURPHY u. POLLOCK 1993). Durch<br />
den Lidschluss, <strong>der</strong> reißverschlussartig vom lateralen zum medialen Kanthus<br />
verläuft, wird die Tränenflüssigkeit in Richtung <strong>der</strong> Tränenpunkte, Puncta lacrimalia,<br />
transportiert. Hier wird sie durch Kapillarkräfte aufgenommen (KERN 1986). Die<br />
Tränenpunkte befinden sich in <strong>der</strong> Regel etwa fünf Millimeter vom medialen Kanthus






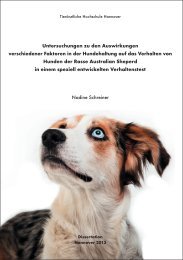



![Tmnsudation.] - TiHo Bibliothek elib](https://img.yumpu.com/23369022/1/174x260/tmnsudation-tiho-bibliothek-elib.jpg?quality=85)






