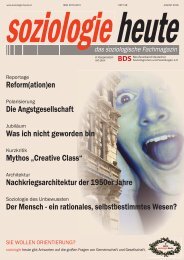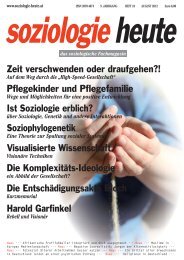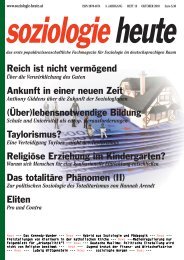soziologie heute Oktober 2011
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
<strong>Oktober</strong> <strong>2011</strong> <strong>soziologie</strong> <strong>heute</strong> 41<br />
nes Gegenstandes, sondern im einzelnen<br />
gegebenen Gegenstand selbst.<br />
Naheliegender Weise finden wir bei<br />
ihm denn auch großes Interesse für<br />
Naturphänomene. Er hat viele wissenschaftliche<br />
Disziplinen selbst gegründet<br />
oder maßgeblich beeinflusst.<br />
Große Teile des damaligen Wissens,<br />
das er in theoretische, praktische und<br />
poietische Wissenschaft einteilte, wurden<br />
von seinem Werk abgedeckt.<br />
Während seine exoterischen, für ein<br />
breites Publikum bestimmten Schriften<br />
verloren gegangen sind, sind die esoterischen,<br />
für den internen Gebrauch<br />
vorgesehenen, größtenteils (selbstverständlich<br />
nur in Abschriften) erhalten<br />
geblieben. Man ordnet üblicher Weise<br />
das sehr umfangreiche Werk in die<br />
Schriften zur Logik (die Kategorienlehre<br />
enthält die beiden Analytiken, nämlich<br />
die Lehre von den Schlüssen und<br />
von der Beweisführung und die Topik<br />
die „Dialektik“), die Schriften zur Naturwissenschaft<br />
(8 Bücher über Physik<br />
sowie Schriften über die Lebewesen),<br />
die Schriften zur Metaphysik (die Lehre<br />
von den allgemeinen Ursachen der<br />
Dinge), die Schriften zur Ethik (die 10<br />
Bücher der „Nikomachischen Ethik“),<br />
die 8 Bücher zur Politik und Schriften<br />
zur Literatur und Rhetorik.<br />
Ein zentraler Gedanke der aristotelischen<br />
Physik betrifft die allerorts vermutete<br />
Zweckmäßigkeit. Da das, was<br />
regelmäßig auftritt, nicht vom Zufall<br />
hergeleitet werden kann, erklärt Aristoteles<br />
diese durchgängige Zweckmäßigkeit<br />
der Natur mit der Behauptung,<br />
dass der eigentliche Grund der Dinge in<br />
ihren Endursachen, ihrer Zweckbestimmung,<br />
liegen müsse. Man nennt diese<br />
Art der Naturerklärung teleologisch.<br />
Das Lebendige sieht er dadurch ausgezeichnet,<br />
dass es sich selbst bewegen<br />
kann. Aus dem in der Metaphysik formulierten<br />
Gedanken, dass Bewegung<br />
nur geschehen könne, wo neben Bewegtem<br />
auch Bewegendes ist, schließt<br />
er, dass das, was sich selbst bewegt,<br />
sowohl ein Bewegtes wie auch ein<br />
Bewegendes in sich enthalten müsse.<br />
Das Bewegte wird als der Leib, das Bewegende<br />
als die Seele bestimmt. Die<br />
den Leib bewegende und formende<br />
Seele nennt Aristoteles „Entelechie“.<br />
Diese ist bei ihm Zweck des Leibes.<br />
Als unterste Stufe des Organischen<br />
nennt Aristoteles die Pflanzen mit ihren<br />
Lebensfunktionen Ernährung und<br />
Fortpflanzung, bei den Tieren tritt die<br />
Fähigkeit zur Sinneswahrnehmung<br />
und Ortsveränderung hinzu, beim<br />
Menschen die Fähigkeit zu denken.<br />
Entsprechend unterscheidet er drei<br />
Arten von Seelen: die ernährende<br />
oder Pflanzenseele, die empfindende<br />
oder Tierseele und die denkende oder<br />
Menschenseele, wobei die jeweils höhere<br />
nicht ohne die niedere bestehen<br />
könne.<br />
Zu den niederen Seelentätigkeiten tritt<br />
also beim Menschen der Geist, meint<br />
Aristoteles. Er sei unsterblich und<br />
vergehe nicht mit dem Leib. Höchstes<br />
Gut des Menschen ist für Aristoteles<br />
(wie für die meisten anderen Hellenen)<br />
die Glückseligkeit. Für jedes Lebewesen<br />
sieht er die Vollkommenheit<br />
in der vollkommenen Ausbildung der<br />
ihm eigentümlichen Tätigkeit, also<br />
beim Menschen die Ausbildung seines<br />
Vernunftwesens. Darin besteht die<br />
Tugend. Entsprechend der doppelten<br />
Natur des Menschen unterscheidet<br />
Aristoteles zwei Arten von Tugenden:<br />
die ethischen Tugenden bestehen in<br />
der Herrschaft der Vernunft über die<br />
sinnlichen Triebe, die dianoetischen<br />
Tugenden bestehen in der Steigerung<br />
und Vervollkommnung der Vernunft<br />
selbst.<br />
Darüber hinaus bestimmt Aristoteles<br />
den Menschen als ein zoon politikon,<br />
ein geselliges Lebewesen, das der Gemeinschaft<br />
mit anderen bedarf. Er ist<br />
also gleichsam darauf angelegt, Staaten<br />
zu bilden. Und wie der sittlich beste<br />
Mensch nach Aristoteles der glückseligste<br />
ist, so erscheint ihm auch der<br />
Staat als glückselig, wenn er bestens<br />
funktioniert. Die Gemeinschaft ist hier<br />
also um des Menschen willen da, und<br />
alle Politik muss sich demzufolge nach<br />
dem sittlichen Ziel desselben richten.<br />
Die sittliche Gemeinschaft der Bürger<br />
in einem auf Gesetz und Tugend<br />
gegründeten guten Staat gilt ihm als<br />
höchste und eigentliche Form der Sittlichkeit.<br />
Während die Betrachtung der<br />
Tugend nur die Vorstufe und der theoretische<br />
Teil der Ethik bei ihm ist, ist<br />
die Staatslehre ihr angewandter und<br />
praktischer Teil.<br />
Aristoteles gemalt<br />
von Raffaello Santi<br />
(1483-1520)<br />
Unter den Verfassungen unterscheidet<br />
unser Philosoph zwischen Monarchie<br />
(Herrschaft eines einzelnen), Aristokratie<br />
(Herrschaft weniger) und Politie<br />
(Herrschaft vieler), Tyrannis, Oligarchie<br />
und Demokratie hält er für Entartungen<br />
dieser Formen. Keiner gibt er<br />
absoluten Vorrang, vielmehr fordert<br />
er, dass die Verfassung sich nach den<br />
konkreten Erfordernissen angesichts<br />
gegebener Menschen und Umstände<br />
richten müsse. Stetigkeit und Vermeidung<br />
von Extremen sind ihm dabei die<br />
wichtigsten Kriterien.<br />
Ähnlich wie Plato entwirft auch Aristoteles<br />
eine Lehre des idealen Staates,<br />
die aber unvollendet blieb. Klar allerdings<br />
ist, dass auch er den idealen<br />
Staat lediglich innerhalb der engen<br />
Grenzen der griechischen Stadtstaaten<br />
denkt, zu seiner Zeit sich eigentlich<br />
schon abzeichnende Reichsbildungen<br />
spielen in seinem Denken keine Rolle.<br />
Sklaverei ist ihm eine Selbstverständlichkeit,<br />
Ehe, Familie und Gemeinde<br />
haben einen sehr hohen Stellenwert.<br />
Platos Forderung, Ehe und Privateigentum<br />
dem Staat zu opfern, lehnt er<br />
allerdings ab. Hier werde, so seine Begründung,<br />
der Staat als einheitliches<br />
Wesen gedacht, während dieser doch<br />
ein in Untergemeinschaften gegliedertes<br />
Ganzes sein müsse.<br />
Literatur:<br />
Höffe, Ottfried (Hg.), 2009: Aristoteles. Die Hauptwerke,<br />
Tübingen: Francke<br />
Höffe, Ottfried, 1996: Aristoteles, München: Beck<br />
Knoll, Manuel, 2009: Aristokratische oder demokratische<br />
Gerechtigkeit? München u.a.: Fink