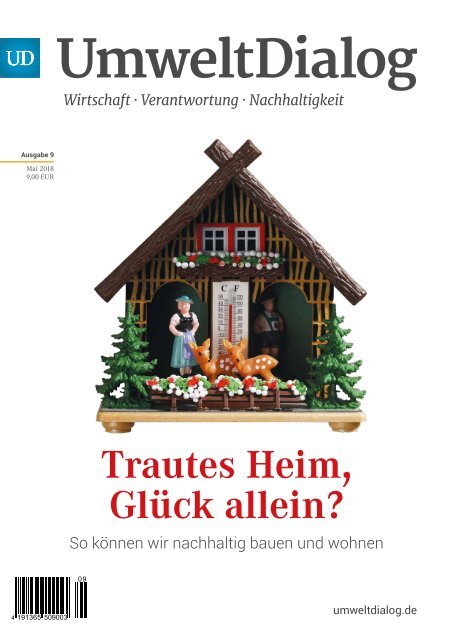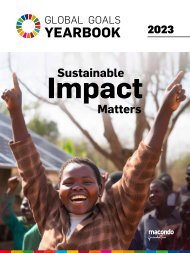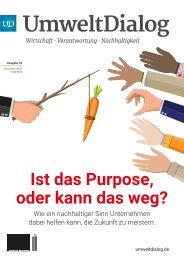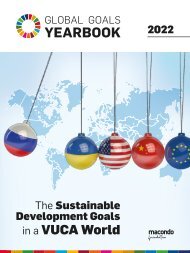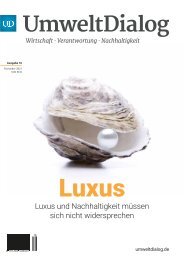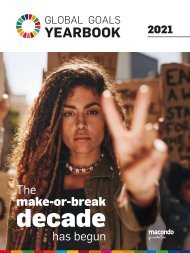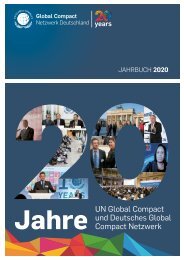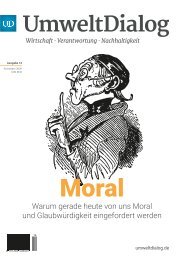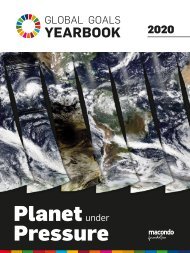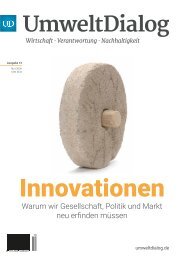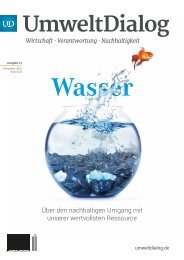Nachhaltig bauen: Themen, Trends und Tipps
Explodierende Immobilienpreise in der Stadt und ein immenser Ressourcenverbrauch im Bausektor: Längst ist das Wohnen zu einer sozialen und ökologischen Frage geworden. Hier sind nachhaltige Lösungen aus Politik und Wirtschaft gefragt. Aber auch der Einzelne kann seine Art zu Wohnen verantwortungsvoll gestalten. Wie, das zeigt das neue UmweltDialog-Magazin „Trautes Heim, Glück allein? So können wir nachhaltig bauen und wohnen“.
Explodierende Immobilienpreise in der Stadt und ein immenser Ressourcenverbrauch im Bausektor: Längst ist das Wohnen zu einer sozialen und ökologischen Frage geworden. Hier sind nachhaltige Lösungen aus Politik und Wirtschaft gefragt. Aber auch der Einzelne kann seine Art zu Wohnen verantwortungsvoll gestalten. Wie, das zeigt das neue UmweltDialog-Magazin „Trautes Heim, Glück allein? So können wir nachhaltig bauen und wohnen“.
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Ausgabe 9<br />
Mai 2018<br />
9,00 EUR<br />
Trautes Heim,<br />
Glück allein?<br />
So können wir nachhaltig <strong>bauen</strong> <strong>und</strong> wohnen<br />
umweltdialog.de
UND WIE VIEL CO 2 SPAREN SIE BEIM<br />
DRUCK IHRER DOKUMENTE?<br />
TONER<br />
CO 2<br />
-NEUTRAL *<br />
Umweltbewusstsein in Firmen sollte über das Fuhrpark-Management hinausgehen. PRINT GREEN von KYOCERA Document Solutions<br />
bietet Ihnen ein ganzes Maßnahmenbündel für ressourcenschonendes <strong>und</strong> klimabewusstes Drucken. Intelligente Hard- <strong>und</strong> Software-<br />
Lösungen helfen Ihnen, Papier- <strong>und</strong> Verbrauchsmaterial zu sparen. Mit dem CO2-neutralen Toner* von KYOCERA handeln Sie sogar<br />
schon bei der Beschaffung klimabewusst. So endet Um welt be wusst sein nicht auf dem Parkdeck, sondern wird zum festen Bestandteil<br />
der täglichen Arbeit.<br />
KYOCERA Document Solutions Deutschland GmbH<br />
www.kyoceradocumentsolutions.de<br />
* Nur bei Vertrieb durch KYOCERA Document Solutions Deutschland, Österreich oder Schweiz.
Bauen <strong>und</strong> Wohnen<br />
Liebe Leserinnen<br />
<strong>und</strong> Leser,<br />
Städte sind sozial hochkomplexe Orte.<br />
Hier treffen wir bei jedem Schritt auf<br />
Bauten aus der Vergangenheit <strong>und</strong> auf<br />
hypermoderne Gebäude, die uns zeigen,<br />
was die Zukunft bringt. Hier in<br />
der Stadt findet sich alles <strong>und</strong> das zumeist<br />
auf engstem Raum: Unfassbarer<br />
Luxus neben unhaltbarer Armut, Anonymität<br />
neben Gemeinschaft. Hier<br />
vermischen oder auch scheiden sich<br />
öffentlich <strong>und</strong> privat, Inklusion <strong>und</strong><br />
Ausgrenzung.<br />
Nirgendwo treten diese Gegensätze<br />
deutlicher hervor, als eben in der<br />
Stadt. Da die meisten von uns heute in<br />
urbanem Umfeld wohnen <strong>und</strong> dieser<br />
Trend global unumkehrbar ist, fällt<br />
unser Blick in dieser Ausgabe vor allem<br />
auf das Leben in Metropolen <strong>und</strong><br />
damit verb<strong>und</strong>en auf die Frage, was<br />
nachhaltiges Wohnen ausmacht.<br />
Erste Beobachtung: In der Stadt ist<br />
jeder Raum zugleich immer auch politisch.<br />
Und die Frage, wie wir diesen<br />
Raum gestalten, sagt sehr viel darüber<br />
aus, wie wir in Zukunft leben werden.<br />
Wie kann z.B. <strong>Nachhaltig</strong>keit funktionieren,<br />
wenn nicht auch unser Wohn<strong>und</strong><br />
Arbeitsumfeld aus ökologischen<br />
Baustoffen besteht? Was nützt uns die<br />
schönste Metropole, wenn der Wohnraum<br />
unbezahlbar oder nicht resilient<br />
für die Folgen des Klimawandels ist?<br />
Zweite Beobachtung: <strong>Nachhaltig</strong>keit<br />
wird zum neuen Standard beim Bauen.<br />
Das gilt übrigens nicht nur für das private<br />
Umfeld, sondern noch viel mehr<br />
für die modernen Büros von heute. Da<br />
gibt es immer pfiffigere neue Lösungen<br />
wie beispielsweise Flüssigkristallfenster<br />
oder auch die Einbindung<br />
von Natur am Arbeitsplatz.<br />
Dritte Beobachtung: <strong>Nachhaltig</strong>keit<br />
ist die neue Heimat, schreibt Alexandra<br />
Hildebrandt, <strong>und</strong> beleuchtet, wie<br />
wir über unsere Art des Wohnens<br />
unsere Art des Privaten definieren.<br />
Dabei gibt es ganz starke Tendenzen<br />
zur Individualität, klar, aber auch zu<br />
neuen Formen von Gemeinschaft:<br />
Schloss Tempelhof oder das Seniorendorf<br />
Uhlenbusch zeigen, wie wir das<br />
Miteinander im 21. Jahrh<strong>und</strong>ert neu<br />
denken können.<br />
Damit beantworten wir übrigens zu<br />
guter Letzt auch eine sehr gr<strong>und</strong>sätzliche,<br />
politische Frage: Wem gehört<br />
die Stadt? Ist alles nur eine Frage des<br />
Geldes? Oder macht den modernen<br />
Stadtbürger, den Citoyen, nicht auch<br />
der Wunsch nach möglichst großem<br />
individuellem Freiraum <strong>und</strong> zugleich<br />
geteilter Verantwortung aus?<br />
Viel Spaß beim Lesen wünscht im<br />
Namen der gesamten Redaktion Ihr<br />
Dr. Elmer Lenzen<br />
Chefredakteur<br />
Die nächste Ausgabe<br />
UmweltDialog erscheint am<br />
16.11.2018
6<br />
Die Wohnungsfrage ist<br />
zurück. Sie zu lösen, ist<br />
nicht einfach.<br />
Inhalt<br />
STADT, LAND, FRUST<br />
Deutschland wohnt sich arm.............................................. 6<br />
Die Wohnungsfrage ist zurück. Sie zu lösen, ist<br />
nicht einfach.<br />
Wo ist denn hier noch Platz? ........................................... 12<br />
Wie plant man eine lebenswerte, nachhaltige Stadt,<br />
in der die Menschen sich wohlfühlen? Fragen an den<br />
Architekten Jan Gehl.<br />
Wie der Klimawandel unsere Städte verändert............. 16<br />
Extremregen, Überflutung oder Hitzesommer:<br />
Um für die Zukunft gewappnet zu sein, müssen<br />
sich Städte an den Klimawandel anpassen.<br />
Klimametropole Kopenhagen ...........................................20<br />
Klimaneutral bis 2025? In der dänischen<br />
Hauptstadt weiß man, wie das geht.<br />
Eine Sonnenbrille für Fenster............................................32<br />
Intelligente Fenster sorgen für ein angenehmes Raumklima<br />
<strong>und</strong> Energieeinsparungen. Merck stellt die dafür<br />
notwendige Technologie zur Verfügung.<br />
Die leisen Emissionen........................................................34<br />
Die meiste Zeit des Tages sind wir drinnen. Das Problem:<br />
Dort ist die Luft nicht sauber.<br />
Wenn der Sand ausgeht.....................................................36<br />
Bauvorhaben verbrauchen weltweit so viel Sand <strong>und</strong><br />
Kies, dass der Rohstoff in einigen Gegenden bereits<br />
knapp wird. Alternative Baustoffe sind gefragt.<br />
Urban Mining .......................................................................40<br />
Ziegel, Gips, Beton, Stahl oder Metalle: Städte sind das<br />
reinste Materiallager. Urban Mining will diese Rohstoffe<br />
im Kreislauf halten.<br />
NACHHALTIGE BÜROWELTEN<br />
MATERIAL UND WIRTSCHAFT<br />
Baubranche: <strong>Nachhaltig</strong>keit wird zum Standard..........22<br />
Kaum eine andere Branche verbraucht so viele<br />
Ressourcen <strong>und</strong> produziert so viel Müll wie der<br />
Bausektor. Zeit zum Umdenken.<br />
Energieeffizient <strong>bauen</strong> <strong>und</strong> wohnen................................26<br />
Keine Energiekosten, Nullemissionen <strong>und</strong> ein ges<strong>und</strong>es<br />
Raumklima – sieht so das Gebäude der Zukunft aus?<br />
Zertifizierte Gebäude..........................................................30<br />
<strong>Nachhaltig</strong>e Bürogebäude mit Vorbildcharakter<br />
Kleine Biotope zwischen Wolkenkratzern<br />
<strong>und</strong> Maschinenpark............................................................42<br />
Immer mehr Unternehmen engagieren sich für den Artenschutz.<br />
Die Firmengelände bieten hierfür zahlreiche<br />
Möglichkeiten.<br />
Klimaschutz vom Keller bis zum Dach ...........................46<br />
Wie Markus Pfeil aus Gebäuden ganzheitliche Energiesparer<br />
macht<br />
Natur am Arbeitsplatz........................................................ 47<br />
In der Natur fühlen wir uns wohl. Biophilic Design<br />
macht dieses Gefühl für das Büro nutzbar.
Bauen <strong>und</strong> Wohnen<br />
ALTERNATIVE WOHNKONZEPTE<br />
Zum Wandel des Wohnens................................................50<br />
Wir müssen immer weniger in der Wohnung erledigen.<br />
Warum halten wir dennoch weiter an unseren vier<br />
Wänden fest?<br />
Architektur eines neuen Lebenskonzepts......................54<br />
Die Sharing Economy brachte in den letzten Jahren die<br />
herrschende Ordnung in vielen Lebens- <strong>und</strong> Wirtschaftsbereichen<br />
vollständig durcheinander. Lässt sich dieses<br />
Prinzip auch auf unsere Wohnkultur übertragen?<br />
Einfach mal Platz sparen...................................................58<br />
Wohnraum ist rar <strong>und</strong> teuer. Aber es gibt Möglichkeiten,<br />
auf „kleinem Fuße“ zu leben.<br />
22<br />
Baubranche:<br />
<strong>Nachhaltig</strong>keit wird zum<br />
Standard<br />
<strong>Nachhaltig</strong>keit ist die neue Heimat ................................62<br />
Die Welt um uns herum ist laut <strong>und</strong> hektisch. Zu Hause<br />
muss es deswegen gemütlich sein. Moderne Wohnkultur<br />
greift diesen Wunsch auf.<br />
Besser wohnen dank „fließendem Qi“............................66<br />
<strong>Nachhaltig</strong>e Wohnkonzepte im Überblick<br />
Schloss Tempelhof .............................................................69<br />
Gegen den Trend: Das Dorf hat eine Zukunft, wenn die<br />
Vision stimmt.<br />
Wer will schon ins Altersheim?......................................... 74<br />
Der demografische Wandel erfasst schrittweise alle<br />
Bereiche unserer Gesellschaft, auch unser Zuhause.<br />
Quartiere <strong>und</strong> Wohndesign müssen sich daran anpassen.<br />
(Gem)einsam alt werden?.................................................. 76<br />
Wer denkt, dass WGs nur was für Studenten sind, der<br />
irrt sich. Immer mehr Menschen suchen im Alter die<br />
Gemeinschaft.<br />
58<br />
Einfach mal Platz sparen<br />
– Konzepte für kleine<br />
Wohnflächen<br />
FORSCHUNG UND ENTWICKLUNG<br />
Es kommt Leben in die Hütte............................................ 78<br />
Pilze <strong>und</strong> Bakterien haben beim Wohnungsbau oder gar<br />
im Haushalt nichts zu suchen. Oder doch? Unser Bild der<br />
winzigen Lebewesen könnte sich in den nächsten Jahren<br />
radikal verändern.<br />
Holland in Not......................................................................80<br />
Wenn der Meeresspiegel steigt, wissen die Niederländer,<br />
was zu tun ist. Künftig wollen sie sogar Lebensmittel auf<br />
dem Wasser an<strong>bauen</strong>.<br />
74<br />
Wer will schon ins<br />
Altersheim?
Bauen <strong>und</strong> Wohnen<br />
Von Sonja Scheferling<br />
Die Menschen zieht es in die Großstadt. Doch dort ist<br />
der Wohnraum knapp <strong>und</strong> teuer. Neubauten gehen oft<br />
am Bedarf vorbei <strong>und</strong> bedienen nur die Nachfrage der<br />
Reichen. Folglich sind die steigenden Immobilien- <strong>und</strong><br />
Mietpreise für viele zu hoch <strong>und</strong> die Kosten überfordern<br />
sie. Den ländlichen Regionen hingegen drohen durch<br />
Abwanderung <strong>und</strong> demografischen Wandel massenweise<br />
Leerstände <strong>und</strong> der Preis der Eigenheime verfällt.<br />
Die Wohnungsfrage ist mit aller Macht zurück auf der<br />
politischen Agenda: Sie hat verschiedene Aspekte <strong>und</strong><br />
Gründe, weitreichende Folgen für die Gesellschaft <strong>und</strong><br />
ist nicht auf die Schnelle zu lösen. Ein Überblick.<br />
6<br />
Ausgabe 9 | Mai 2018 | Umweltdialog.de
Bauen <strong>und</strong> Wohnen<br />
Grafik: shutterstock.com<br />
Ausgabe 9 | Mai 2018 | Umweltdialog.de<br />
7
Bauen <strong>und</strong> Wohnen<br />
Anschreiben <strong>und</strong> Lebenslauf<br />
zusammengefasst in einer<br />
Bewerbungsmappe, dazu ein<br />
ansprechendes Äußeres <strong>und</strong> feste Benimmregeln:<br />
Die Wohnungssuche in<br />
Großstädten gleicht heutzutage einem<br />
Vorstellungsgespräch. Natürlich ist<br />
niemand dazu verpflichtet, persönliche<br />
Angaben gegenüber Makler <strong>und</strong><br />
Vermieter zu machen. Doch in der Regel<br />
kommen Bewerber kaum an einer<br />
Selbstauskunft vorbei, konkurrieren<br />
sie doch mit H<strong>und</strong>erten weiterer Interessenten<br />
um die wenigen Wohnungen,<br />
die bezahlbar sind. Und einer von<br />
denen hat bestimmt Einkommensnachweis<br />
<strong>und</strong> Schufa-Auskunft parat.<br />
Zum Dank darf man dann auch noch<br />
50 Euro bezahlen, um die Wohnung<br />
zu besichtigen.<br />
Wie prekär die Wohnungsknappheit<br />
ist, zeigt eine aktuelle Studie der gewerkschaftsnahen<br />
Hans-Böckler-Stiftung.<br />
Demnach fehlten in deutschen<br />
Großstädten fast zwei Millionen bezahlbare<br />
Wohnungen, die sich die<br />
lokale Bevölkerung gemessen an ihren<br />
finanziellen Möglichkeiten leisten<br />
könne. Das heißt, dass die Miete<br />
nicht mehr als 30 Prozent des Haushaltseinkommens<br />
verschlingen sollte.<br />
Der größte Mangel herrsche dabei vor<br />
allem bei kleinen Wohnungen.<br />
Angeführt wird die Liste von Berlin,<br />
wo über 300.000 Wohnungen fehlen,<br />
gefolgt von Hamburg (150.000), Köln<br />
(86.000) <strong>und</strong> München (78.000). Und<br />
selbst in Großstädten mit relativ kleinen<br />
Versorgungslücken wie beispielsweise<br />
Moers, Wolfsburg oder Koblenz<br />
überschreite der Bedarf an günstigen<br />
Wohnungen das Angebot jeweils um<br />
mehrere Tausend.<br />
Zu wenig Wohnraum, zu hohe<br />
Kosten <strong>und</strong> Zielkonflikte<br />
Das mangelnde Wohnraumangebot in<br />
begehrten Regionen – ob als Eigenheim<br />
oder zur Mietnutzung – wird<br />
allgemein als ein wesentlicher Kostentreiber<br />
für die urbanen Immobilien-<br />
<strong>und</strong> Mietpreise angesehen. Seine<br />
Ursachen: Es ziehen immer mehr<br />
Menschen in die Stadt. Dort warten<br />
Jobs <strong>und</strong> Studienplätze; die Daseinsvorsorge<br />
<strong>und</strong> das kulturelle Angebot<br />
sind besser ausgebaut. Darüber hinaus<br />
benötigen immer mehr Menschen<br />
Zweit- <strong>und</strong> Singlewohnungen, <strong>und</strong><br />
die durchschnittliche Wohnfläche pro<br />
Person hat sich seit Ende des zweiten<br />
Weltkriegs mit 45 Quadratmetern verdreifacht:<br />
„Dabei wird seit Jahren zu<br />
wenig gebaut: Von 140.000 Mietwohnungen,<br />
die jährlich entstehen müssten,<br />
wurde 2015 lediglich ein Drittel<br />
fertiggestellt“, informiert die Caritas.<br />
Aber wer <strong>bauen</strong> möchte, benötigt<br />
Fläche. Und die ist hierzulande eine<br />
Neubau alleine reicht nicht<br />
Mangelware: „Selbst Städte mit starker<br />
Wohnungsnachfrage <strong>und</strong> geeigneten<br />
Flächen tun sich mitunter<br />
schwer, neue Gr<strong>und</strong>stücke für den<br />
Wohnungsbau auszuweisen“, erklärt<br />
Michael Voigtländer vom Institut der<br />
deutschen Wirtschaft (IW). In diesem<br />
Bereich kommt es also zu einem<br />
klassischen Zielkonflikt zwischen der<br />
sozialen Notwendigkeit nach mehr<br />
Wohnraum <strong>und</strong> dem ökologischen<br />
Anspruch nach einem nachhaltigen<br />
Ressourcenumgang, der den Schutz<br />
unbebauter Flächen mit einschließt.<br />
Deswegen plädieren viele Experten<br />
für eine konsequente Nachverdichtung<br />
freier Flächen in bereits bebauten<br />
Gebieten, um dieses Dilemma aufzulösen.<br />
Darüber hinaus klagen Immobilien<strong>und</strong><br />
Branchenverbände auch über die<br />
hohen Kosten, die beim Bauen etwa<br />
durch Standards oder Umweltauflagen<br />
entstünden. Aus diesem Gr<strong>und</strong><br />
würde sich teilweise nur die Errichtung<br />
von Luxusgebäuden mit hohen<br />
Wer allerdings meint, die hohen Preise ließen sich alleine durch reinen<br />
Neubau lösen, den belehrt die Studie der Böckler-Stiftung eines Besseren.<br />
Denn die Mieten für neue Wohnungen übersteigen in fast allen Großstädten<br />
die Bestandsmieten. Um die Lücke bei bezahlbaren Wohnungen zu<br />
verkleinern, müsse das Angebot an Kleinwohnungen von vier bis fünf Euro<br />
pro Quadratmeter steigen: „Das ist nur durch eine deutliche Stärkung des<br />
sozialen Wohnungsbaus möglich. Dazu müssen einerseits mehr Sozialwohnungen<br />
als in den vergangenen Jahren entstehen. Andererseits muss<br />
auch die Sozial- <strong>und</strong> Mietpreisbindung im Wohnungsbestand wieder<br />
ausgeweitet werden“, sagen die Stadtsoziologen der HU Berlin <strong>und</strong> der GU<br />
Frankfurt, die die Studie durchgeführt haben.<br />
8 Ausgabe 9 | Mai 2018 | Umweltdialog.de
Bauen <strong>und</strong> Wohnen<br />
Mieteinnahmen rentieren. Für Hanno Rauterberg von der<br />
ZEIT ist dieses Argument zu kurz gegriffen: „In München<br />
hat sich der Preis für Gr<strong>und</strong>stücke verdreifacht – in nur<br />
zehn Jahren. Und so sind es nicht bloß teure Handwerksrechnungen<br />
oder aufwendige Dämmstoffe, nicht allein Arbeit<br />
<strong>und</strong> Material <strong>und</strong> der deutsche Vorschriftswahn, die<br />
eine Wohnung zum Luxusgut machen“, so Rauterberg. „Es<br />
ist vor allem der Boden. Er lässt die Baupreise so weit steigen,<br />
dass bei einem neuen Haus bis zu 70 Prozent des Budgets<br />
allein für das Gr<strong>und</strong>stück draufgehen.“ Daher erweise<br />
sich die Wohnkrise als großer Treiber der aktuellen sozialen<br />
Ungerechtigkeit: „Wäre die Gesellschaft nicht gespalten<br />
– in Gr<strong>und</strong>besitzer <strong>und</strong> Gr<strong>und</strong>lose – würde die Kluft<br />
zwischen Arm <strong>und</strong> Reich nicht so weit aufspringen.“<br />
Wohnen ist kein<br />
Wirtschafts-, sondern<br />
ein Sozialgut.„<br />
Politik ist in der Pflicht<br />
Die aktuelle Sorge über zunehmende Verdrängungseffekte<br />
<strong>und</strong> mangelnde Teilhabe breiter gesellschaftlicher Schichten<br />
am städtischen Wohnungsmarkt ist keineswegs neu. So<br />
sprach beispielsweise Björn Egner von der TU Darmstadt<br />
bereits vor einigen Jahren in diesem Zusammenhang von<br />
Marktversagen, da die Wohnungsraumnachfrage zwar zu<br />
höheren Preisen, aber nicht der Logik entsprechend zu<br />
mehr Angebot geführt habe: „Dies wird dadurch deutlich,<br />
dass Wohnungsmärkte ohne politische Steuerung Ergebnisse<br />
produzieren, die sozial nicht erwünscht sind. Die<br />
Einsicht macht sich wieder verstärkt geltend, dass Wohnen<br />
kein Wirtschafts-, sondern ein Sozialgut ist <strong>und</strong> deshalb politische<br />
Eingriffe notwendig sind.“<br />
Und die Politik hat nun versprochen zu liefern. Im aktuellen<br />
Koalitionsvertrag hat die Regierung ein Milliardenpaket<br />
vereinbart, das den Wohnungsbau ankurbeln <strong>und</strong><br />
sozialverträglicher machen soll. Insgesamt sollen so durch<br />
verschiedene Maßnahmen über 1,5 Millionen Wohnungen<br />
<strong>und</strong> Eigenheime privat finanziert <strong>und</strong> durch öffentliche<br />
Förderung entstehen. Zu diesen Maßnahmen gehört die<br />
Einführung eines Baukindergeldes, die Bereitstellung von<br />
zwei Milliarden Euro für den sozialen Wohnungsbau oder<br />
die Einführung einer Gr<strong>und</strong>steuer C für Brachflächen, die<br />
Eigentümer dazu drängen soll, die Gr<strong>und</strong>stücke zu be<strong>bauen</strong><br />
oder zu verkaufen, anstelle auf höhere Preise zu spekulieren.<br />
Die bis dato gescheiterte Mietpreisbremse plant die<br />
Regierung zu verschärfen.<br />
Wohnungsfrage: Masse, Polarisierung <strong>und</strong> Qualität<br />
Die Wohnungsfrage in der Stadt hat weitreichende Folgen<br />
für unsere Gesellschaft. Alleinerziehende, Studenten, alte<br />
<strong>und</strong> einkommensschwache Menschen überfordern sich<br />
finanziell oder ziehen in billige Randlagen mit schlechter<br />
Infrastruktur; bleiben können nur diejenigen mit reichen<br />
Eltern oder einem sehr hohen Gehalt. Verstärkt wird dieser<br />
Effekt noch durch den Trend der Gentrifizierung attraktiver<br />
Stadtteile, der zum Austausch ganzer Bevölkerungsgruppen<br />
durch zahlungskräftige Eigentümer <strong>und</strong> Mieter führt.<br />
Auf diese Weise kommt es zu einer sozialräumlichen Polarisierung<br />
innerhalb der Städte: „Immer mehr Menschen<br />
erfahren, dass sie nahezu chancenlos auf dem Wohnungsmarkt<br />
sind“, sagt etwa Caritas-Präsident Peter Neher. Der<br />
Sozialverband hat Anfang des Jahres eine Kampagne >><br />
Grafik: shutterstock.com<br />
Ausgabe 9 | Mai 2018 | Umweltdialog.de<br />
9
Bauen <strong>und</strong> Wohnen<br />
gegen Wohnungsnot gestartet: „Wenn<br />
zunehmend der Geldbeutel bestimmt,<br />
wie sich Stadtteile <strong>und</strong> Quartiere zusammensetzen,<br />
führt dies zu einem<br />
Auseinanderdriften von Milieus <strong>und</strong><br />
schwächt so den gesellschaftlichen<br />
Zusammenhalt.“<br />
Neben der Masse <strong>und</strong> der sozialräumlichen<br />
Entwicklung der Stadt spielt<br />
auch die Qualität der Wohnungen eine<br />
entscheidende Rolle, um die Situation<br />
der Bewohner zu beurteilen. So können<br />
sich Benachteiligte in der Regel<br />
vor allem schlecht ausgestattete Altbauwohnungen<br />
<strong>und</strong> Siedlungsbauten<br />
leisten: „Eine zweite Problemgruppe<br />
stellen die etwa eine Million Wohnungen<br />
dar, die im Zuge der massiven<br />
Privatisierung von institutionellen<br />
Anlegern erworben worden sind“,<br />
sagt der Sozialwissenschaftler Andrej<br />
Holm. „In Beständen, die nicht gewinnbringend<br />
weiterverkauft werden<br />
konnten, sind die Finanzinvestoren zu<br />
Bestandshaltern wider Willen geworden<br />
<strong>und</strong> versuchen vielerorts, durch<br />
Deinvestitionsstrategien das Verhältnis<br />
von Einnahmen <strong>und</strong> Ausgaben<br />
profitabel zu gestalten.“ Dadurch würden<br />
Häuser nicht instandgehalten <strong>und</strong><br />
das Wohnumfeld verwahrlose.<br />
Verfassungsauftrag: Gleichwertige<br />
Lebensverhältnisse<br />
Menschenwürdige Qualität, eine hinreichende<br />
Anzahl von Wohnungen,<br />
die bezahlbar sind <strong>und</strong> von jedem unabhängig<br />
von Geschlecht, Alter oder<br />
Demografischer Wandel <strong>und</strong> Klimawandel bestimmen<br />
künftig Qualität<br />
Die Wohnungsqualität zeigt sich künftig auch daran, ob sie die Bedürfnisse<br />
nach Barrierefreiheit einer alternden Gesellschaft befriedigen kann.<br />
Ziel ist es, dass Menschen so lange wie möglich selbstbestimmt in ihren<br />
eigenen vier Wänden leben können. Darüber hinaus stellt der Klimawandel<br />
völlig neue Herausforderungen an die Wohnungsqualität. So müssen<br />
Standortauswahl <strong>und</strong> Baumaterialien an extreme Wetterereignisse wie<br />
Hitzeperioden angepasst werden, damit Wohnräume weiterhin ihre Bewohner<br />
vor der Umwelt schützen können.<br />
Hautfarbe gemietet werden können:<br />
Das müsste in Deutschland eigentlich<br />
selbstverständlich sein. Denn Wohnen<br />
ist ein Menschenrecht, <strong>und</strong> es ist im<br />
Internationalen Pakt über wirtschaftliche,<br />
soziale <strong>und</strong> kulturelle Rechte<br />
verankert. Deutschland muss es umsetzen,<br />
unabhängig davon, ob das<br />
Recht auf Wohnen im Gr<strong>und</strong>gesetz<br />
steht oder nicht. Außerdem verfolgt<br />
die B<strong>und</strong>esrepublik den Verfassungsauftrag,<br />
gleichwertige Lebensverhältnisse<br />
hierzulande zu gewährleisten.<br />
Das bezieht sich auf menschenwürdige<br />
Wohnverhältnisse genauso wie<br />
auf eine Gr<strong>und</strong>infrastruktur, die eine<br />
flächendeckende Daseinsvorsorge sicherstellt.<br />
Auf diese Weise soll jeder,<br />
unabhängig von seinem Wohnort, gleiche<br />
gesellschaftliche Teilhabechancen<br />
haben.<br />
Dieses Ziel ist aber gerade auf dem<br />
Land immer schwieriger umzusetzen.<br />
In Regionen, die besonders stark von<br />
der Landflucht betroffen sind, wie<br />
Teile Ostdeutschlands etwa, müssen<br />
die Menschen oft weite Wege bis zum<br />
nächsten Supermarkt oder zur nächsten<br />
Apotheke zurücklegen. Ohne Auto<br />
ist man aufgeschmissen. Das ist vor allem<br />
für ältere Menschen ein Problem,<br />
die nicht mehr fahren können. Sie sind<br />
dann auf Verwandte oder Hilfsdienste<br />
angewiesen. Ein weiteres Problem<br />
ist der chronische Ärztemangel auf<br />
dem Land. Wird ein Facharzttermin<br />
benötigt, müssen Patienten teilweise<br />
Monate warten. „B<strong>und</strong>, Länder <strong>und</strong><br />
Kommunen müssen insbesondere das<br />
Thema Mobilität <strong>und</strong> Daseinsfürsorge<br />
genauer in den Fokus nehmen, um<br />
bei Abwanderungstendenzen frühzeitig<br />
gegenzusteuern <strong>und</strong> Mindestversorgungen<br />
zu sichern“, sagt etwa<br />
Petra Wesseler, Präsidentin des B<strong>und</strong>esamts<br />
für Bauwesen <strong>und</strong> Raumordnung<br />
(BBR).<br />
Best Practice: Oberzent in Hessen<br />
Dabei sei es auch wichtig, Klein- <strong>und</strong><br />
Mittelstädte als Versorgungszentren<br />
für die umliegenden Orte zu stärken.<br />
10 Ausgabe 9 | Mai 2018 | Umweltdialog.de
Bauen <strong>und</strong> Wohnen<br />
mehr Mittel aus dem kommunalen Finanzausgleich des<br />
Landes. Das hat Oberzent außerdem Teile der Schulden erlassen,<br />
wie der Deutschlandfunk berichtet.<br />
Ein Ges<strong>und</strong>heitszentrum <strong>und</strong> schnelles Internet sollen die<br />
Region für junge Leute attraktiv machen. Günstige Kredite<br />
sollen ihnen den Umzug aus den überfüllten Großstädten<br />
der Metropolregion Rhein-Neckar schmackhaft machen,<br />
denn leerstehende Gebäude gibt es in Oberzent zur Genüge.<br />
Leerstand: gesellschaftliches Problem<br />
Grafik: shutterstock.com<br />
„Eine leistungsfähige digitale Infrastruktur auch im ländlichen<br />
Raum bietet Chancen, neue Versorgungs- <strong>und</strong> Mobilitätskonzepte<br />
zu entwickeln <strong>und</strong> auch langfristig neue Arbeitsplätze<br />
in der Region zu ermöglichen <strong>und</strong> zu erhalten.<br />
Die Gr<strong>und</strong>voraussetzungen hierfür zu schaffen, muss auch<br />
als Pflicht der Daseinsvorsorge verstanden werden, um die<br />
Wettbewerbsfähigkeit von Regionen zu gewährleisten“, ergänzt<br />
Wesseler.<br />
Wie das funktionieren kann, zeigt beispielsweise die Stadt<br />
Oberzent im Odenwald, die am 1. Januar 2018 aus einem<br />
Zusammenschluss von vier Kommunen hervorgegangen<br />
ist. Es ist die erste hessische Stadtgründung seit 40 Jahren;<br />
die große Mehrheit der Bewohner hatte dem Prozess per<br />
Volksentscheid zugestimmt. Ein Schritt, der für die hochverschuldeten<br />
Gemeinden unumstößlich war, stiegen die<br />
laufenden Kosten für die Infrastruktur bei sinkender Bevölkerungszahl<br />
doch ins Unermessliche. Für andere wichtige<br />
Projekte blieb kein Geld mehr übrig. Das ist nun anders.<br />
Denn durch die Stadtgründung ist Oberzent zur drittgrößten<br />
Kommune in Hessen geworden. Dadurch bekommt sie<br />
Den Leerstand in schrumpfenden Gebieten zu bekämpfen,<br />
ist eine der dringlichsten Aufgaben der ländlichen Wohnungspolitik.<br />
Auch wenn leerstehende Gebäude zunächst<br />
das Problem der Eigentümer sind, haben sie eine negative<br />
Auswirkung auf ihre Umgebung. Schlechte Vermietungschancen<br />
anderer Gebäude oder Vandalismus können die<br />
Folge sein. Was Gemeinden dagegen tun können? Zum<br />
einen müssen sie dafür sorgen, dass verfallene Gebäude<br />
abgerissen werden, um die Wohnqualität der Stadt zu<br />
erhalten. Zum anderen ist es wichtig, die Dorfzentren als<br />
Wohnort attraktiver zu gestalten <strong>und</strong> etwa den Bau neuer<br />
Einfamilienhäuser zu vermeiden, wie beispielsweise<br />
Michael Voigtländer vom IW sagt. Denn das würde die<br />
Zersiedelung der Regionen weiter befördern; die Leerstände<br />
blieben erhalten. Außerdem käme es künftig zu einem<br />
Preisverfall der Eigenheime, da die Nachfrage durch den<br />
Bevölerungsschw<strong>und</strong> sinke.<br />
Für den Immobilienexperten stellen die Folgen des Demografischen<br />
Wandels <strong>und</strong> des Leerstandes auf dem Land sogar<br />
eine größere Herausforderung für die Wohnungspolitik<br />
als die Preissteigerung in den Großstädten dar: „Schließlich<br />
zeigen die Schrumpfungsprozesse aufgr<strong>und</strong> des Strukturwandels,<br />
wie etwa im Ruhrgebiet <strong>und</strong> in Ostdeutschland,<br />
wie schwierig es ist, Abwärtsspiralen zu durchbrechen.<br />
Das ansteigende Durchschnittsalter wird es dabei nicht<br />
einfacher machen, die notwendigen Schritte zu gehen“, so<br />
Voigtländer. f<br />
Ausgabe 9 | Mai 2018 | Umweltdialog.de<br />
11
Wo<br />
ist<br />
denn<br />
hier<br />
Weniger Raum für Autos, mehr<br />
Mitbestimmung: Städte müssen<br />
vom Menschen her gedacht werden<br />
<strong>und</strong> nicht am Reißbrett geplant,<br />
sagt der Architekt Jan Gehl.<br />
noch<br />
Von Stefan Kesselhut<br />
Foto: BJOERN HENNRICHS / stock.adobe.com
Bauen <strong>und</strong> Wohnen<br />
Herr Gehl, in vielen Städten quälen<br />
sich Massen von Autos durch<br />
die Zentren, an den Rändern gibt es<br />
Hochhaussiedlungen, die zu sozialen<br />
Brennpunkten geworden sind. Was<br />
ist eigentlich schiefgelaufen?<br />
Seit den 1960er Jahren war die Stadtplanung<br />
auf der ganzen Welt für viele<br />
Jahre bestimmt von zwei großen<br />
Paradigmen. Zum einen wollten Planer<br />
alle Lebensbereiche voneinander<br />
trennen: Wohnen, Arbeiten, Kommunizieren.<br />
So sind in den Vorstädten<br />
Bettenburgen entstanden, von denen<br />
aus die Menschen in die Innenstadt<br />
pendeln. Und mit dem Paradigma des<br />
Motorismus haben sie versucht, die<br />
Autofahrer in den Städten glücklich<br />
zu machen.<br />
Sollte es Stadtplanern nicht eher darum<br />
gehen, alle Bewohner einer Stadt<br />
glücklich zu machen?<br />
Natürlich sollte es das. Aber im Modernismus<br />
haben sie alles vom Flugzeug<br />
aus geplant <strong>und</strong> sich die schönen<br />
Muster angeschaut, die sie erschufen.<br />
Um die Menschen auf dem Boden hat<br />
sich niemand geschert. Die konnte<br />
man von so weit oben ja auch gar nicht<br />
sehen. Mit dieser Methode waren die<br />
Planer sehr effizient darin, die Städte<br />
wenig einladend zu machen.<br />
Was sagen Sie heute der Verwaltung<br />
einer Stadt, wie sie etwas verbessern<br />
kann?<br />
Man muss sich viel mehr damit beschäftigen,<br />
welche Architektur wirklich<br />
funktioniert <strong>und</strong> welche nicht.<br />
Viel zu lange ging es in der Architektur<br />
nur darum, modische, beeindruckende<br />
Gebäude in die Städte zu<br />
setzen. Was diese mit den Städten<br />
machten, war nicht so wichtig <strong>und</strong><br />
wurde kaum untersucht.<br />
Woran liegt das?<br />
An vielen Universitäten wird Architektur<br />
mit großem Fokus auf Form<br />
<strong>und</strong> Ästhetik einzelner Bauten gelehrt<br />
– vor allem in Europa. Die Studenten<br />
lernen nicht viel über die Konsequenzen<br />
ihrer Arbeit in einer Stadt.<br />
Wenn man Architektur nur als Kunst<br />
begreift, hat man ein Problem. Denn<br />
wie soll man mit einem Künstler diskutieren,<br />
seine städtebauliche Arbeit<br />
kritisieren? Nach dem Motto: „Seien<br />
Sie doch froh, dass Frank Gehry hier<br />
in Ihrer Stadt ein Gebäude errichtet.<br />
Und jetzt halten Sie die Klappe!“<br />
War das überall so?<br />
Nein, in Kopenhagen zum Beispiel<br />
gab es früh eine systematische Erhebung<br />
über die Bewohner <strong>und</strong> ihr<br />
öffentliches Leben: für jeden Teil des<br />
Jahres, der Woche <strong>und</strong> des Tages. Wir<br />
haben einen kompletten Überblick<br />
bekommen, wie Menschen eine moderne<br />
Stadt nutzen. Wir haben verstanden,<br />
was passiert, wenn wir Dinge<br />
verändern. Wenn wir mehr Bäume<br />
pflanzen, mehr Bänke aufstellen,<br />
mehr Fußgängerzonen etablieren. So<br />
konnten wir genau verstehen, wie wir<br />
das Leben in einer Stadt zum Besseren<br />
ändern können.<br />
Helfen diese Erhebungen dabei, mehr<br />
politische Unterstützung für Ihre Vorschläge<br />
zu bekommen?<br />
Genau an diesem Punkt wird es für Politiker<br />
interessant: Wenn es nachweisbare<br />
Erfolge gibt, wollen sie schnell<br />
mehr davon. Als ich mich von der Kopenhagener<br />
Universität verabschiedet<br />
habe, schickte mir der Bürgermeister<br />
einen Brief mit den Worten: „Wenn<br />
Sie uns nicht mit Ihren Daten gezeigt<br />
hätten, wie die Stadt funktioniert,<br />
hätten wir Politiker niemals ge- >><br />
Ausgabe 9 | Mai 2018 | Umweltdialog.de<br />
13
Bauen <strong>und</strong> Wohnen<br />
Der Amagertorv (Amager Platz), einer der zentralen<br />
Plätze der dänischen Hauptstadt Kopenhagen<br />
Sind sie noch zu retten?<br />
Für die Lebensqualität spielt Sicherheit<br />
eine große Rolle. In einigen<br />
Städten versucht man, diese durch<br />
lückenlose Kameraüberwachung herzustellen.<br />
Kann die Stadtplanung da andere Lösungen<br />
finden?<br />
wagt, Kopenhagen zu einer der lebenswertesten<br />
Städte der Welt zu machen.“<br />
Dabei scheint es doch naheliegend,<br />
Daten über die eigene Stadt zu erheben<br />
…<br />
Wir wussten lange Zeit absolut nichts<br />
darüber, wie Menschen Architektur<br />
<strong>und</strong> Städte nutzen. Niemand war an<br />
solch einem Wissen interessiert. Doch<br />
das hat sich – zum Glück – seit einiger<br />
Zeit geändert. Wir erleben gerade eine<br />
riesige Umwälzung in der Stadtplanung<br />
– mit Fokus auf Lebensqualität,<br />
Klimaschutz <strong>und</strong> Ges<strong>und</strong>heit. Wir beschäftigen<br />
uns jetzt viel intensiver mit<br />
dem Wohlbefinden der Menschen, die<br />
in der Stadt leben.<br />
Was passierte eigentlich vor Modernismus<br />
<strong>und</strong> Motorismus?<br />
Die traditionelle Stadtplanung war<br />
viel langsamer <strong>und</strong> kontinuierlicher.<br />
Von Generation zu Generation wurde<br />
Foto: Frank Bach - frank@frankix.dk / stock.adobe.com<br />
weitergegeben, was die besten Dimensionen<br />
für Straßen <strong>und</strong> Gebäude sind.<br />
Bis in die 1960er Jahre hinein beruhte<br />
Stadtplanung in den meisten Fällen<br />
auf Tradition <strong>und</strong> Erfahrung. Und dann<br />
haben wir all das weggeworfen <strong>und</strong><br />
gesagt: Der moderne Mensch braucht<br />
das nicht mehr. Man dachte, es sei rational,<br />
Städte großflächig am Reißbrett<br />
zu planen <strong>und</strong> gigantische Siedlungen<br />
mit Hochhäusern wie Plattenbauten<br />
zu errichten. Aber die Menschen sind<br />
nicht rational. Sie stimmen mit den<br />
Füßen ab <strong>und</strong> gehen dorthin, wo es<br />
lebenswert ist. Deshalb gelten solche<br />
Hochhausviertel heute auch als ziemlich<br />
unattraktiv. Sie können natürlich<br />
alles abreißen <strong>und</strong> etwas Besseres <strong>bauen</strong>.<br />
Oder – vielleicht der bessere Weg<br />
– sie reißen nur Teile ab, machen die<br />
Häuser niedriger <strong>und</strong> <strong>bauen</strong> kleinere<br />
Gebäude dazwischen. Und versuchen,<br />
die Erdgeschosse mit Leben zu füllen,<br />
mit Ateliers, Bars, Geschäften. Das ist<br />
ein guter Weg, um die Architektur wieder<br />
auf humane Maße zurückzuholen.<br />
Ja, indem sie lebendigere Städte<br />
schafft. Wenn die Menschen mehr<br />
Zeit im öffentlichen Raum verbringen,<br />
wenn sie mehr Rad fahren <strong>und</strong> zu Fuß<br />
gehen, weil wir sie stärker dazu animieren,<br />
dann sind die Viertel belebter,<br />
<strong>und</strong> die Menschen werden stärker<br />
darauf achten, was um sie herum<br />
passiert. Und wenn die anderen Menschen<br />
sich sicherer fühlen, werden<br />
auch Sie selbst ein besseres Sicherheitsgefühl<br />
haben. Sobald Plätze aber<br />
verlassen <strong>und</strong> leer sind, steigt auch<br />
das Gefühl der Unsicherheit. Statt Gated<br />
Communities – also abgeschottete<br />
Wohnkomplexe – zu erschaffen, sollten<br />
wir deshalb lieber „Lively Communities“<br />
<strong>bauen</strong>.<br />
Wie demokratisch sollte Stadtplanung<br />
sein, wie viel Mitbestimmung<br />
kann es da geben?<br />
Es ist sehr gut, so etwas demokratisch<br />
zu entscheiden. Es ist dabei unheimlich<br />
wichtig, die Menschen so gut<br />
<strong>und</strong> so vollständig zu informieren wie<br />
möglich. Worum geht es genau? Was<br />
haben andere Städte gemacht? Was<br />
sind die konkreten Optionen, zwischen<br />
denen die Bürger wählen können?<br />
Wie könnten sie von der Maßnahme<br />
genau profitieren? Wenn man<br />
ein Referendum abhält, das auf zu<br />
wenigen Informationen <strong>und</strong> zu simplen<br />
Fragen basiert, wird es kein besonders<br />
progressives Ergebnis geben. Das<br />
habe ich zum Beispiel in der Schweiz<br />
gesehen, wo es aus diesem Gr<strong>und</strong> leider<br />
oft halbgare Kompromisslösungen<br />
14 Ausgabe 9 | Mai 2018 | Umweltdialog.de
Bauen <strong>und</strong> Wohnen<br />
gibt. Menschen treffen aber meist<br />
sehr vernünftige Entscheidungen,<br />
wenn sie gut informiert worden sind.<br />
Junge Menschen verzichten zunehmend<br />
auf Autos. Zudem nimmt die<br />
Zahl der Alten in jedem Jahr zu, die<br />
sich in der Stadt bewegen müssen.<br />
Was folgt daraus für die Städte?<br />
Sie sollten es den Bewohnern leicht<br />
machen, zu Fuß oder mit dem Rad unterwegs<br />
zu sein. Man sollte ohne Probleme<br />
ohne Auto zurechtkommen.<br />
Gibt es spezielle Maßnahmen für Ältere,<br />
um das Leben in der Stadt für<br />
sie angenehmer zu machen?<br />
Wenn eine Stadt sich gr<strong>und</strong>sätzlich<br />
stärker am Menschen orientiert,<br />
wird sie auch besser für ältere Menschen<br />
sein, weil diese sich dort besser<br />
<strong>und</strong> sicherer bewegen können. Man<br />
braucht Plätze, die gut vor Wind geschützt<br />
sind, wo es viele Möglichkeiten<br />
zum Sitzen <strong>und</strong> Ausruhen gibt,<br />
mit kleinteiliger Bebauung. Das bringt<br />
allen etwas.<br />
Die schönen, attraktiven, lebendigen<br />
Stadtteile sind auch jene, die am<br />
meisten von Gentrifizierung betroffen<br />
sind. Ärmere Bewohner ziehen also<br />
fort, wohlhabendere kommen. Wie<br />
kriegen wir es hin, dass nicht nur die<br />
Besserverdienenden etwas von intelligenter<br />
Stadtplanung haben?<br />
Was man auf jeden Fall nicht machen<br />
sollte: aufhören, bessere <strong>und</strong> menschenwürdigere<br />
Stadtplanung umzusetzen.<br />
Wenn man nichts verbessert,<br />
weil man Angst vor Gentrifizierung<br />
oder vor den Besserverdienenden<br />
hat, begibt man sich in eine Abwärtsspirale,<br />
<strong>und</strong> das ist für alle schlecht.<br />
Wir sollten Stadtteile verbessern <strong>und</strong><br />
aufwerten. Aber wir sollten auch den<br />
Effekten der Gentrifizierung entgegenwirken.<br />
Jan Gehl<br />
ist Architekt, Stadtplaner <strong>und</strong><br />
emeritierter Professor der<br />
Königlichen Dänischen<br />
Kunstakademie. Mit seiner<br />
Firma Gehl Architects berät<br />
er Städte weltweit, um diese<br />
sicherer, gesünder <strong>und</strong><br />
nachhaltiger zu machen.<br />
Was kann man dagegen unternehmen?<br />
Da gibt es eine ganze Reihe von Möglichkeiten.<br />
In neu gebauten Vierteln<br />
könnte man zum Beispiel vorschreiben,<br />
dass 20 oder 30 Prozent der<br />
Wohnungen günstige Mieten haben<br />
müssen. Man kann auch gezielt Bauprojekte<br />
in Aufwertungsgebieten an<br />
öffentliche Genossenschaften vergeben.<br />
Gibt es denn gelungene Beispiele für<br />
so eine soziale Durchmischung?<br />
Ich halte viel von den Anstrengungen<br />
mancher Städte, in allen Teilen der<br />
Stadt das Wohnen zu erschwinglichen<br />
Preisen zu ermöglichen. Sinnvoll finde<br />
ich auch, was einige australische Städte<br />
machen: Diese <strong>bauen</strong> in Gegenden<br />
mit Sozialwohnungen gezielt kleine<br />
Häuser für Familien. Solch eine Diversität<br />
scheint sich sehr positiv auf die<br />
Viertel auszuwirken. Städte in Australien<br />
sind ohnehin sehr fortschrittlich,<br />
was moderne Stadtplanung betrifft.<br />
Die sind allerdings auch finanziell gut<br />
ausgestattet.<br />
Das ist ja längst nicht überall so. Oft<br />
schwimmen Städte nicht gerade in<br />
Geld.<br />
In den USA zum Beispiel sind die<br />
Städte selbst oft mehr oder weniger<br />
mittellos. An die Stelle der öffentlichen<br />
Hand treten dann meist gemeinnützige<br />
Stiftungen, die etwas verbessern<br />
wollen. Und die oft eine sehr gute<br />
Arbeit leisten.<br />
Es gibt aber auch Städte, die privaten<br />
Investoren das Feld überlassen …<br />
Es ist extrem wichtig, dass es eine<br />
starke Stadtverwaltung gibt, die genau<br />
weiß, wo sie hinwill <strong>und</strong> privaten<br />
Investoren klare Vorgaben macht, was<br />
geht <strong>und</strong> was nicht geht, wo Unterstützung<br />
erwünscht ist <strong>und</strong> in welchem<br />
Rahmen. Wenn wir Städte komplett<br />
dem freien Markt überlassen, würden<br />
sie sich ziemlich schnell in riesige<br />
Shoppingmalls verwandeln.<br />
Wie viel sollte man in einer Stadt<br />
gr<strong>und</strong>sätzlich dem Markt überlassen,<br />
wo muss die öffentliche Hand eingreifen?<br />
Ich habe ein tiefes Misstrauen dem<br />
Markt gegenüber. Wenn wir alles<br />
dem freien Markt überlassen, werden<br />
meist rückwärtsgewandte Dinge herauskommen.<br />
Wer ein kommerzielles<br />
Projekt baut, schaut meist, was in der<br />
Vergangenheit gemacht wurde, um<br />
dann das Gleiche zu machen. Es gibt<br />
nur sehr wenige Bauträger, die Experimente<br />
wagen oder etwas Neues ausprobieren.<br />
Diese Unternehmen wollen<br />
immer auf Nummer sicher gehen. Wir<br />
brauchen aber neue Ideen, die unsere<br />
Städte lebenswerter machen. Und<br />
nicht die alten, mit denen wir sie lebensfeindlich<br />
gemacht haben. f<br />
Im Original erschienen bei fluter,<br />
Magazin der B<strong>und</strong>eszentrale für<br />
politische Bildung.<br />
Ausgabe 9 | Mai 2018 | Umweltdialog.de<br />
15
Bauen <strong>und</strong> Wohnen<br />
Wie der Klimawandel<br />
unsere Städte verändert<br />
Foto: Stadtblick Stuttgart / stock.adobe.com<br />
Mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung lebt in Städten. Dort konzentrieren sich zugleich die<br />
meisten Gebäude <strong>und</strong> wirtschaftlichen Aktivitäten. Logisch, dass sich gerade hier die Folgen<br />
des Klimawandels am Brutalsten aufzeigen lassen. Das Portal www.klimafakten.de hat die<br />
wichtigsten Ergebnisse des jüngsten Berichts des Weltklimarates zusammengefasst. Ihr<br />
Fazit: Um die Folgen des Klimawandels für die Menschen abzuschwächen, muss die städtische<br />
Infrastruktur drastisch an die klimatischen Veränderungen angepasst werden.<br />
16 Ausgabe 9 | Mai 2018 | Umweltdialog.de
Bauen <strong>und</strong> Wohnen<br />
Bis zum Jahr 2050 wird ein Wachstum der globalen<br />
Stadtbevölkerung um 2,5 bis 3 Milliarden (gegenüber<br />
2009) erwartet; weltweit werden dann 64 bis<br />
69 Prozent der Menschen in Städten leben. Urbane Gebiete<br />
sind eine Hauptquelle von Treibhausgasen <strong>und</strong> derzeit für<br />
r<strong>und</strong> 70 Prozent des weltweiten Energieverbrauchs verantwortlich.<br />
Steigende Meeresspiegel <strong>und</strong> Überschwemmungen an<br />
Flüssen, Hitzeperioden <strong>und</strong> die mögliche Ausbreitung von<br />
Krankheiten, zunehmende Dürren <strong>und</strong> damit einhergehende<br />
Wasserknappheit <strong>und</strong> Luftverschmutzung – all dies<br />
wird Ges<strong>und</strong>heit, Lebensgr<strong>und</strong>lagen <strong>und</strong> Vermögenswerte<br />
von Menschen stark beeinträchtigen. Der Klimawandel<br />
könnte den Zugang zu gr<strong>und</strong>legenden Dienstleistungen<br />
<strong>und</strong> die Lebensqualität in Städten verschlechtern.<br />
Am stärksten betreffen wird dies wahrscheinlich die arme<br />
Bevölkerung in den schnell wachsenden Städten der Entwicklungsländer.<br />
Der Klimawandel wird zudem lokale <strong>und</strong><br />
nationale Wirtschafts- <strong>und</strong> Ökosysteme in Mitleidenschaft<br />
ziehen. Beispielsweise sind Hafeninfrastrukturen im Wert<br />
von mehr als drei Billionen US-Dollar in 136 der weltweit<br />
größten Hafenstädte anfällig für Extremwetterereignisse.<br />
Auch wenn sie eine komplexe Aufgabe darstellt, so ist Anpassung<br />
doch möglich – <strong>und</strong> langfristig betrachtet kostengünstiger<br />
als nichts zu tun. Beispielsweise hat eine Untersuchung<br />
heutiger <strong>und</strong> künftiger Flutschäden in einigen der<br />
weltweit größten Küstenstädte gezeigt, dass die geschätzten<br />
Anpassungskosten weit unter den voraussichtlichen<br />
Schäden liegen, die ohne Anpassung eintreten würden.<br />
Foto: Georgy Dzyura / stock.adobe.com<br />
Die meisten der Risiken, die aus den Hauptgefahren des<br />
Klimawandels resultieren, werden für städtische Gebiete in<br />
nächster Zeit zunehmen. Ein hohes Niveau der Anpassung<br />
kann diese Risiken deutlich senken. Jedoch macht jedes<br />
weitere Grad Erderwärmung die Anpassung schwieriger.<br />
Die Möglichkeiten, den Ausstoß von Treibhausgasen zu<br />
verringern, unterscheiden sich von Stadt zu Stadt, <strong>und</strong><br />
wahrscheinlich sind sie am wirksamsten, wenn verschiedene<br />
Politikinstrumente kombiniert werden. In bestehenden<br />
oder bereits weit entwickelten Städten sind die Optionen<br />
durch die vorhandenen Strukturen begrenzt, doch sind<br />
Sanierungen <strong>und</strong> Nachrüstungen möglich. Hingegen ist in<br />
sich rasch entwickelnden Städten noch eine Urbanisierung<br />
<strong>und</strong> Infrastrukturentwicklung möglich, die einen nachhaltigeren<br />
<strong>und</strong> CO 2<br />
-armen Weg einschlägt.<br />
>><br />
Ausgabe 9 | Mai 2018 | Umweltdialog.de<br />
17
Bauen <strong>und</strong> Wohnen<br />
Folgen <strong>und</strong> Risiken des Klimawandels in Kürze<br />
Als Reaktion auf den Temperaturanstieg<br />
können Kommunen stadtplanef<br />
Steigende Temperaturen könnten den Effekt<br />
städtischer Wärmeinseln verstärken – <strong>und</strong> damit<br />
hitzebedingte Ges<strong>und</strong>heitsprobleme <strong>und</strong> die Luftverschmutzung<br />
in Städten verschärfen.<br />
f Die Erderwärmung wird voraussichtlich die erneuerbaren<br />
Wasserressourcen verringern – was möglicherweise<br />
die Trinkwasserversorgung in vielen städtischen<br />
Gebieten beeinträchtigt, wasserbedingte Krankheiten<br />
begünstigt, die Lebensmittelpreise in die Höhe treibt<br />
<strong>und</strong> die Ernährungssicherheit gefährdet.<br />
f Die Versauerung der Ozeane ist ein Risiko für die<br />
Meeresressourcen.<br />
f Der Meeresspiegelanstieg, Extremwetterereignisse<br />
<strong>und</strong> Binnenhochwasser werden das Leben <strong>und</strong> die<br />
Existenzgr<strong>und</strong>lagen von Menschen gefährden, Infrastrukturen<br />
zerstören sowie Versorgungsengpässe<br />
<strong>und</strong> politische Konflikte auslösen.<br />
f Die Vermögenswerte in Küstenstädten, die Überflutungsrisiken<br />
ausgesetzt sind, entsprachen im Jahr<br />
2005 fünf Prozent des weltweiten BIP – bis 2070<br />
werden es voraussichtlich neun Prozent sein.<br />
Laut aktuellen Erkenntnissen muss<br />
das Tempo der Emissionsminderungen<br />
sowohl in Städten der entwickelten<br />
wie auch der weniger entwickelten<br />
Länder zunehmen. Der Schwerpunkt<br />
sollte dabei auf Emissionen aus Energieversorgung,<br />
Verkehr, Gebäuden<br />
<strong>und</strong> Industrie liegen. Daneben gibt es<br />
eine breite Palette von Möglichkeiten,<br />
den Treibhausgasausstoß durch kluge<br />
Stadtplanung <strong>und</strong> -entwicklung zu<br />
senken.<br />
Möglichkeiten der Anpassung<br />
Die Kommunalverwaltungen sind der<br />
Dreh- <strong>und</strong> Angelpunkt einer erfolgreichen<br />
Klimaanpassung von Städten.<br />
Denn es kommt maßgeblich auf die<br />
örtlichen Gegebenheiten an <strong>und</strong> darauf,<br />
dass die Anpassungsstrategie in<br />
lokale Investitionen, Vorschriften <strong>und</strong><br />
politische Entscheidungen integriert<br />
wird.<br />
Wohlverwaltete Städte mit guten <strong>und</strong><br />
für alle verfügbaren Infrastrukturen<br />
<strong>und</strong> Dienstleistungen sind eine stabile<br />
Basis, um die Widerstandsfähigkeit<br />
gegenüber den Folgen des Klimawandels<br />
zu erhöhen. Doch müssen<br />
Planung, Gestaltung <strong>und</strong> Verteilung<br />
personeller, finanzieller <strong>und</strong> materieller<br />
Ressourcen an den aufziehenden<br />
Klimarisiken ausgerichtet werden.<br />
Obwohl sich in den vielen rasch wachsenden<br />
Städten gute Möglichkeiten<br />
für Klimaanpassung <strong>und</strong> nachhaltige<br />
Entwicklung bieten, gibt es nur wenige<br />
Hinweise, dass diese bisher genutzt<br />
worden wären.<br />
Planung<br />
Es gibt keinen allgemeingültigen Ansatz<br />
für die Planung urbaner Anpassungsmaßnahmen,<br />
denn die Anpassung<br />
an den Klimawandel präsentiert<br />
sich, genau wie die Städte selbst, komplex,<br />
vielfältig <strong>und</strong> kontextabhängig.<br />
Top-down- <strong>und</strong> Bottom-up-Ansätze<br />
sollten kombiniert werden, Stadtverwaltungen<br />
mit der Zivilgesellschaft,<br />
dem Privatsektor <strong>und</strong> einkommensschwachen<br />
Teilen der Bevölkerung<br />
zusammenarbeiten.<br />
Eine stärkere Verknüpfung von Katastrophenvorsorge<br />
<strong>und</strong> Klimaanpassung<br />
sowie beider Einbeziehung in lokale,<br />
regionale, nationale <strong>und</strong> internationale<br />
Entwicklungsstrategien kann in<br />
jeder Hinsicht Vorteile bringen.<br />
Finanzierung<br />
Großen Städten mit starken Wirtschafts-<br />
<strong>und</strong> Verwaltungsstrukturen<br />
fällt es am leichtesten, externe Gelder<br />
für Anpassungsmaßnahmen anzuziehen<br />
<strong>und</strong> selbst Mittel aufzubringen.<br />
Dagegen haben kleinere <strong>und</strong> weniger<br />
wohlhabende Kommunen mit zersplitterten<br />
politischen Strukturen oder<br />
einer leistungsschwächeren Verwaltung<br />
geringere Erfolgschancen.<br />
Die Palette möglicher Finanzierungsinstrumente<br />
ist breit: lokale Einnahmen<br />
(Steuern, Abgaben, Gebühren),<br />
lokale <strong>und</strong> nationale Finanz- <strong>und</strong> Anleihenmärkte,<br />
Verträge <strong>und</strong> Konzessionen<br />
im Rahmen öffentlich-privater<br />
Partnerschaften (ÖPP), Finanztransfers/Anreize<br />
von nationaler oder föderaler<br />
Ebene, private <strong>und</strong> marktorientierte<br />
Investitionen, Zuschüsse oder<br />
verbilligte Darlehen (etwa aus einem<br />
Anpassungsfonds).<br />
Wohnungsmarkt<br />
Hochwertiger <strong>und</strong> erschwinglicher<br />
Wohnraum an geeigneten Standorten<br />
minimiert gegenwärtige Gefährdungen<br />
<strong>und</strong> Schäden <strong>und</strong> ist eine<br />
tragfähige Basis für eine stadtweite<br />
Anpassung an den Klimawandel. Für<br />
Eigentümer sowie öffentliche, private<br />
<strong>und</strong> zivilgesellschaftliche Organisationen<br />
gibt es viele Möglichkeiten, die<br />
vorhandene Bausubstanz an den Klimawandel<br />
anzupassen.<br />
Steigende Temperaturen<br />
18 Ausgabe 9 | Mai 2018 | Umweltdialog.de
Bauen <strong>und</strong> Wohnen<br />
Meeresspiegel <strong>und</strong> Sturmfluten<br />
rische Strategien für das Wärmemanagement entwickeln,<br />
etwa den Einsatz von Grünzonen, Frischluftkorridoren,<br />
begrünten Dächern <strong>und</strong> Wasserflächen. Dazu gehört<br />
auch, Bauvorschriften zu verbessern <strong>und</strong> solche Infrastrukturen<br />
beständiger gegen die zunehmende Hitze zu<br />
machen, die insbesondere von den schwächsten Bevölkerungsgruppen<br />
genutzt werden (Schulen, Altenheime <strong>und</strong><br />
Krankenhäuser).<br />
Gr<strong>und</strong>versorgung<br />
Der Abbau von Mängeln bei der Gr<strong>und</strong>versorgung <strong>und</strong> der<br />
Aufbau resilienter Infrastrukturen (z.B. Wasserver- <strong>und</strong><br />
entsorgung, Sanitäreinrichtungen, Stromversorgung, Verkehrs-<br />
<strong>und</strong> Telekommunikationsnetze, Ges<strong>und</strong>heitsversorgung,<br />
Bildung, Rettungsdienste) können die Anfälligkeit<br />
für Folgen des Klimawandels beträchtlich mildern. Dies gilt<br />
besonders für die Bevölkerungsgruppen mit dem höchsten<br />
Risiko <strong>und</strong> der größten Verw<strong>und</strong>barkeit.<br />
Wasserversorgung<br />
Weil steigende Temperaturen den Wasserbedarf erhöhen,<br />
müssen sich Städte mit der Planung <strong>und</strong> Infrastruktur der<br />
Wasserversorgung befassen. Zu den Maßnahmen, um die<br />
erforderliche Menge <strong>und</strong> Qualität des Wassers zu sichern,<br />
gehören: Schaffung verstärkter, dezentraler <strong>und</strong> autonom<br />
betriebener Ver- <strong>und</strong> Entsorgungseinrichtungen; Förderung<br />
der Wiederverwertung von Wasser, der Nutzung von Grauwasser<br />
<strong>und</strong> eines besseren Managements des Regenwasserabflusses;<br />
Erschließung neuer bzw. alternativer Wasserbezugsquellen<br />
<strong>und</strong> Ausbau der Speicherkapazitäten.<br />
Wassermangel kann auch Kraftwerke betreffen, weshalb<br />
Städte wasserunabhängige Kapazitäten zur Energieerzeugung<br />
aus<strong>bauen</strong> sollten.<br />
Foto: satori / stock.adobe.com<br />
Wegen der Risiken infolge von Meeresspiegelanstieg <strong>und</strong><br />
Sturmfluten müssen Städte möglicherweise ihre Küsteninfrastruktur<br />
verstärken, insbesondere Häfen <strong>und</strong> Anlagen<br />
zur Stromerzeugung. Dies erfordert den Bau von Schutzvorrichtungen<br />
gegen Sturmfluten (Sperren, Schleusen, Deiche<br />
etc.), eine deutlich veränderte Raumplanung <strong>und</strong> auch<br />
die Erweiterung in höher gelegene Gebiete sowie die Verlegung<br />
essenzieller Versorgungseinrichtungen.<br />
Die Risiken für Leib <strong>und</strong> Leben der Einwohner lassen sich<br />
durch verbesserte Frühwarnsysteme, Evakuierungs- <strong>und</strong><br />
Krisenpläne verringern. Weitere Optionen sind die Entwicklung<br />
alternativer Verkehrsrouten <strong>und</strong> -mittel entlang<br />
der Küsten sowie dezentraler <strong>und</strong> küstenferner Energieerzeugungskapazitäten.<br />
Extremwetter <strong>und</strong> Binnenhochwasser<br />
Die Zunahme von Extremwetterereignissen wird die Städte<br />
zwingen, dezentrale <strong>und</strong> resiliente Systeme für die Energie<strong>und</strong><br />
Ges<strong>und</strong>heitsversorgung sowie für die Einsatzleitung<br />
bei Rettungs- oder Katastropheneinsätzen zu entwickeln.<br />
Dazu gehören auch die Verstärkung der Infrastrukturen<br />
öffentlicher Verkehrsmittel <strong>und</strong> möglicherweise die Bevorratung<br />
von Treibstoff, Wasser <strong>und</strong> Lebensmitteln. Mittels<br />
überarbeiteter Bauvorschriften kann die Widerstandsfähigkeit<br />
von Gebäuden <strong>und</strong> Infrastrukturen erhöht werden,<br />
wobei ärmeren Bevölkerungsgruppen ein besonderes Augenmerk<br />
gelten muss. Die Kanalisation für Abwässer <strong>und</strong><br />
Regenwasser kann verbessert werden.<br />
Ernährungssicherheit<br />
Anpassungsmaßnahmen in diesem Bereich können insbesondere<br />
die Klimaanfälligkeit ärmerer Stadtbewohner mindern.<br />
Möglichkeiten auf lokaler Ebene sind beispielsweise<br />
die Förderung von Landwirtschaft in der Stadt <strong>und</strong> im direkten<br />
Umland oder auf Gründächern.<br />
Eine veränderte Verfügbarkeit wichtiger Ressourcen aus<br />
den Meeren könnte Städte zwingen, alternative Lebensmittelquellen<br />
zu erschließen <strong>und</strong> die Logistik für deren Einkauf<br />
<strong>und</strong> Verteilung zu stärken. Dazu kann auch der Aufbau<br />
von Binnenaquakulturen gehören. f<br />
Gekürzte Fassung des Branchenberichts<br />
„Klimawandel – Was er für die Städte<br />
bedeutet“ von www.klimafakten.de<br />
Ausgabe 9 | Mai 2018 | Umweltdialog.de<br />
19
Bauen <strong>und</strong> Wohnen<br />
Klimametropole<br />
Kopenhagen<br />
Von Julia Arendt<br />
Foto: Scirocco340 / stock.adobe.com<br />
„Green Lighthouse“ in Kopenhagen<br />
Foto: Adam Mørk<br />
Kopenhagen plant, im Jahr 2025 die<br />
erste klimaneutrale Metropole der<br />
Welt zu sein. Bürgermeister, Städteplaner<br />
<strong>und</strong> Politiker aus aller Welt<br />
besuchten die dänische Hauptstadt in<br />
den vergangenen Jahren <strong>und</strong> waren<br />
von der Fahrradkultur, der Abfallverwertung<br />
<strong>und</strong> dem Fernwärmesystem<br />
beeindruckt. Mittlerweile ist Kopenhagen<br />
zum Vorbild für Großstädte<br />
weltweit geworden. Zurzeit glänzt sie<br />
allerdings besonders mit ihrer nachhaltigen<br />
Stadt- <strong>und</strong> Gebäudeplanung.<br />
Gebäude-Emission? Zero.<br />
Im Jahr 2009 setzte Kopenhagen mit<br />
der Eröffnung des „Green Lighthouse“<br />
ein architektonisches Statement in Sachen<br />
Klimaneutralität. Das nachhaltige<br />
Energiekonzept des CO 2<br />
-neutralen<br />
Universitätsgebäudes stützt sich dabei<br />
vor allem auf die Nutzung von Tageslicht.<br />
Das Dach, als fünfte Fassade,<br />
verfügt über einen flachen Neigungswinkel.<br />
Es leitet bei hochstehender<br />
Sonne besonders viel Licht ins Innere<br />
<strong>und</strong> nimmt Wärme auf. Darüber hinaus<br />
beinhaltet das Konzept eine Kombination<br />
aus Fernwärme, Solarzellen,<br />
Solarkühlung <strong>und</strong> saisonaler Energiespeicherung.<br />
So verbraucht das<br />
Gebäude bis zu 75 Prozent weniger<br />
Energie als konventionelle Gebäude.<br />
Das Green Lighthouse ist außerdem<br />
das erste öffentliche CO 2<br />
-neutrale Gebäude<br />
in ganz Dänemark.<br />
Ein Parkhaus wird zur „Tankstelle“<br />
Wie können innenstadtnahe Parkräume<br />
effektiv <strong>und</strong> nachhaltig genutzt<br />
werden? Eine Antwort darauf gibt das<br />
„Lüders Parkhaus“ im Kopenhagener<br />
Stadtteil Nordhavn. Auf dem Dach des<br />
sechsstöckigen Gebäudes befindet<br />
sich ein Spielplatz. Dieser bietet Kindern<br />
nicht nur einen Platz zum Spielen,<br />
sondern den vielen Touristen einen<br />
tollen Ausblick über die Stadt. Für<br />
Freizeitsportler bringt das Parkhaus<br />
ebenfalls einen Vorteil: eine Digitalanzeige<br />
zeigt ihnen an, wie schnell<br />
sie die Treppe auf das Dach hochlaufen.<br />
Ganz nebenbei ist das Gebäude<br />
auch noch gut für die Umwelt. Lüders<br />
Parkhaus ist ein Energiespeicher. In<br />
Zukunft sollen geparkte Elektroautos<br />
Energie nach Bedarf zwischenspeichern<br />
oder an das Stromnetz abgeben<br />
20 Ausgabe 9 | Mai 2018 | Umweltdialog.de
Bauen <strong>und</strong> Wohnen<br />
können. Bis es so weit ist, übernimmt eine große Batterie<br />
im Erdgeschoss diese Funktion. Sie kann überschüssige<br />
Energie von Windrädern oder Solaranlagen speichern <strong>und</strong><br />
60 Haushalte einen Tag lang mit Strom versorgen.<br />
Öffentliche Plätze schützen vor Überschwemmung<br />
Die Auswirkungen des Klimawandels sind auch in Kopenhagen<br />
spürbar. In der Vergangenheit hatte die Stadt häufig<br />
mit heftigem Starkregen zu kämpfen. In kürzester Zeit war<br />
die Kanalisation überlastet, Straßen wurden überflutet. In<br />
Zukunft rechnen Experten sogar mit immer häufigeren extremen<br />
Regenfällen. Aus diesem Gr<strong>und</strong> beschloss die Stadt,<br />
Lösungsansätze zur Reduzierung des Überflutungsrisikos<br />
zu entwickeln – <strong>und</strong> mit der Aufwertung öffentlicher Plätze<br />
zu kombinieren.<br />
Eines von 300 Einzelprojekten war der Umbau des historischen<br />
Sankt Anna Plads in der Altstadt Kopenhagens. Der<br />
lang gezogene Platz ist zur grünen Oase geworden. Mehr als<br />
200 Parkplätze wurden hier entfernt, die Straße verschmälert.<br />
In der Mitte wurde ein tiefer liegender Grünstreifen mit<br />
Rasen <strong>und</strong> Bäumen angelegt. Dieser dient bei Regen als Auffangbecken<br />
für die Wassermassen. Darunterliegende Rohre<br />
leiten das Wasser in den Hafen <strong>und</strong> verhindern so die Überschwemmung<br />
des Platzes. So auch im Park „Tasigne Plads“.<br />
Er verfügt ebenfalls über ein tiefergelegtes <strong>und</strong> bepflanztes<br />
Versickerungsbecken, das den Regenabfluss sammelt. In<br />
Trockenperioden dient dieser wiederum zur Bewässerung<br />
der Parkanlage.<br />
Müllnutzung mal anders<br />
In Europa fällt viel Plastikmüll an – so viel, dass die EU bislang<br />
jährlich 1,6 Millionen Tonnen nach China exportieren<br />
musste. Wie kann dem Müllproblem entgegengewirkt werden?<br />
Ein besonderes Vorzeigeprojekt zur effektiven Müllnutzung<br />
ist die Müllverbrennungsanlage „Amager Bakke“ in<br />
Kopenhagen. Hier sollen Berichten zufolge jährlich 400.000<br />
Tonnen Müll verbrannt werden. Die Energie, die dadurch<br />
freigesetzt wird, soll 160.000 Haushalte mit Fernwärme <strong>und</strong><br />
62.500 Häuser mit elektrischer Energie versorgen.<br />
Unglaublich aber wahr: das Dach des innovativen Gebäudes<br />
soll gleichzeitig als Skipiste <strong>und</strong> Regenerationspark genutzt<br />
werden. Die Eröffnung des Outdoor-Parks wird voraussichtlich<br />
Mitte 2018 erfolgen. Doch bereits jetzt ist das Kraftwerk<br />
in Betrieb – schon im Herbst letzten Jahres belieferte es einen<br />
großen Teil der dänischen Insel Amager <strong>und</strong> der Hauptstadt<br />
Kopenhagen mit Strom. f<br />
Ausgabe 9 | Mai 2018 | Umweltdialog.de<br />
21
Bauen <strong>und</strong> Wohnen<br />
Baubranche:<br />
Kaum eine andere Branche verbraucht so viele Ressourcen<br />
<strong>und</strong> produziert so viel Müll wie der Bausektor. Zudem sind<br />
Gebäude für einen großen Teil unseres Energieverbrauchs <strong>und</strong><br />
unserer CO 2<br />
-Emissionen verantwortlich. Strengere Vorschriften<br />
<strong>und</strong> eine steigende Nachfrage nach „grünen“ Immobilien<br />
führen langsam zu einem Umlenken der Branche in Richtung<br />
<strong>Nachhaltig</strong>keit. Die zentralen Schlagworte lauten Ressourceneffizienz<br />
<strong>und</strong> Kreislaufwirtschaft.<br />
Foto: pitb_1 / stock.adobe.com<br />
Von Milena Knoop<br />
Laut Umweltb<strong>und</strong>esamt werden in Deutschland r<strong>und</strong> 35<br />
Prozent der Endenergie in Gebäuden verbraucht, vorwiegend<br />
für Heizung <strong>und</strong> Warmwasser. Das entspricht ca. 30<br />
Prozent der emittierten Treibhausgasemissionen. Ähnliches<br />
gilt für das Abfallaufkommen. Der Gebäudesektor<br />
birgt damit großes Einsparpotenzial <strong>und</strong> spielt eine wichtige<br />
Rolle bei der Erreichung nationaler <strong>und</strong> internationaler<br />
Klimaschutz- <strong>und</strong> CO 2<br />
-Reduktionsziele, etwa im Rahmen<br />
der Energiewende, des Pariser Klimaabkommens oder der<br />
<strong>Nachhaltig</strong>en Entwicklungsziele der UN.<br />
Viel ungenutztes Potenzial<br />
Das zeigt das Beispiel Müll: Ein Großteil des Abfalls, der<br />
beim Neubau, Ausbau <strong>und</strong> beim Abbruch eines Gebäudes<br />
anfällt, wird wiederverwertet. So wurden nach Angaben<br />
der B<strong>und</strong>esanstalt für Geowissenschaften <strong>und</strong> Rohstoffe<br />
(BGR) zum Zeitpunkt der letzten Erhebung im Jahr 2012<br />
r<strong>und</strong> 78 Prozent des Bauschutts recycelt. Das Recyclingmaterial<br />
wird vor allem im Tief- <strong>und</strong> Straßenbau, aber erst<br />
selten höherwertig verwendet.<br />
Viele wertvolle Materialien <strong>und</strong> Rohstoffe landen jedoch<br />
nach wie vor auf der Müllkippe. Zum Beispiel Bausand: Dieser<br />
wird unter anderem zur Produktion von Beton, Ziegeln<br />
<strong>und</strong> Klinkern oder als Füllsand benötigt. Das Recycling von<br />
Bausand ist technisch sehr aufwendig, <strong>und</strong> da der Rohstoff<br />
in Deutschland reichlich vorhanden <strong>und</strong> entsprechend<br />
günstig ist, lohnt es sich nicht, ihn wiederzugewinnen. Faktoren<br />
wie der derzeitige Bauboom könnten laut BGR jedoch<br />
dazu führen, dass Bausand auch hierzulande knapper <strong>und</strong><br />
teurer wird.<br />
Neben steigenden Rohstoffpreisen setzen schärfere Umweltschutzauflagen<br />
Bauherren zusätzlich unter Druck. So<br />
rechnet die Branche etwa mit steigenden Kosten für die<br />
Entsorgung von Bauabfällen. Gr<strong>und</strong> dafür ist eine neue<br />
Mantelverordnung des Umweltb<strong>und</strong>esamtes, die dieses<br />
Jahr in Kraft treten könnte.<br />
Das Cradle-to-Cradle-Designkonzept<br />
Das von dem deutschen Chemiker Michael Braungart<br />
entwickelte Cradle-to-Cradle-Konzept geht noch einen<br />
Schritt weiter, wenn es um Lösungswege für nachhalti-<br />
22 Ausgabe 9 | Mai 2018 | Umweltdialog.de
Bauen <strong>und</strong> Wohnen<br />
neue Behördengebäude gilt dies bereits<br />
ab 2019. Doch auch hier gibt es<br />
Unterschiede. Nicht nur der Neubau,<br />
sondern auch die energetische Gebäudemodernisierung<br />
soll nach Plänen<br />
der neuen B<strong>und</strong>esregierung noch stärker<br />
finanziell gefördert werden, wie<br />
der Bauherren-Schutzb<strong>und</strong> e.V. (BSB)<br />
im Januar mitteilte. Dies sei auch dringend<br />
notwendig, sagt BSB-Geschäftsführer<br />
Florian Becker: „Bei der privaten<br />
Gebäudemodernisierung besteht<br />
seit Jahren Handlungsbedarf. Die<br />
Entscheidung der neuen B<strong>und</strong>esregierung,<br />
Verbraucher hierbei besser zu<br />
unterstützen, ist ein wichtiger Schritt,<br />
um aufzuholen <strong>und</strong> den gesteckten<br />
Klimazielen näher zu kommen.“<br />
Welche Fördermöglichkeiten gibt<br />
es?<br />
ges, ressourcenschonendes Bauen<br />
geht. Cradle-to-Cradle heißt übersetzt<br />
„von der Wiege zur Wiege“ <strong>und</strong> beschreibt<br />
einen potenziell unendlichen<br />
Zirkulationsprozess von Materialien<br />
<strong>und</strong> Nährstoffen in biologischen oder<br />
technischen Kreisläufen. Dabei dient<br />
die Natur als Vorbild. Für Gebäude<br />
bedeutet das: Alle verbauten Produkte<br />
sind biologisch abbaubar oder wiederverwertbar<br />
<strong>und</strong> haben somit keine<br />
negativen Auswirkungen mehr auf die<br />
Menschen <strong>und</strong> die Umwelt. Abfall gibt<br />
es im Cradle-to-Cradle-Szenario nicht.<br />
Michael Braungart beschreibt das<br />
Konzept so: „Mit dem Cradle-to-Cradle-Konzept<br />
können wir nach dem<br />
Vorbild der Natur Materialkreisläufe<br />
schließen. Ein Produkt, das zu Abfall<br />
wird, ist ein schlechtes Produkt. Ein<br />
Gebäude, welches Bauschutt verursacht,<br />
hat einfach schlechte Qualität.“<br />
So entstehen „Gebäude wie Bäume<br />
<strong>und</strong> Städte wie Wälder“ mit einem positiven<br />
ökologischen Fußabdruck.<br />
Was treibt die Branche noch an?<br />
Strengere Anforderungen, höhere<br />
Standards, aber auch staatliche Förderprogramme<br />
tragen dazu bei, dass<br />
sich <strong>Nachhaltig</strong>keit im Gebäudesektor<br />
immer mehr durchsetzt. Vor allem die<br />
<strong>Themen</strong> Energieeffizienz <strong>und</strong> erneuerbare<br />
Energien rücken dabei immer<br />
mehr in den Vordergr<strong>und</strong>, führt ein<br />
niedrigerer Energieverbrauch doch<br />
nicht nur zu enormen Kosteneinsparungen,<br />
sondern auch zu einem niedrigeren<br />
CO 2<br />
-Ausstoß. Im Prinzip sind<br />
bereits alle neu entstehenden Gebäude<br />
im Vergleich zu älteren Immobilien<br />
sehr energieeffizient. So müssen<br />
nach EU-Recht alle Neubauten ab dem<br />
Jahr 2021 als sogenannte Niedrigstenergiegebäude<br />
errichtet werden; für<br />
Je nachdem, wie hoch der Primärenergiebedarf<br />
<strong>und</strong> der Wärmeverlust<br />
eines Gebäudes sind, unterstützt die<br />
Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)<br />
Bauherren, Käufer <strong>und</strong> Modernisierer<br />
mit unterschiedlich hohen Krediten<br />
bzw. Zuschüssen. Dabei gilt: Je energieeffizienter<br />
das Haus, desto höher<br />
die Förderung. Unterschieden wird<br />
zwischen Effizienzhäusern der Klasse<br />
40, 55, 70 oder 100. Zu den Fördermaßnahmen<br />
zählen zum Beispiel<br />
eine effiziente Heizungsanlage, eine<br />
solarthermische Anlage auf dem Dach<br />
oder eine gute Dämmung der Wände<br />
<strong>und</strong> Fassaden.<br />
>><br />
Rückbau, Verwertung<br />
<strong>und</strong> Entsorgung<br />
Planung,<br />
Rohstoffgewinnung<br />
Gebäudelebenszyklus<br />
Nutzung einschließlich<br />
Instandhaltung <strong>und</strong><br />
Modernisierung<br />
Herstellung,<br />
Errichtung<br />
Ausgabe 9 | Mai 2018 | Umweltdialog.de<br />
23
Bauen <strong>und</strong> Wohnen<br />
Neben KfW-Effizienzhäusern haben<br />
sich weitere Standards durchgesetzt:<br />
Als Passivhaus wird ein Haus bezeichnet,<br />
das ohne klassische Heizung auskommt.<br />
Es nutzt die Sonneneinstrahlungen<br />
<strong>und</strong> die Wärme von Personen<br />
<strong>und</strong> technischen Geräten, um Räume<br />
aufzuheizen. Auch hier spielt eine<br />
entsprechende Dämmung der Wände<br />
<strong>und</strong> Fassaden eine zentrale Rolle.<br />
Laut Passivhaus Institut (PHI) lassen<br />
sich mit Passivhäusern Energieeinsparung<br />
von über 80 Prozent gegenüber<br />
den gesetzlich vorgeschriebenen<br />
Neubaustandards erzielen. Ein sogenanntes<br />
Nullenergiehaus zeichnet<br />
sich dadurch aus, dass es genauso<br />
viel Strom bzw. Energie verbraucht,<br />
wie es selbst produziert. Ein Nullenergiehaus<br />
kann, muss aber nicht<br />
energieautark sein. Sogenannte Plusenergiehäuser<br />
hingegen benötigen<br />
keine externe Energiezuführung. Sie<br />
erzeugen mehr Energie als sie selbst<br />
verbrauchen <strong>und</strong> können diesen Energieüberschuss<br />
speichern.<br />
Maßnahmen zur Energieeffizienz <strong>und</strong><br />
CO 2<br />
-Reduktion im Betrieb sind wichtige<br />
Stellschrauben. Sie alleine reichen<br />
aber nicht aus. Da ein Gebäude<br />
in der Regel für eine jahrzehntelange<br />
Nutzung errichtet wird, müssen alle<br />
Phasen des Lebenszyklus des jeweiligen<br />
Bauwerks berücksichtigt werden.<br />
Erst diese ganzheitliche Betrachtung<br />
„von der Wiege bis zur Bahre“ (Englisch:<br />
„from cradle to grave“) gibt Aufschluss<br />
darüber, wie nachhaltig ein<br />
Gebäude ist <strong>und</strong> wo Einsparungspotenzial<br />
besteht.<br />
EPD als Datengr<strong>und</strong>lage für nachhaltiges<br />
Bauen<br />
Bereits in der Planungsphase <strong>und</strong> bei<br />
der Herstellung jedes einzelnen Bauteils<br />
wird also der Gr<strong>und</strong>stein für die<br />
spätere <strong>Nachhaltig</strong>keitsqualität eines<br />
Gebäudes gelegt. Das bedeutet, dass<br />
jeder Planer, Baustoffhersteller oder<br />
Häuser ganz ohne CO 2<br />
-Fußabdruck?<br />
Weshalb ein Bauprozess mehr Auswirkungen auf die Umwelt hat als die Energieeffizienz, erklärt Prof. Dr.-Ing. Werner<br />
Lang vom Lehrstuhl für energieeffizientes <strong>und</strong> nachhaltiges Planen <strong>und</strong> Bauen der Technischen Universität München<br />
am Beispiel des Passivhauses.<br />
Foto: Astrid Eckert / TU München<br />
Der Energieverbrauch für den Betrieb eines Passivhauses<br />
beträgt 15 Kilowattst<strong>und</strong>en pro Quadratmeter <strong>und</strong> Jahr. Das<br />
ist relativ wenig. Gebäude aus den 70er Jahren verbrauchen<br />
um die 250 bis 300 Kilowattst<strong>und</strong>en pro Quadratmeter <strong>und</strong><br />
Jahr. Aber beim Passivhaus ist der Energiebedarf bei der<br />
Errichtung höher als bei herkömmlichen Gebäuden. Es ist<br />
mehr Wärmedämmung nötig, die Gebäudetechnik ist aufwändiger.<br />
Wir ver<strong>bauen</strong> mehr Materialien, <strong>und</strong> es drängt<br />
sich schnell die Frage auf: Wo ist der Punkt, an dem ich<br />
mehr Energie in die Erstellung investieren muss als ich<br />
während des Betriebs wieder einspare? Es macht daher<br />
Sinn, zu überlegen, wie das Gebäude über seine Lebensdauer<br />
möglichst viel Energie selber produzieren könnte, über<br />
Fotovoltaik zum Beispiel. Wenn das gelingt, hinterlassen<br />
Gebäude einen positiven ökologischen Fußabdruck.<br />
24 Ausgabe 9 | Mai 2018 | Umweltdialog.de
Bauen <strong>und</strong> Wohnen<br />
Schon gewusst?<br />
Umweltkennzeichen <strong>und</strong> -deklarationen gibt es in<br />
drei verschiedenen Kategorien. Typ I nach ISO 14024<br />
weist ein bis zwei Umweltaspekte von Baustoffen<br />
wie Farben, Bodenbelägen <strong>und</strong> Dämmstoffen aus.<br />
Beispiele sind das FSC-Siegel oder der Blaue Engel.<br />
Diese Siegel richten sich an private <strong>und</strong> gewerbliche<br />
Endverbraucher. Bei Typ II handelt es sich um<br />
Umweltzeichen, die von Herstellern für ihre Produkte<br />
verwendet werden. Bei dieser sogenannten Selbstdeklaration<br />
erfolgt keine unabhängige Prüfung <strong>und</strong> Bewertung.<br />
Allerdings sind die Vorgaben der ISO 14021<br />
einzuhalten. Beispiele sind das Drei-Pfeile-Symbol<br />
oder diverse Verbandssiegel. Typ III nach ISO 14025<br />
entspricht den EPD, die das IBU vergibt. Im Vergleich<br />
zu den anderen Zeichentypen erfolgt hier weder eine<br />
Bewertung bestimmter Produkteigenschaften noch<br />
wird ein Zertifikat vergeben. Ziel ist vielmehr die neutrale<br />
Bereitstellung <strong>und</strong> transparente Kommunikation<br />
von Umweltinformationen. Diese bilden wiederum die<br />
Gr<strong>und</strong>lage für Gebäudezertifizierungssysteme von<br />
DGNB, BNB, BREEAM <strong>und</strong> LEED.<br />
Architekt mit seinen Produkten <strong>und</strong> seinem Know-how<br />
daran mitwirken kann, das Gebäude hinsichtlich ökologischer,<br />
aber auch sozialer <strong>und</strong> wirtschaftlicher Aspekte zu<br />
optimieren.<br />
Mit den Umwelt-Produktdeklarationen (Environmental<br />
Product Declarations, kurz: EPD) steht der Bauindustrie<br />
ein System zur Verfügung, das Informationen über die Umweltwirkungen<br />
von Bauprodukten <strong>und</strong> -komponenten in einem<br />
einheitlichen Format bündelt <strong>und</strong> dokumentiert. Fast<br />
alle EPD werden in Deutschland vom Institut Bauen <strong>und</strong><br />
Umwelt e.V. (IBU) veröffentlicht. Umweltfre<strong>und</strong>liche Baustoffe<br />
allein sind jedoch noch keine Garantie für <strong>Nachhaltig</strong>keit,<br />
weil sie keine Endprodukte sind. IBU-Geschäftsführer<br />
Dr. Burkhart Lehmann erläutert: „Verbaute Produkte<br />
entfalten ihre Wirkungen auf die Umwelt erst am Gebäude<br />
im Zusammenspiel mit anderen Bauprodukten in einer bestimmten<br />
Einbausituation.“<br />
Deshalb wird bei der Erstellung einer EPD der gesamte Lebenszyklus<br />
eines Bauprodukts in den Blick genommen bis<br />
hin zu Angaben zum Rückbau, der Recyclingfähigkeit <strong>und</strong><br />
zur Entsorgung. Darüber hinaus helfen technische Angaben<br />
– etwa zur Lebensdauer <strong>und</strong> zur Wärme- <strong>und</strong> Schallisolierung<br />
–, die Leistungsfähigkeit eines Produktes innerhalb<br />
eines Gebäudekontextes einzuschätzen. Wo relevant, können<br />
EPD auch umwelt- <strong>und</strong> ges<strong>und</strong>heitsbezogene Nachweise<br />
enthalten, wie beispielsweise zum Emissionsverhalten<br />
in die Innenraumluft. In Form einer Ökobilanz lässt sich so<br />
etwa der Beitrag zum globalen Treibhauseffekt, zum Ozonabbau,<br />
zur Versauerung der Böden <strong>und</strong> Gewässer oder zur<br />
Ressourcenverknappung bestimmen.<br />
Zementhersteller engagieren sich<br />
Seit Jahresbeginn gibt es ein neues Zertifizierungssystem<br />
für Beton- <strong>und</strong> Zementhersteller sowie Produzenten von Gesteinskörnung<br />
in Deutschland, das sich bereits international<br />
bewährt hat. Initiator des Zertifizierungssystems ist die<br />
„<strong>Nachhaltig</strong>keitsinitiative Zement“ des „Weltwirtschaftsrats<br />
für <strong>Nachhaltig</strong>e Entwicklung“. Der B<strong>und</strong>esverband der<br />
Deutschen Transportbetonindustrie e. V. (BTB) wird das Zertifizierungssystem<br />
hierzulande organisieren, darüber informieren,<br />
beraten <strong>und</strong> schulen. Ziel sei es, „die Transparenz<br />
über den Herstellungsprozess von Beton <strong>und</strong> dessen Wertschöpfungskette<br />
sowie deren Auswirkungen auf das soziale<br />
<strong>und</strong> ökologische Umfeld“ zu fördern, so Dr. Olaf Aßbrock,<br />
Hauptgeschäftsführer des BTB. Das System ist vergleichbar<br />
mit dem FSC-Siegel <strong>und</strong> soll von allen großen Gebäudezertifizierungssystemen<br />
wie BREEAM (Building Research Establishment<br />
Environmental Assessment Methodology), LEED<br />
(Leadership in Energy and Environmental Design) <strong>und</strong> DGNB<br />
(Deutsche Gesellschaft für <strong>Nachhaltig</strong>es Bauen) anerkannt<br />
werden.<br />
Zertifizierungssysteme sind gefragt<br />
Dass sich <strong>Nachhaltig</strong>keit immer mehr aus der Nische bewegt<br />
<strong>und</strong> zum Standard wird, zeigt auch die steigende<br />
Zahl von <strong>Nachhaltig</strong>keitszertifikaten.<br />
Wie eine kürzlich veröffentlichte gemeinsame Auswertung<br />
der Professional Group (PG) Sustainability der RICS<br />
Deutschland <strong>und</strong> des IRE|BS Instituts für Immobilienwirtschaft<br />
belegt, sind europaweit r<strong>und</strong> 22.500 Immobilien<br />
mit einem <strong>Nachhaltig</strong>keitszertifikat ausgezeichnet. Das<br />
entspreche einer Steigerung von 16 Prozent im Vergleich<br />
zum Vorjahreszeitraum.<br />
Dazu trägt neben steigenden gesetzlichen Anforderungen<br />
auch das wachsende Interesse von Investoren bei. Diese<br />
kämen am Thema <strong>Nachhaltig</strong>keit nicht mehr vorbei, wie<br />
es in einer Studie von LaSalle Investment Manage- >><br />
Ausgabe 9 | Mai 2018 | Umweltdialog.de<br />
25
Bauen <strong>und</strong> Wohnen<br />
Energieeffizient <strong>bauen</strong> <strong>und</strong> wohnen:<br />
Ein Ausblick<br />
Isolierglasfenster<br />
Keine Energiekosten,<br />
Nullemissionen <strong>und</strong> ein<br />
ges<strong>und</strong>es Raumklima<br />
– sieht so das Gebäude<br />
der Zukunft aus? Zweifellos<br />
werden wir künftig<br />
nicht nur komfortabler<br />
wohnen, sondern vor<br />
allem energieeffizienter<br />
<strong>und</strong> nachhaltiger. Schon<br />
heute gibt es viele kluge<br />
Technologien <strong>und</strong> Ideen,<br />
wie Häuser Energie effizient<br />
nutzen <strong>und</strong> dadurch<br />
Treibhausgasemissionen<br />
einsparen können. Ein<br />
Ausblick.<br />
Hochwirksame Wärmedämmung:<br />
Dazu zählt z.B. eine verbesserte<br />
Dämmung der Dachflächen, der Außenwand<br />
<strong>und</strong> ggf. der Kellerwand.<br />
Energieeffiziente, intelligente Haushaltsgeräte<br />
wie Waschmaschine,<br />
Backofen oder Kühlschrank, die aus<br />
der Ferne gesteuert werden können<br />
Verbesserte Gebäudeautomation<br />
<strong>und</strong><br />
Kontrollsysteme, die auf<br />
veränderte Bedingungen<br />
reagieren <strong>und</strong> etwa<br />
die Beleuchtung oder<br />
Lüftung nach Bedarf<br />
regulieren<br />
Intelligente Stromzähler <strong>und</strong> -netze, die Angebot<br />
<strong>und</strong> Nachfrage in Echtzeit anpassen<br />
Grafik: shutterstock.com<br />
Geothermie <strong>und</strong><br />
Wärmepumpe<br />
26 Ausgabe 9 | Mai 2018 | Umweltdialog.de
Bauen <strong>und</strong> Wohnen<br />
Solarthermie: kann für die<br />
Heizung <strong>und</strong> die Warmwasserbereitung<br />
genutzt werden<br />
Tageslichtnutzung<br />
Fotovoltaikanlagen wandeln<br />
Sonnenenergie in Strom<br />
um. Um den bestmöglichen<br />
Ertrag zu erzielen, sollten<br />
die Solarmodule nach Süden<br />
ausgerichtet sein.<br />
Lüftungsanlage: Sie verbessert u.a. das<br />
Raumklima. Mit Wärmerückgewinnung ist<br />
sie besonders energieeffizient.<br />
Energieeffiziente Beleuchtungs-,<br />
Heiz-, Lüftungs<strong>und</strong><br />
Klimatechnik<br />
Das durchschnittliche CO 2<br />
-Einsparpotenzial<br />
durch energieeffiziente Technologien beläuft<br />
sich auf<br />
20-45 %<br />
Quelle: klimafakten.de<br />
Ausgabe 9 | Mai 2018 | Umweltdialog.de<br />
27
Bauen <strong>und</strong> Wohnen<br />
ment heißt. „Die Bedeutung umweltfre<strong>und</strong>licher Gebäudeeigenschaften<br />
hat in den letzten Jahren stark zugenommen<br />
<strong>und</strong> einen Punkt erreicht, an dem Investoren ihnen,<br />
neben weiteren langfristigen <strong>Trends</strong>, Beachtung schenken<br />
sollten“, so Mahdi Mokrane, LaSalle's European Head<br />
of Research & Strategy.<br />
Darüber, dass sich nachhaltige Gebäude nicht nur unter<br />
Umweltgesichtspunkten, sondern auch wirtschaftlich<br />
rechnen, ist man sich in Fachkreisen inzwischen einig. Zu<br />
den Vorteilen zählen neben niedrigeren Energie- <strong>und</strong> Betriebskosten<br />
unter anderem ein höherer Immobilienwert,<br />
höhere Mieten, weniger Leerstand, aber auch bessere Lebens-<br />
<strong>und</strong> Arbeitsbedingungen <strong>und</strong> – damit einhergehend<br />
– Ges<strong>und</strong>heits- <strong>und</strong> Produktivitätsvorteile für die Nutzer<br />
<strong>und</strong> Eigentümer.<br />
In Deutschland <strong>und</strong> weltweit haben sich verschiedene<br />
Gebäude- bzw. Green-Building-Zertifizierungssysteme<br />
entwickelt. Diese bewerten die Gebäudequalität anhand<br />
festgelegter Kriterien <strong>und</strong> weisen diese durch ein entsprechendes<br />
Zertifikat aus. So können sich Anleger, aber auch<br />
Gebäudenutzer, entweder über die Gesamtbewertung oder<br />
in Form einer differenzierten Darstellung über die Eigenschaften<br />
des Gebäudes informieren. Welche Kriterien wie<br />
stark gewichtet werden, hängt vom jeweiligen System sowie<br />
von den jeweiligen landestypischen Standards, Vorschriften<br />
<strong>und</strong> klimatischen Bedingungen ab. Alle „großen“<br />
Systeme bewerten jedoch die effiziente Nutzung von Ressourcen<br />
wie Energie <strong>und</strong> Wasser. Auch der Standort, die<br />
Nähe zu öffentlichen Verkehrsmitteln sowie der Komfort<br />
finden bei den meisten Zertifizierungssystemen Berücksichtigung.<br />
Kostenaspekte werden hingegen oftmals außer<br />
Acht gelassen.<br />
Das Nebeneinander der zahlreichen Zertifizierungssysteme<br />
gibt aber auch Anlass zur Kritik, führt es doch dazu,<br />
dass sich die Ergebnisse teilweise stark voneinander unterscheiden.<br />
Was ein nachhaltiges Gebäude bzw. ein Green<br />
Building auszeichnet, unterscheidet sich demnach von<br />
Land zu Land <strong>und</strong> von System zu System. Bemängelt wird<br />
zudem, dass zum Teil nur der Ist-Zustand zum Zeitpunkt<br />
der Überprüfung berücksichtigt wird anstelle des gesamten<br />
Lebenszyklus der Immobilie.<br />
Regelmäßige Rezertifizierungen, die die nachhaltige Bewirtschaftung<br />
der Immobilie kontrollieren <strong>und</strong> sicherstellen,<br />
könnten hier Abhilfe schaffen. Darüber hinaus könnten<br />
Initiativen wie die Sustainable Building Alliance zu einer<br />
besseren Vergleichbarkeit beitragen. Die Dachorganisation,<br />
der alle großen Zertifizierungssysteme angehören, wurde<br />
mit dem Ziel gegründet, ein Rahmenwerk für systemübergreifende<br />
Kriterien für nachhaltige Gebäude zu schaffen.<br />
BREEAM<br />
Das älteste, weltweit am<br />
meisten verbreitetste Zertifizierungssystem<br />
ist die<br />
Building Research Establishment<br />
Environmental<br />
Assessment Method<br />
(BREEAM). Sie wurde<br />
1990 vom Building Research<br />
Establishment, einem<br />
Bauforschungsinstitut, in England<br />
auf den Markt gebracht <strong>und</strong><br />
war Vorbild für viele andere Systeme weltweit. BREEAM<br />
bezieht insbesondere die Kriterien Management, Energie,<br />
Wasser, Landverbrauch <strong>und</strong> Ökologie, Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong><br />
Wohlbefinden, Transport, Material <strong>und</strong> Verschmutzung<br />
bei der Bewertung von Sanierungen <strong>und</strong> Neubauten ein.<br />
Je nach Erfüllungsgrad werden Gütesiegel in den Abstufungen<br />
„Ausgezeichnet“, „Sehr gut“, „Gut“ oder „Durchschnittlich/Bestanden“<br />
vergeben. Nach BREEAM wurden<br />
weltweit bereits über 200.000 Bauten zertifiziert (Stand<br />
2016).<br />
LEED<br />
Auf BREEAM basierend entwickelte<br />
der US Green Building<br />
Council im Jahr 1996<br />
das Zertifizierungssystem<br />
Leadership in Energy and<br />
Design (LEED). Das System<br />
ist mittlerweile ein<br />
anerkannter Standard in<br />
vielen Ländern der Welt. Der<br />
Kriterienkatalog umfasst die<br />
Bereiche <strong>Nachhaltig</strong>er Gr<strong>und</strong> <strong>und</strong><br />
Boden, Wassereffizienz, Energie <strong>und</strong> Atmosphäre, Materialien<br />
<strong>und</strong> Ressourcen, Innenraumqualität sowie Innovation<br />
<strong>und</strong> Designprozess. Eine Besonderheit von LEED sind<br />
die Vorbedingungen: Sollten bestimmte Mindestanforderungen<br />
– wie zum Beispiel die Verringerung negativer<br />
28 Ausgabe 9 | Mai 2018 | Umweltdialog.de
Bauen <strong>und</strong> Wohnen<br />
Der Nutzer kann – wenn er nicht<br />
zufällig selbst vom Fach ist –<br />
die komplexen Anforderungen<br />
<strong>und</strong> Entstehungsprozesse kaum<br />
bewerten. Genauso wenig, wie<br />
ich den Vitamingehalt eines<br />
Orangensafts in meiner Küche<br />
prüfen kann <strong>und</strong> deshalb auf das<br />
entsprechende Zertifikat sehe.<br />
Genau hier liegt die Funktion<br />
von Zertifikaten <strong>und</strong> der Gr<strong>und</strong><br />
dafür, dass sie immer<br />
wichtiger werden.<br />
Umweltauswirkungen durch Baustellenaktivitäten<br />
oder aber die Berücksichtigung<br />
von Recyclingmöglichkeiten<br />
bei der Entsorgung – nicht erfüllt<br />
werden, ist eine Zertifizierung von<br />
vorne herein ausgeschlossen.<br />
Gebäudezertifizierung in Deutschland<br />
Prof. Alexander Rudolphie,<br />
Präsident DGNB<br />
Deutschland ist im internationalen<br />
Vergleich ein Nachzügler in Sachen<br />
Zertifizierungssysteme. Seit 2009<br />
gibt es hierzulande das Deutsche Gütesiegel<br />
<strong>Nachhaltig</strong>es Bauen (DGNB).<br />
Das System entstand als Gemeinschaftsprojekt<br />
des B<strong>und</strong>esbauministeriums<br />
<strong>und</strong> der Deutschen Gesellschaft<br />
für <strong>Nachhaltig</strong>es Bauen <strong>und</strong> gilt als<br />
eines der umfassendsten Zertifizierungssysteme<br />
weltweit. So bewertet<br />
es eine Vielzahl an ökonomischen,<br />
ökologischen, soziokulturellen, technischen<br />
<strong>und</strong> funktionalen Aspekten.<br />
Nach einer Pilotphase, in der das<br />
System erfolgreich erprobt wurde,<br />
trennten sich die Wege der Partner.<br />
Auf Basis des gemeinsam erarbeiteten<br />
Systems führte das B<strong>und</strong>esbauministerium<br />
ein eigenes Bewertungssystem<br />
fort: das Bewertungssystem <strong>Nachhaltig</strong>es<br />
Bauen für B<strong>und</strong>esbauten<br />
(BNB). Während das DGNB-Zertifikat<br />
von privaten Bauherren angewendet<br />
wird, gilt die BNB-Zertifizierung für<br />
öffentliche B<strong>und</strong>esbauten. Bei beiden<br />
Systemen können am Ende der Zertifizierungsphase<br />
die Qualitätsstandards<br />
Gold, Silber oder Bronze erreicht werden.<br />
Das Qualitätssiegel <strong>Nachhaltig</strong>er<br />
Wohnungsbau (NaWoh) ist ebenfalls<br />
an das DGNB-System angelehnt. Es<br />
ist jedoch kompakter <strong>und</strong> rechnet sich<br />
dadurch auch für typische Anwender<br />
des Wohnungsbaus wie Wohnungsbaugesellschaften<br />
<strong>und</strong> -genossenschaften.<br />
Das NaWoh-Bewertungssystem<br />
wurde in der AG <strong>Nachhaltig</strong>er<br />
Wohnungsbau entwickelt, findet seit<br />
2012 auf freiwilliger Basis Anwendung<br />
<strong>und</strong> ist auf die Bedürfnisse des<br />
Wohnungsneubaus zugeschnitten.<br />
Neben den britischen, US-amerikanischen<br />
<strong>und</strong> deutschen Gebäudezertifizierungssystemen<br />
gibt es viele weitere<br />
Methoden: so etwa das französische<br />
HQE (Haute Qualité Environnementale)<br />
aus dem Jahr 2004, das australische<br />
Green-Star-System, das seit 2003<br />
besonders umweltfre<strong>und</strong>liche Büro<strong>und</strong><br />
Gewerbebauten auszeichnet,<br />
sowie das asiatische Casbee (Comprehensive<br />
Assessment System for<br />
Building Environmental Efficiency),<br />
das 2001 in Japan eingeführt wurde.<br />
Der neue „WELL Building<br />
Standard“<br />
Der WELL Building Standard wurde<br />
vom International WELL Building Institute<br />
entwickelt <strong>und</strong> wird von der Organisation<br />
Green Business Certification<br />
Inc. zertifiziert. Das Besondere: Die<br />
Gebäudezertifizierung berücksichtigt<br />
vornehmlich Gebäudemerkmale, die<br />
einen Einfluss auf die Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong><br />
das Wohlbefinden der Gebäudenutzer<br />
haben. Dazu zählen etwa die Innenraumluftqualität<br />
<strong>und</strong> Akustik, ausreichend<br />
natürliches Tageslicht <strong>und</strong> die<br />
Integration biophiler Designelemente.<br />
Interface, ein Hersteller modularer<br />
Bodenbeläge, hat dazu jetzt den Design<br />
Guide „Positive Räume schaffen –<br />
Mit dem Well Building Standard“ veröffentlicht.<br />
Der Leitfaden richtet sich<br />
an Architekten, Designer <strong>und</strong> Planer<br />
<strong>und</strong> wurde mit dem Ziel entwickelt,<br />
sie bei der Umsetzung des Standards<br />
zu unterstützen. f<br />
Ausgabe 9 | Mai 2018 | Umweltdialog.de<br />
29
Bauen <strong>und</strong> Wohnen<br />
Good Practice Beispiele<br />
für zertifizierte Gebäude<br />
50hertz Netzquartier<br />
Architekturbüro: LOVE architecture<br />
and urbanism<br />
Fertigstellung: 2016<br />
Standort: Berlin<br />
Zertifikat: DGNB Diamant<br />
Foto: LOVE architecture and urbanism<br />
Deutsche Börse: The Cube<br />
Architekturbüro: KSP Jürgen Engel Architekten<br />
Fertigstellung: 2010<br />
Standort: Eschborn bei Frankfurt<br />
Zertifikat: LEED-Zertifikat Platin für deutsches Hochhaus<br />
Fotos: Deutsche Börse AG<br />
30 Ausgabe 9 | Mai 2018 | Umweltdialog.de
Bauen <strong>und</strong> Wohnen<br />
Büroturm 1 Bligh<br />
Architekturbüro: Ingenhoven Architects<br />
Fertigstellung: 2011<br />
Standort: Sydney<br />
Zertifikat: Green Star<br />
Fotos: ingenhoven architects / HGEsch<br />
The Edge<br />
Architekturbüro: PLP Architecture<br />
Fertigstellung: 2014<br />
Standort: Amsterdam<br />
Zertifikat: BREEAM NL New Construction<br />
Fotos: Ronald Tilleman / OVG real estate<br />
Ausgabe 9 | Mai 2018 | Umweltdialog.de<br />
31
Bauen <strong>und</strong> Wohnen<br />
Advertorial<br />
Moderne Gebäude müssen vielen<br />
Ansprüchen genügen: Sie sollen nicht<br />
nur möglichst energieeffizient, sondern<br />
auch ein Ort zum Wohlfühlen<br />
sein. Intelligente Fenster ermöglichen<br />
genau das. Sie können das einströmende<br />
Tageslicht <strong>und</strong> die Temperatur<br />
in Sek<strong>und</strong>enschnelle regulieren. Die<br />
Flüssigkristallfenster-Technologie<br />
des Darmstädter Wissenschafts- <strong>und</strong><br />
Technologieunternehmens Merck bietet<br />
dafür die Gr<strong>und</strong>lage.<br />
Ein Blick durch die Flüssigkristallfenster im Schachbrettmodus<br />
– so lässt sich der helle <strong>und</strong> dunkle<br />
Zustand der Scheiben gleichzeitig zeigen.<br />
EINE SONNENBRILLE<br />
FÜR FENSTER<br />
Energetische Anforderungen für Neubauten <strong>und</strong> Sanierungen<br />
sowie freiwillige Initiativen der Wirtschaft haben<br />
laut Umweltb<strong>und</strong>esamt dazu geführt, dass der Energieverbrauch<br />
für das Heizen von Gebäuden in den letzten Jahren<br />
zurückgegangen ist. Im Vergleich dazu seien bei der Kühlung<br />
jedoch gegenläufige <strong>Trends</strong> zu beobachten: Hier könnte<br />
der Bedarf weiter steigen. Gründe dafür sind beispielsweise<br />
wachsende Ansprüche an das Innenraumklima. Das<br />
gilt sowohl für Wohn- als auch für Bürogebäude.<br />
Das moderne Büro: Behaglich <strong>und</strong> lichtdurchflutet<br />
Wie eine Studie herausfand, wünschen sich vor allem jüngere<br />
Beschäftigte helle, lichtdurchflutete Räume mit großen<br />
Fenstern. Der Nachteil: Gerade in den Sommermonaten<br />
heizt das einströmende Tageslicht die Räume stark auf.<br />
Um ein behagliches Innenraumklima sicherzustellen, kommen<br />
in der Regel Klimaanlagen zum Einsatz. Jalousien oder<br />
Rollläden dienen als Sonnen- bzw. Blendschutz. Allerdings<br />
verdunkeln diese die Räume oft so stark, dass künstliches<br />
Licht eingeschaltet werden muss.<br />
Intelligente Fenster: Einsparungen von bis zu<br />
40 Prozent möglich<br />
Ein effizientes Licht- <strong>und</strong> Temperaturmanagement ist folglich<br />
eine wichtige Stellschraube, um Energie <strong>und</strong> Kosten zu<br />
sparen. Das dachte man sich auch bei Merck. „Wir haben<br />
uns gefragt: Gibt es da nicht eine bessere, nachhaltigere<br />
Lösung?“, erinnert sich der Chemiker Johannes Canisius.<br />
Er ist einer der Köpfe hinter der neuen energieeffizienten<br />
Technologie von Merck für intelligente Fenster. Seit<br />
2012 arbeitet er mit seinem Team an der Entwicklung von<br />
Flüssigkristallfenstern, den sogenannten Liquid Crystal<br />
Windows (LCW). „Wir haben den Fenstern eine Art Sonnenbrille<br />
aufgesetzt“, erläutert Johannes Canisius, der<br />
das 2016 eigens für die LCW-Technologie gegründete Geschäftsfeld<br />
im Unternehmensbereich Performance Materials<br />
leitet. „Durch unsere Flüssigkristalltechnologie lässt<br />
sich das einfallende Licht auf Knopfdruck regulieren. Bei<br />
Sonne kann der Raum stufenlos auf wenige Prozent abgedunkelt<br />
werden <strong>und</strong> heizt sich weniger stark auf. “ Ein<br />
Vorteil gegenüber Jalousien ist, dass das Licht durch die<br />
mit der LCW-Technologie ausgestatteten Fenster hindurch<br />
gelassen <strong>und</strong> ein unverändert freier Durchblick gewährt<br />
wird. Alles in allem geht man bei Merck von Einsparungen<br />
von bis zu 40 Prozent beim Gebäudeenergieverbrauch aus.<br />
Merck: 110 Jahre Erfahrung mit Flüssigkristallen<br />
Flüssigkristalle finden sich unsichtbar in vielen Alltagsgegenständen<br />
wieder. So werden sie seit Langem in flachen<br />
Displays von Smartphones, Tablets oder Fernsehern eingesetzt.<br />
Merck arbeitet eigenen Angaben zufolge seit mehr<br />
als 110 Jahren mit Flüssigkristallen <strong>und</strong> ist mit seiner<br />
Erfahrung <strong>und</strong> seinem Know-how auf diesem Gebiet der<br />
32 Ausgabe 9 | Mai 2018 | Umweltdialog.de
Foto: Ingmar Kurth / Merck<br />
weltweit führende Lieferant für Display-Hersteller.<br />
Mit Fenstern bringt man diese Technologie<br />
in der Regel nicht in Verbindung.<br />
Bis jetzt: Unter dem Markennamen<br />
Licrivision bietet Merck seine<br />
Flüssigkristallmaterialien nun auch<br />
für den Einsatz in intelligenten Fenstersystemen<br />
an. Das funktioniert ähnlich<br />
wie bei Displays: Durch Anlegen<br />
einer elektrischen Spannung können<br />
die Flüssigkristalle in verschiedene<br />
Anordnungen gebracht werden. Je<br />
nach Anordnung strömt mehr oder<br />
weniger Licht <strong>und</strong> damit Wärme durch<br />
die Flüssigkristallschicht, die unsichtbar<br />
zwischen zwei Glasscheiben eingebracht<br />
wird. Auf diese Weise lässt<br />
sich das Fenster sehr komfortabel heller<br />
oder dunkler schalten – individuell<br />
oder auch automatisch <strong>und</strong> zentral<br />
über Innen- <strong>und</strong> Außensensoren. Auf<br />
Wunsch liefern integrierte Solarzellen<br />
den Strom.<br />
Über die Sonnenschutzfunktion hinaus<br />
lassen sich Liquid Cristal Windows<br />
auch als Sichtschutz verwenden. In<br />
der sogenannten Privacy-Variante<br />
lässt sich die Scheibe bei Bedarf von<br />
kristallklar auf milchig-<strong>und</strong>urchsichtig<br />
schalten. Konferenz- oder auch<br />
Wohnräume schützt sie so vor ungewollten<br />
Blicken von außen.<br />
Die Flüssigkristallfenster-Module können<br />
sowohl bei Neubauten als auch<br />
bei Sanierungen eingesetzt werden,<br />
passen sie doch in alle Standardrahmen<br />
<strong>und</strong> Fassaden sowohl neuerer als<br />
auch älterer Gebäude. Die LCW-Technologie<br />
lässt sich in jede gewöhnliche<br />
Doppel- oder Dreifachverglasung integrieren,<br />
eignet sich für jegliche Form<br />
<strong>und</strong> Größe <strong>und</strong> bietet verschiedene<br />
Farbvarianten. Das macht sie vor allem<br />
für Architekten <strong>und</strong> Designer so<br />
interessant.<br />
LCW: Komfort <strong>und</strong> Umweltschutz<br />
im Einklang<br />
Nicht nur mit Blick auf Komfort<br />
<strong>und</strong> Design, sondern auch unter<br />
<strong>Nachhaltig</strong>keitsgesichtspunkten hebt<br />
sich die LCW-Technologie positiv<br />
von anderen Sonnenschutzlösungen<br />
ab: Die Materialmenge für die Flüssigkristallschicht<br />
ist laut Merck sehr<br />
gering.<br />
Dass die LCW-Technologie darüber<br />
hinaus sehr haltbar, temperatur- <strong>und</strong><br />
UV-resistent ist, zeigt die Praxis: Die<br />
westliche Fensterfront des Innovationszentrums<br />
von Merck in Darmstadt<br />
ist seit 2015 mit Flüssigkristallfenstern<br />
ausgestattet. Seitdem trotzen sie<br />
erfolgreich auch widrigen Wetterbedingungen<br />
wie starker Hitze oder Eiseskälte.<br />
Die Sonnenschutz- <strong>und</strong> „Privacy“-Anwendung<br />
wiederum findet<br />
sich seit September 2016 ebenfalls in<br />
Darmstadt im neuen OLED-Produktionsgebäude.<br />
Flüssigkristallfenster – der neue<br />
Standard<br />
„<br />
Bauen <strong>und</strong> Wohnen<br />
Moderne Bauwerke bekommen immer mehr<br />
Ähnlichkeit mit lebenden Organismen. Ihre<br />
Fassade gleicht einer Haut, die dafür sorgt,<br />
dass es im Inneren komfortabel ist. Wie im<br />
menschlichen Körper müssen auch in<br />
einem Gebäude alle Teile harmonisch<br />
zusammen funktionieren. Unsere Flüssigkristalle<br />
reihen sich hier bestens ein. Sie<br />
lassen sich nahtlos in andere Licht- <strong>und</strong><br />
Energieregulierungen eines Gebäudes<br />
integrieren, nutzen das Tageslicht optimal<br />
aus <strong>und</strong> machen das Bauwerk zu einem<br />
Platz, an dem wir uns gerne aufhalten.<br />
Caspar van Oosten, Geschäftsführer von Merck Window Technologies,<br />
ehemals Gründer <strong>und</strong> Miteigentümer des niederländischen Start-up-Unternehmens<br />
Peer+, das die LCW-Technologie gemeinsam mit Merck entwickelt hat.<br />
Bei Merck ist man überzeugt, dass<br />
Flüssigkristallfenster schon in absehbarer<br />
Zeit zum Standard werden.<br />
Michael Heckmeier, Leiter der Geschäftseinheit<br />
Display Solutions: „Liquid<br />
Crystal Windows haben unserer<br />
Flüssigkristalltechnologie eine ganz<br />
neue Richtung gegeben. Sie werden<br />
schon bald fester Bestandteil moderner<br />
Architektur <strong>und</strong> nachhaltigen Gebäudemanagements<br />
sein.“ Daher ist<br />
es nur konsequent, dass Merck Ende<br />
vergangenen Jahres r<strong>und</strong> 15 Millionen<br />
Euro in eine eigene Produktionsstätte<br />
für Flüssigkristallfenster-Module<br />
im niederländischen Veldhoven<br />
(bei Eindhoven) investiert hat. Für<br />
die Technologie erhielt Merck ebenfalls<br />
2017 den Technology Innovation<br />
Award in der Kategorie „Smart Glass<br />
Industry“ von Frost & Sullivan.<br />
Die Jury hob vor allem die schnellen<br />
Schaltzeiten, die Langlebigkeit, die<br />
Anpassungsfähigkeit <strong>und</strong> die Ästhetik<br />
des Produkts als wichtige Eigenschaften<br />
von intelligenten Verglasungen<br />
hervor. Bei allen diesen Kriterien<br />
habe Merck die Nase vorn. Auf diesem<br />
Erfolg will man sich bei Merck aber<br />
nicht ausruhen: Längst arbeitet man<br />
am Einsatz der LCW-Technologie in<br />
Fahrzeugen. Weitere Anwendungsgebiete<br />
wie die Luft- <strong>und</strong> Seefahrt werden<br />
derzeit erforscht. f<br />
Ausgabe 9 | Mai 2018 | Umweltdialog.de<br />
33
Bauen <strong>und</strong> Wohnen<br />
Die leisen<br />
Die Diskussionen um Luftqualität im Freien nehmen kein Ende. Der<br />
jüngste Beschluss des B<strong>und</strong>esverwaltungsgerichts zum Diesel-Fahrverbot<br />
zeigt: Das Ringen um saubere Atemluft ist ein langwieriger Prozess,<br />
dem nicht mit einfachen Antworten beizukommen ist. Was kaum Beachtung<br />
findet: Auch unsere Luft in Innenräumen ist längst nicht mehr so<br />
sauber, wie sie sein sollte.<br />
Wer ges<strong>und</strong> sein will, sollte Krankheiten<br />
meiden. Was ironisch<br />
klingt, hat durchaus einen ernsten<br />
Hintergr<strong>und</strong>: Unser modernes<br />
Verständnis von Ges<strong>und</strong>heit<br />
<strong>und</strong> ihrer Erhaltung suggeriert<br />
Mess-, vor allem aber Planbarkeit.<br />
Digital erfassen wir unsere<br />
Vitaldaten, machen Sport<br />
zum optimalen Zeitpunkt in<br />
der optimalen Herzfrequenz,<br />
stimmen die Ernährung individuell<br />
darauf ab. Trotz aller<br />
Mühen wird ein Faktor in der<br />
öffentlichen Wahrnehmung so<br />
gut wie ausgeblendet: Die Luftqualität<br />
in unseren Innenräumen.<br />
Dabei drängt sich das Thema bei<br />
näherer Betrachtung förmlich<br />
auf. Mitteleuropäische<br />
Erwachsene halten sich<br />
bis zu 90 Prozent des<br />
Tages in geschlossenen<br />
Räumen auf, etwa am<br />
Arbeitsplatz, zu Hause,<br />
in Verkehrsmitteln wie<br />
Bus oder Auto, in öffentlichen<br />
Einrichtungen.<br />
Das ist Zeit, in denen sie<br />
alles einatmen, was in geschlossenen<br />
Räumen ausdünsten kann: Kleber,<br />
Farben, Lacke, Textilien oder andere<br />
Baustoffe, zusammengefasst als<br />
„Flüchtige organische Verbindungen“<br />
(VOC, Volatile Organic Compo<strong>und</strong>s).<br />
Es muss gar nicht mal Asbest sein.<br />
Erschreckend: Nach einer Analyse der<br />
Weltges<strong>und</strong>heitsorganisation (WHO)<br />
starben 2012 weltweit etwa 3,7 Millionen<br />
Menschen an Luftverschmutzung<br />
im Freien, aber 4,3 Millionen an<br />
schlechter Luft in Innenräumen.<br />
Multiple Chemikalien-Sensibilität<br />
Sogar ein eigenes Krankheitsbild<br />
haben Experten schon definiert, welches<br />
zum Großteil auf die unbemerkten<br />
Emissionen zurückzuführen ist.<br />
Menschen mit „Multipler Chemikalien-Sensibilität“<br />
leiden unter starken<br />
Kopfschmerzen, Hautausschlag, Husten,<br />
Bauchschmerzen, Übelkeit, Asthma<br />
oder Schwindel. Die Liste der möglichen<br />
Symptome ist genauso lang<br />
wie unspezifisch. Das Problem: Wird<br />
die Quelle der Ausdünstungen nicht<br />
beseitigt, nutzt eine medizinische Behandlung<br />
nur sehr wenig.<br />
Ausgabe 9 | Mai 2018 | Umweltdialog.de
Bauen <strong>und</strong> Wohnen<br />
Lüften <strong>und</strong> Lehmhütten<br />
Was tun gegen die leise Luftverschmutzung? Das Umweltb<strong>und</strong>esamt<br />
hat beispielsweise <strong>Tipps</strong> für richtiges Lüften<br />
von Innenräumen herausgegeben. Klingt banal, ist aber<br />
wichtig, sind doch Innenräume je nach Funktion anderen<br />
Schadstoffen ausgesetzt. Im Badezimmer ist es feuchter als<br />
in einem Konferenzraum. Regelmäßiges Stoßlüften ist nach<br />
wie vor das Mittel der Wahl. Letztendlich kommt aber hier<br />
die Diskussion um die gr<strong>und</strong>sätzliche Luftqualität ins Spiel.<br />
Lüften nutzt nur dann etwas, wenn die zirkulierende Luft<br />
aus dem Freien sauber ist. Auch der Standort des Gebäudes<br />
ist von Bedeutung: Steht das Wohnhaus an einer Hauptverkehrsstraße,<br />
wird die Frage, ob man das Fenster öffnet, im<br />
wahrsten Sinne zur Wahl zwischen Pest <strong>und</strong> Cholera.<br />
Erfolgsversprechend ist der Einsatz von neuartigen Baumaterialien.<br />
In heißeren, aber auch gemäßigten Klimazonen<br />
schätzen die Menschen seit Jahrtausenden die feuchtigkeitsregulierende<br />
Eigenschaft von Lehm. Der antike Baustoff<br />
kann sowohl Feuchtigkeit speichern als auch wieder<br />
abgeben, falls die Luftfeuchtigkeit im Raum entsprechend<br />
sinkt. Dabei wird die Luft gefiltert <strong>und</strong> Schadstoffe werden<br />
geb<strong>und</strong>en. In Berlin forschen Wissenschaftler deshalb daran,<br />
diese Eigenschaft in zeitgemäße Baustoffe zu übertragen<br />
<strong>und</strong> damit die Luftqualität in Neubauten zu verbessern.<br />
Angenehmer Nebeneffekt: Lehm bietet eine ausgezeichnete<br />
Wärmedämmung, die ihn als Baustoff noch attraktiver<br />
macht. f<br />
Die Rohbau-Riecher<br />
Neue Materialien <strong>und</strong> Bauprodukte verströmen oft unangenehme<br />
Gerüche. Um ihnen auf die Spur zu kommen,<br />
entwickelten die Forscher des Fraunhofer Instituts für<br />
Bauphysik (IBP) die Skala „Smell Intensity Level“<br />
(SmILe). Sie soll helfen, die Fehlgerüche von Räumen<br />
<strong>und</strong> Materialien zu identifizieren. Anhand der Skala<br />
können die sogenannten „Geruchsprüfer“ die aufgenommenen<br />
Ausdünstungen bewerten. Diese besteht aus<br />
insgesamt sieben Kategorien von „kaum wahrnehmbar“<br />
bis „extrem stark“. Bislang schulte das Fraunhofer<br />
Institut 30 Personen zum Geruchsprüfer. Die Prüfung<br />
eines Raumes verläuft unkompliziert: Die Prüfer betreten<br />
den ungelüfteten Raum <strong>und</strong> bewerten ihn dann hinsichtlich<br />
der empf<strong>und</strong>enen Geruchsintensität. Je mehr<br />
Personen vor Ort sind, desto statistisch genauer ist das<br />
Ergebnis. Das wird dann mithilfe der „SmILe“-Skala<br />
genau ermittelt. Ziel dabei ist es, die Entwicklung<br />
geruchlich verbesserter Bauprodukte zu fördern.<br />
Zusätzlich können so die Auswirkungen der Materialien<br />
auf die Innenraumluftqualität definiert werden.<br />
Grafiken: phocks eye / stock.adobe.com<br />
Ausgabe 9 | Mai 2018 | Umweltdialog.de<br />
35
Bauen <strong>und</strong> Wohnen<br />
Wenn der Sand<br />
Bauvorhaben verbrauchen weltweit so viel<br />
Sand <strong>und</strong> Kies, dass der Rohstoff in einigen<br />
Gegenden bereits knapp wird. Wird er dabei<br />
massiv aus dem Meer abgebaut, verändern<br />
sich die maritimen Ökosysteme. Das macht<br />
Baustoffrecycling <strong>und</strong> den Einsatz alternativer<br />
Baumaterialien notwendig, um den Gebäudebau<br />
nachhaltiger zu gestalten.<br />
Weil es so viel Sand auf der Welt gibt, wird seine Bedeutung<br />
oft unterschätzt. Der Rohstoff steckt in vielen Produkten,<br />
die uns täglich umgeben <strong>und</strong> unerlässlich für uns sind.<br />
Er kommt in Zahnpasta, Kosmetika, Arzneimitteln, aber<br />
auch in Papier, Mikrochips oder Solarzellen vor. Darüber<br />
hinaus ist Sand der wichtigste Bestandteil von Stahlbeton,<br />
ohne den wir keine Straßen, Brücken oder Häuser <strong>bauen</strong><br />
könnten. Laut UN-Umweltprogramm UNEP werden so jährlich<br />
bis zu 60 Milliarden Tonnen Sand <strong>und</strong> Kies gefördert.<br />
Der Großteil davon wird für Infrastruktur- <strong>und</strong> Bauvorhaben<br />
genutzt. Allerdings taugt nicht jeder Sand als Baustoff.<br />
Wüstensand etwa eignet sich kaum für Beton <strong>und</strong><br />
Landaufschüttungen, da seine Körner durch Erosion r<strong>und</strong><br />
geschliffen sind <strong>und</strong> sie daher das Material nicht gut binden<br />
können. Das erklärt auch, warum eine Stadt wie Dubai<br />
beispielsweise tonnenweise Sand aus Lagerstätten der Ostküste<br />
Australiens für seine künstlichen Inseln importieren<br />
musste.<br />
Ökosysteme verändern sich<br />
Eigentlich wird Sand ständig auf natürliche Weise produziert,<br />
indem Felsfragmente in Flüssen auf ihrem Weg von<br />
den Bergen ins Meer mechanisch zerkleinert <strong>und</strong> >><br />
36 Ausgabe 9 | Mai 2018 | Umweltdialog.de
Bauen <strong>und</strong> Wohnen<br />
ausgeht<br />
Foto: Marion Lenzen<br />
Ausgabe 9 | Mai 2018 | Umweltdialog.de<br />
37
Bauen <strong>und</strong> Wohnen<br />
weiter transportiert werden. Dieser Vorgang dauert allerdings<br />
Jahrtausende <strong>und</strong> der aktuelle Verbrauch ist größer<br />
als das, was die Natur herstellen kann. Dabei hat der<br />
Sandabbau zum Teil gravierende Folgen, die ganze Ökosysteme<br />
verändern.<br />
Stammt der Rohstoff beispielsweise aus Meeresvorkommen,<br />
haben zuvor Saugbaggerschiffe den Boden metertief<br />
abgetragen; mit allen dort lebenden Tieren <strong>und</strong> Pflanzen.<br />
In Küstenregionen verstärkt der Rohstoffgewinn die Erosion,<br />
weil u.a. ganze Strände abgebaut werden. Der Rohstoffgewinn<br />
in Flussbetten führt wiederum dazu, dass weniger<br />
Material an die Küsten gespült wird <strong>und</strong> die Landschaft<br />
sich nicht regenerieren kann.<br />
Dass der Sandabbau nicht nur ökologischen Schaden anrichtet,<br />
sondern auch politische Konsequenzen nach sich<br />
zieht, zeigt sich in Asien am Beispiel Singapur. Das kleine<br />
Land hat UNEP zufolge mit 5,4 Tonnen pro Jahr weltweit<br />
den größten Sandverbrauch pro Kopf. Der Gr<strong>und</strong>: In Singapur<br />
hat sich die Bevölkerung innerhalb von wenigen Jahrzehnten<br />
derart vervielfacht, dass die Regierung 130 Quadratkilometer<br />
Land aufgeschüttet hat, um den notwendigen<br />
Platz für die Menschen zu schaffen. Der Sand dafür stammte<br />
hauptsächlich aus Indonesien, wo durch den Rohstoffabbau<br />
mehrere Inseln verschwanden. Das wiederum führte<br />
zu Streitigkeiten über die Abgrenzung von Hoheitsgewässern,<br />
wie der Tagesspeigel berichtet.<br />
Situation in Deutschland<br />
In Deutschland ist der Sandabbau mit ganz eigenen Problemen<br />
verb<strong>und</strong>en: „Aufgr<strong>und</strong> seiner Entstehung gibt es<br />
in Deutschland eine fast unendlich große Menge an Sand,<br />
sodass ihre Tonnage nicht genau berechnet werden kann.<br />
Nur in ganz wenigen Regionen wie in den Großräumen<br />
München oder Stuttgart besteht eine geologische Knappheit.<br />
Allerdings hat die geologische Verfügbarkeit von Sand<br />
nur zu einem geringen Teil mit der tatsächlichen Situation<br />
zu tun“, sagt der Geologe Dr. Harald Elsner von der B<strong>und</strong>esanstalt<br />
für Geowissenschaften <strong>und</strong> Rohstoffe (BGR).<br />
Denn hierzulande stehen viele Sandvorkommen gar nicht<br />
zur Verfügung. Das hat mehrere Gründe: So liegen sie entweder<br />
in Naturschutzgebieten oder unter überbauten Flächen.<br />
In Baden-Württemberg zum Beispiel sind 85 Prozent<br />
der Landesfläche durch diese vorrangigen Nutzungen bereits<br />
verplant.<br />
Foto: Marion Lenzen<br />
Auch die aktuelle Entwicklung auf dem Gr<strong>und</strong>stücksmarkt<br />
behindert die ausreichende Versorgung mit Baurohstoffen,<br />
weiß man bei der BGR. So geben immer weniger Landwirte<br />
ihre Flächen für einen Rohstoffabbau frei. In Zeiten niedriger<br />
Zinsen <strong>und</strong> gleichzeitig steigender Preise für Ackerland<br />
lohne es sich für sie nicht, ihre Flächen zu verkaufen<br />
oder zu verpachten.<br />
Außerdem erschweren langwierige Genehmigungsverfahren<br />
für neue Gewinnungsvorhaben <strong>und</strong> nicht ausreichende<br />
Verarbeitungskapazitäten der Baustoffindustrie die<br />
Versorgungssituation mit Baurohstoffen. Als Folge davon<br />
traten im Jahr 2017 erstmals im Ruhrgebiet Versorgungsengpässe<br />
mit Baurohstoffen für den Straßenbau auf. Für<br />
2018 rechnen die Industrieverbände mit weiteren Lieferengpässen,<br />
die auch andere Regionen Deutschlands betreffen<br />
könnten.<br />
Holz kann jetzt auch hoch<br />
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, um mit der drohenden<br />
Sandknappheit umzugehen <strong>und</strong> die bestehenden Rohstoffvorkommen<br />
zu schonen. Dazu gehört das Recycling von Beton,<br />
um das Material erneut zu verwenden. Dem Umweltb<strong>und</strong>esamt<br />
zufolge ließen sich bis zum Jahr 2050 mehr als<br />
ein Drittel der Sand- <strong>und</strong> Kiesmengen durch aufbereitete<br />
Abbruchmaterialien ersetzen. Bis dahin ist es aber noch<br />
38 Ausgabe 9 | Mai 2018 | Umweltdialog.de
Bauen <strong>und</strong> Wohnen<br />
ein weiter Weg, weil die Wiederverwertung<br />
von Bauschutt aufwendig<br />
<strong>und</strong> teuer ist. Das Problem: Wenige<br />
denken beim Bauen das Recycling mit<br />
<strong>und</strong> verwenden die Materialien so,<br />
dass sie im Nachhinein nur schwer<br />
voneinander zu trennen sind.<br />
Wenn also das Baustoffrecycling noch<br />
nicht die benötigte Menge an einsetzbaren<br />
Materialien liefert, müssen Alternativen<br />
her, um künftig genügend<br />
Wohnungen <strong>und</strong> Häuser <strong>bauen</strong> zu<br />
können. Und das im großen Stil. Wie<br />
das funktionieren kann, zeigen die<br />
Fortschritte beim Bau von Holzhäusern.<br />
Hier hat sich jüngst ein richtiger<br />
Wettbewerb der Superlative entwickelt,<br />
bei dem mehrere Bauherren<br />
versprechen, das jeweils höchste Gebäude<br />
ihrer Art zu errichten.<br />
Ein Beispiel dafür ist das Wohngebäude<br />
Skaio, das bis 2019 in Heilbronn<br />
fertiggestellt wird. Es besteht aus<br />
insgesamt zehn Geschossen <strong>und</strong> soll<br />
Platz für 60 Mietwohnungen bieten.<br />
Nach Angaben der ausführenden Firma<br />
Züblin Timber ist es mit 34 Metern<br />
Höhe das erste Holzhochhaus<br />
Deutschlands. Das Gebäude wird in<br />
einer sogenannten Holz-Hybrid-Bauweise<br />
errichtet: Wände <strong>und</strong> Decken<br />
sind dabei aus Holz <strong>und</strong> werden den<br />
überwiegenden Teil der Konstruktion<br />
ausmachen. Ganz ohne Beton kommt<br />
die Hybrid-Konstruktion aber nicht<br />
aus. Sockelgeschoss <strong>und</strong> Treppenhaus<br />
bestehen jeweils aus Stahlbeton. Das<br />
verlangt das deutsche Baurecht aus<br />
Brandschutzgründen.<br />
Ein großer Vorteil der Holzbauweise<br />
ist die vergleichsweise kurze Bauzeit;<br />
die Holzbauteile werden weitgehend<br />
vorgefertigt <strong>und</strong> vor Ort lediglich<br />
montiert. „Wir <strong>bauen</strong> ein Stockwerk<br />
pro Woche“, sagt Markus Brandl,<br />
Projektleiter bei Züblin Timber. Die<br />
Stützen der beiden Neubauten bestehen<br />
aus Brettschichtholz. Für die<br />
Holzwände <strong>und</strong> -decken verwendet<br />
das Unternehmen ausschließlich Fichtenholz<br />
– überwiegend aus deutschen<br />
Wäldern <strong>und</strong> durchweg versehen mit<br />
PEFC-Zertifikat, dem Siegel für nachhaltige<br />
Forstwirtschaft.<br />
Baumaterialien aus nachwachsenden<br />
Rohstoffen haben den Vorteil, dass<br />
die Produktion relativ wenig Energie<br />
benötigt. Stammen sie darüber hinaus<br />
aus der Region, ist auch ihr Transport<br />
energie- <strong>und</strong> emissionsarm. Neben<br />
Holz testen Wissenschaftler noch weitere<br />
nachwachsende Materialien wie<br />
Hanf, Stroh, Schafwolle oder Seegras,<br />
die künftig beim Bauen vermehrt Einsatz<br />
finden können. Hier allerdings in<br />
erster Linie als Dämmstoffe.<br />
Wenn das mal nicht aufweicht<br />
Auch Häuser aus Altpapier sind möglich,<br />
wie die Schweizer Firma Ecocell<br />
mit ihrem Bausystem zeigt. Sowohl<br />
feuer- als auch wasserresistent, besteht<br />
der Kern aus einer Wabenstruktur<br />
aus 100 Prozent Recyclingpapier<br />
mit einer hauchdünnen Schicht aus<br />
Zement. Im Sandwichverb<strong>und</strong> mit<br />
Holz ergibt die Betonwabe die erste<br />
statisch belastbare Isolation <strong>und</strong> zugleich<br />
tragende Hauswand in einem –<br />
ohne dabei auf die üblichen Baumittel<br />
wie Beton, Kies oder Sand zurückgreifen<br />
zu müssen.<br />
Gebaut wird mit fertigen Wandelementen,<br />
auch Baukastenprinzip genannt.<br />
Dies macht den Aufbau nicht<br />
nur schnell, sondern auch preiswert.<br />
Die Wandelemente werden nach dem<br />
Nut- oder auch Federprinzip verb<strong>und</strong>en<br />
<strong>und</strong> sind somit wieder lösbar. Ein<br />
weiterer Vorteil: die Häuser sind erdbebensicher.<br />
So können die Bausätze<br />
in Containern verschickt <strong>und</strong> für die<br />
Katastrophenhilfe in anderen Ländern<br />
eingesetzt werden. Auch der Hausbau<br />
hierzulande für Flüchtlingsunterkünfte<br />
könnte so vereinfacht <strong>und</strong> vorangetrieben<br />
werden. f<br />
(H)ausgedruckt<br />
Ohne Bagger, Bauschutt <strong>und</strong><br />
Gerüst – Häuser könnten in<br />
Zukunft einfach <strong>und</strong> schnell mit<br />
einem 3-D-Drucker entstehen.<br />
Das klingt unglaublich, ist aber<br />
Realität. Ein Vorzeigeobjekt<br />
dafür ist die chinesische Stadt<br />
Suzhou in der Nähe von Shanghai.<br />
Die Stadt hat mehr als zehn<br />
Millionen Einwohner – <strong>und</strong> einen<br />
enormen Engpass an Wohnfläche.<br />
Auf einem Industriegelände<br />
der Millionenstadt steht<br />
seit 2015 ein Prototyp für ein<br />
ausgedrucktes Haus. Mit einem<br />
selbst entwickelten 3-D-Drucker<br />
setzte das Bauunternehmen<br />
Winsu die einzelnen Elemente zu<br />
1.100 Quadratmetern Wohnfläche<br />
auf zwei Stockwerken<br />
zusammen. Insgesamt soll das<br />
nur zwei Tage gedauert haben.<br />
Die Häuser werden schichtweise<br />
ausgedruckt <strong>und</strong> als einzelne<br />
Elemente auf herkömmliche<br />
Stahlträger gesetzt <strong>und</strong> dann<br />
zusammengefügt. Dabei wird<br />
kein Baustoff verschwendet. Die<br />
Wände sind hohl <strong>und</strong> bestehen<br />
aus Rohstoffresten <strong>und</strong> Bauabfällen.<br />
Für den Bau verwendet<br />
Winsu ausschließlich recycelten<br />
Beton.<br />
Ausgabe 9 | Mai 2018 | Umweltdialog.de<br />
39
Bauen <strong>und</strong> Wohnen<br />
URBAN MINING–<br />
der verborgene Rohstoffschatz in der Stadt<br />
Foto: skpw / stock.adobe.com<br />
Viele der weltweiten Ressourcen werden knapp. Während natürliche Reserven schrumpfen,<br />
ist die moderne Stadt längst zu einer riesigen Rohstoffmine geworden. Urban Mining will diese<br />
wertvollen Rohstoffe langfristig sichern – <strong>und</strong> steht dabei vor großen Herausforderungen.<br />
Von Victoria Scherff<br />
Etwa 50 Milliarden Tonnen Materialien haben wir seit dem<br />
zweiten Weltkrieg angehäuft, vieles davon verbaut in Gebäuden,<br />
Infrastruktur <strong>und</strong> langlebigen Konsumgütern wie<br />
Autos. Dieses Materiallager ist keine schlechte Basis für<br />
das als rohstoffarm geltende Deutschland, das Erze <strong>und</strong><br />
Metalle komplett importieren muss.<br />
Und nicht nur in den Städten Deutschlands findet sich dieser<br />
Rohstoffreichtum: Jede dicht besiedelte industrialisierte<br />
Stadt ist eine riesige Rohstoffmine. Denn es sind vor allem<br />
die Industrieländer, die mit 15 Prozent Anteil an der weltweiten<br />
Bevölkerung r<strong>und</strong> ein Drittel der globalen Rohstoffe<br />
verbrauchen <strong>und</strong> ver<strong>bauen</strong>. Warum nicht diese städtischen<br />
Rohstoffminen sinnvoll nutzen?<br />
Was ist Urban Mining?<br />
Bei diesem Gedanken setzt Urban Mining an <strong>und</strong> will die<br />
in unseren Städten <strong>und</strong> unserer Umwelt verbauten Rohstoffe<br />
aufspüren, sichern <strong>und</strong> nutzbar machen – ohne sie<br />
abzuwerten. Städtische Rohstoffförderung statt klassischer<br />
Bergbau also – Urban Mining gewinnt Rohstoffe aus langlebigen<br />
Gütern wie Elektrogeräten, Autos, Bahntrassen <strong>und</strong><br />
Gebäuden zurück.<br />
Verbaute Materialien wie Ziegel, Gips, Beton, Stahl, Metalle<br />
wie Kupfer, Aluminium <strong>und</strong> Cobalt, aber auch Asphalt <strong>und</strong><br />
Holz werden so als Sek<strong>und</strong>ärrohstoffe wieder nutzbar. Das<br />
Potenzial des menschengemachten Lagers ist enorm:<br />
f Allein auf einer PC-Leiterplatte gibt es 44 unterschiedliche<br />
chemische Elemente.<br />
f In deutschen Bahnhöfen sind r<strong>und</strong> 32 Millionen Tonnen<br />
Materialien langfristig eingeb<strong>und</strong>en.<br />
f In Japan wird die urbane Silber-Mine auf 24 Prozent der<br />
weltweiten Reserven geschätzt.<br />
f Aus einem durchschnittlichen Altbau mit zehn Wohnungen<br />
fallen r<strong>und</strong> 1.500 Tonnen Material zur Verwertung<br />
an, darunter 70 Tonnen Metalle <strong>und</strong> 30 Tonnen Kunststoffe,<br />
Bitumen <strong>und</strong> Holz, berechnete das Umweltb<strong>und</strong>esamt<br />
(UBA).<br />
40 Ausgabe 9 | Mai 2018 | Umweltdialog.de
Bauen <strong>und</strong> Wohnen<br />
Und auch das ist Urban Mining: Die<br />
Rückgewinnung des seltenen Phosphors<br />
aus städtischem Klärschlamm.<br />
In der Schweiz etwa fällt jährlich so<br />
viel Phosphor an, wie importiert wird.<br />
Urban Mining ergänzt Abfallwirtschaft<br />
Doch was unterscheidet Urban Mining<br />
von der klassischen Abfallwirtschaft?<br />
Urban Mining will „möglichst früh<br />
künftige Stoffströme prognostizieren,<br />
[…] noch bevor die Materialien als Abfall<br />
anfallen“, so das UBA. Urban Mining<br />
ergänze also die Abfallwirtschaft<br />
um den Kreislaufgedanken <strong>und</strong> will<br />
vor allem die wertvollen Stoffströme<br />
sinnvoll <strong>und</strong> planbar managen. Nicht<br />
zuletzt will Urban Mining die wertvollen<br />
Stoffe noch vor Abriss <strong>und</strong> Entsorgung<br />
aufspüren, um sie somit sofort<br />
zu sichern <strong>und</strong> sortenrein voneinander<br />
zu trennen.<br />
Eine Sonderform des Urban Mining<br />
ist das Landfill Mining – die Förderung<br />
von Wertstoffen aus Abfällen,<br />
die bereits auf den Mülldeponien liegen.<br />
Glas, Metall, Kunststoffe: In alten<br />
Mülldeponien liegen Tausende Tonnen<br />
wertvoller Materialien.<br />
Großes Potenzial, schwierige Planung<br />
Das UBA schätzt, dass sich in den<br />
vergangenen 50 Jahren r<strong>und</strong> 42 Milliarden<br />
Tonnen in deutschen städtischen<br />
Lagern angesammelt haben.<br />
Zum Vergleich: Im Jahr 2000 wurden<br />
weltweit genauso viele Rohstoffe neu<br />
gewonnen. Mit jährlich 200 Millionen<br />
Tonnen sind Baureste wie Bauschutt,<br />
Straßenaufbruch, Steine <strong>und</strong> Baustellenabfälle<br />
die größte Abfallfraktion.<br />
Urban Mining mag lukrativ <strong>und</strong> nachhaltig<br />
erscheinen, doch noch ist die<br />
Umsetzung schwierig. Die städtischen<br />
„Minen“ zu kennen <strong>und</strong> zu wissen,<br />
wann welche Materialien wieder frei<br />
werden – das ist eine der größten Herausforderungen.<br />
Nicht zuletzt müssen<br />
die wertvollen Materialien richtig gefördert,<br />
getrennt <strong>und</strong> aufbereitet werden.<br />
Um besser zu wissen, welche Materialien<br />
etwa in einem Gebäude verbaut<br />
wurden, schlägt das UBA vor, dass der<br />
Gebäudepass neben dem Energieausweis<br />
auch einen Materialpass haben<br />
soll. Dabei ist die Idee des Materialpasses<br />
nicht neu, er werde jedoch<br />
noch nicht überall eingesetzt.<br />
Die urbane Mine, die jeder hat<br />
Urban Mining mag als Begriff <strong>und</strong><br />
Idee etwas alltagsfremd erscheinen,<br />
dabei haben die meisten von uns mindestens<br />
eine kleine städtische Mine in<br />
den eigenen vier Wänden: ausgediente<br />
Handys <strong>und</strong> Smartphones.<br />
Und die sind wahre Schatztruhen:<br />
Etwa 60 verschiedene Materialien<br />
stecken in jedem Handy, ungefähr die<br />
Hälfte davon sind Metalle wie Gold,<br />
Silber <strong>und</strong> Platin. Das UBA schätzt,<br />
dass 85 Millionen ungenutzte Handys<br />
in den deutschen Schubladen liegen.<br />
Zusammengerechnet ergibt das einen<br />
großen Schatz: Über 21 Tonnen Silber,<br />
zwei Tonnen Gold, 765 Tonnen Kupfer<br />
<strong>und</strong> viele weitere Metalle. Wertvolle<br />
Metalle, die in begrenzten Mengen auf<br />
der Erde verfügbar sind – <strong>und</strong> die unter<br />
teils großen Belastungen für Umwelt<br />
<strong>und</strong> Mensch abgebaut wurden.<br />
Die Minen der Zukunft?<br />
Fest steht: Die Rohstoffe unserer Erde<br />
sind großenteils endlich. Sie zu fördern,<br />
greift empfindlich ins Ökosystem<br />
ein, nicht selten werden dabei<br />
umweltschädliche Substanzen freigesetzt,<br />
es kommt zur Ausbeutung von<br />
Menschen <strong>und</strong> zu kriegerischen Auseinandersetzungen<br />
im Wettbewerb<br />
um die knappen Ressourcen.<br />
Urban Mining nutzt bereits in den<br />
Kreislauf gebrachte Rohstoffe <strong>und</strong><br />
trägt somit dazu bei, die natürlichen<br />
Ressourcen der Erde zu schonen.<br />
Gleichzeitig erlaubt es anderen, weniger<br />
entwickelten Ländern, auf noch<br />
verfügbare Ressourcen zuzugreifen<br />
<strong>und</strong> sich somit weiterzuentwickeln.<br />
Urban Mining kann die Rohstoffversorgung<br />
von morgen sichern, vorausgesetzt<br />
die städtischen Minen werden<br />
systematisch erfasst. Und wir können<br />
schon jetzt selbst zu städtischen „Minenarbeitern“<br />
werden – indem wir unsere<br />
alten Handys aus den Schubladen<br />
holen. f<br />
Im Original erschienen bei<br />
utopia.de.<br />
Ausgabe 9 | Mai 2018 | Umweltdialog.de<br />
41
Bauen <strong>und</strong> Wohnen<br />
Biotope<br />
Kleine<br />
zwischen Wolkenkratzern<br />
<strong>und</strong> Maschinenpark<br />
Außenfassaden, Dächer <strong>und</strong> Gr<strong>und</strong>stücksflächen von Firmen<br />
erweisen sich überraschend oft als kleine Biotopinseln für<br />
Vögel <strong>und</strong> Insekten. Durch gezielte Maßnahmen versuchen<br />
manche Unternehmen, die „wilde“ Natur auf ihrem Firmengelände<br />
zu fördern. Manchmal kommt die Natur aber auch<br />
von allein ins Bankenviertel oder Industriegebiet.<br />
Von Andreas Scholz<br />
Der größte Gegner der Planer des<br />
Bahnprojekts „Stuttgart21“ ist gerade<br />
einmal drei Zentimeter lang, hat sechs<br />
Beine <strong>und</strong> einen ziemlich dicken Kopf.<br />
Die Rede ist vom seltenen <strong>und</strong> daher<br />
geschützten Juchtenkäfer. Einen Dickkopf<br />
hatten auch die, die sich für oder<br />
gegen seine Baum-Zuhause am Stuttgarter<br />
Bahnhof einsetzten. Was folgte,<br />
war eine Geschichte über den normalen<br />
Wahnsinn bei der Planung eines<br />
Großprojekts.<br />
Foto: RWE Power AG<br />
Eine der Lehren aus dem Streit um<br />
den Bau von „Stuttgart21“ ist: Heutzutage<br />
müssen Politiker <strong>und</strong> Firmen mit<br />
gestiegenem Flächenanspruch häufig<br />
für ökologische Ausgleichsmaßnahmen<br />
sorgen. Neben dem starken<br />
Flächenverbrauch sorgt eine weitere<br />
Entwicklung dafür, dass die Lebensräume<br />
für Tiere <strong>und</strong> Pflanzen im 21.<br />
Jahrh<strong>und</strong>ert knapper werden. In einer<br />
monotonen Landwirtschaft finden<br />
Vögel <strong>und</strong> Insekten nämlich immer<br />
42 Ausgabe 9 | Mai 2018 | Umweltdialog.de
Bauen <strong>und</strong> Wohnen<br />
Foto: Rolf Schwarz<br />
weniger Nahrung. Daher ziehen sie auf ihrer Suche nach<br />
Futter immer öfter in unsere Städte – in manchen Regionen<br />
schweben heutzutage teilweise mehr Bienen <strong>und</strong> Insekten<br />
in den urbanen Ballungsgebieten durch die Lüfte als im<br />
ländlichen Raum.<br />
Vor dem Hintergr<strong>und</strong> des Klimawandels <strong>und</strong> des schleichenden<br />
Rückgangs der Artenvielfalt findet aber langsam<br />
ein allgemeines Umdenken statt. Nicht nur kleine Betriebe<br />
auf der grünen Wiese, sondern auch große Industrie- <strong>und</strong><br />
Dienstleistungsunternehmen wollen durch ökologische<br />
Ausgleichsmaßnahmen oder umweltfre<strong>und</strong>liche Betriebsgelände<br />
der Natur etwas zurückgeben.<br />
Schwaben sind Vorreiter<br />
Eine Vorreiterrolle im Umweltschutz nimmt das B<strong>und</strong>esland<br />
Baden-Württemberg ein. Für Firmen aus dem „Ländle“<br />
hat die Landesanstalt für Umwelt, Messungen <strong>und</strong> Naturschutz<br />
Baden-Württemberg (LUBW) schon vor Jahren<br />
einen Leitfaden für ein naturnahes Betriebsgelände entwickelt:<br />
Unternehmen, die im Einklang mit der Natur leben<br />
möchten, erhalten <strong>Tipps</strong>, wie sich naturnahe Außenanlagen<br />
realisieren lassen. Dass eine moderne Gebäudegestaltung<br />
<strong>und</strong> Artenvielfalt sich nicht ausschließen, zeigt etwa<br />
die Unternehmenszentrale von GETRAG in Untergruppenbach<br />
am Fuße der Löwensteiner Berge. Der Antriebsspezialist<br />
GETRAG verschreibt sich bereits seit geraumer Zeit<br />
den <strong>Nachhaltig</strong>keitsgedanken. „Beim Thema <strong>Nachhaltig</strong>keit<br />
sind wir der Überzeugung, dass nur bei einem Gleichgewicht<br />
von Umwelt, Ökonomie <strong>und</strong> Gesellschaft unser<br />
Anspruch erfüllt werden kann“, erklärt Bo Zhang, Specialist<br />
Internal <strong>und</strong> External Communications.<br />
Das GETRAG Gebäude steht mit fast 14.000 Quadratmetern<br />
Gr<strong>und</strong>fläche aufgr<strong>und</strong> der besonderen Geologie auf<br />
550 Pfählen, die aneinandergereiht eine Länge von 5.300<br />
Metern hätten. „Wir haben der Natur Fläche weggenommen,<br />
diese aber in Form von begrünten Dachflächen <strong>und</strong><br />
4.500 Quadratmetern Wasserfläche zurückgegeben <strong>und</strong><br />
damit höchste biologische Vielfalt ermöglicht“, erklärt<br />
Zhang.<br />
Aus der Vogelperspektive sehen die Gründächer aus wie<br />
Wiesen <strong>und</strong> Felder. Der Unternehmenshauptsitz ist eines<br />
der ersten Gebäude weltweit, das in derart hohem Maß Regenwasser<br />
im Sanitärbereich <strong>und</strong> als Löschwasser nutzt.<br />
„Fische, Seerosen sowie viele weitere Tiere <strong>und</strong> Pflanzen<br />
finden r<strong>und</strong> um das Gebäude ein Zuhause“, erläutert<br />
Zhang. Regelmäßig findet für Mitarbeiter am Standort in<br />
Untergruppenbach auch eine <strong>Nachhaltig</strong>keitswoche statt.<br />
Imker aus der Region erklären dann anhand von Bienenschaukästen<br />
am See hinterm hohen Schilf die hohe ökologische<br />
<strong>und</strong> ökonomische Bedeutung der Honigbiene. >><br />
Ausgabe 9 | Mai 2018 | Umweltdialog.de<br />
43
Bauen <strong>und</strong> Wohnen<br />
Dachbegrünung spart Geld<br />
Doch nicht nur auf den Gründächern<br />
von GETRAG in Untergruppenbach<br />
finden Honigbienen, Wildbienen<br />
<strong>und</strong> Schmetterlinge dank Dachpflanzen<br />
wie Mauerpfeffer <strong>und</strong> Co. einen<br />
reich gedeckten Tisch vor. Nur von<br />
der Dachterrasse des Sudhauses in<br />
Schwäbisch Hall wird sichtbar, dass<br />
es auch auf dem Dach der direkt gegenüberliegenden<br />
Kunsthalle Würth<br />
„bunt“ zugeht.<br />
Die Kunsthalle Würth wurde 2001<br />
von dem bekannten Unternehmer<br />
<strong>und</strong> Kunstmäzen Reinhold Würth in<br />
Schwäbisch Hall gegründet. Vordergründig<br />
zur Wärmedämmung angelegt,<br />
entpuppen sich die Salbei- <strong>und</strong><br />
Mauerpfefferkolonien auf dem Dach<br />
der Kunsthalle als wahre Insektenweiden<br />
<strong>und</strong> stehen in ihrer Farbenpracht<br />
den Meisterwerken ein Stockwerk tiefer<br />
in nichts nach.<br />
Der Trend zum Gründach nimmt bei<br />
großen Industrieunternehmen zu.<br />
Denn: mit einem durchdachten Regenwassermanagement<br />
können Firmen<br />
zudem hohe Gebühren für Abwasser<br />
sparen. Gründächer wirken sich<br />
durch ihre wärmedämmenden Fähigkeiten<br />
positiv auf die Energiebilanz<br />
aus. Dass Schmetterlinge <strong>und</strong> Bienen<br />
sich auf den Gründächern wohlfühlen,<br />
ist ein schöner Nebeneffekt.<br />
Auf ein Naturdach setzte auch der<br />
Softwareriese SAP bei der Planung<br />
des Hauses im Park in St. Ingbert. In<br />
Kooperation mit der Firma Optigrün<br />
– einem der international führenden<br />
Anbieter für Dachbegrünung mit Sitz<br />
im schwäbischen Krauchenwies – entstanden<br />
2010 in einem Pionierprojekt<br />
üppige Grünbereiche in luftiger Höhe.<br />
Den Klimawandel <strong>und</strong> die Energiebilanz<br />
stets vor Augen ziehen weitere<br />
Industriebetriebe mit Gründächern<br />
nach.<br />
Foto: Andreas Scholz<br />
Bagger als Brutplatz<br />
Ein Firmengelände kann jedoch nicht<br />
nur Schmetterlingen oder Bienen als<br />
ökologische Nische dienen. Neue Lebensräume<br />
im urbanen Raum hat sich<br />
ebenfalls der Wanderfalke erobert.<br />
Von seinen einstigen Nistplätzen in<br />
Steinbrüchen weicht der Wanderfalke<br />
als Kulturfolger inzwischen auf Hochhäuser,<br />
Kraftwerke, Brückenpfeiler<br />
oder Fernsehtürme als künstliche Ersatzfelsen<br />
aus. Im Tagebau Hambach<br />
der RWE Power AG brütet der Wanderfalke<br />
seit Jahren regelmäßig auf<br />
fahrbaren Baggern!<br />
Auch an der Außenfassade des<br />
Kraftwerks in Gommersdorf hat der<br />
Wanderfalke schon seine Jungen<br />
großgezogen. Die RWE Power AG arbeitet<br />
in Nordrhein-Westfalen eng<br />
mit lokalen Naturschutzgruppen <strong>und</strong><br />
Greifvogelexperten zusammen. Der<br />
Energiedienstleister hat extra eine<br />
Forschungsstelle zur Rekultivierung<br />
von einstigen Braunkohletage<strong>bauen</strong><br />
gegründet. Wo einst die Braunkohlebagger<br />
rollten, um die oft kritisierte<br />
Energieressource zu fördern, gibt es<br />
inzwischen seltene Orchideen <strong>und</strong> Libellen.<br />
Einen ungewöhnlichen Nistplatz<br />
sucht sich seit mehr als zehn Jahren<br />
auch ein Wanderfalkenpärchen in<br />
Frankfurt am Main aus. Auf dem 285<br />
Meter hohen Commerzbank-Tower in<br />
der Bankenmetropole erblicken jedes<br />
Jahr ein paar Jungfalken das Licht der<br />
Welt. Der Finanzdienstleister lässt den<br />
Wanderfalken gewähren <strong>und</strong> sorgt dafür,<br />
dass während der Aufzucht der<br />
Jungen keine Wartungsarbeiten auf<br />
dem Dach durchgeführt werden. Nur<br />
lokale Naturschutzgruppen dürfen in<br />
der Brutphase aufs Dach.<br />
Naturnahe Betriebsgelände sind langfristige<br />
Projekte, bei denen Firmen oft<br />
Hand in Hand mit lokalen Naturschutzorganisationen<br />
sowie Landschaftsarchitekten<br />
<strong>und</strong> -gärtnern zusammenarbeiten.<br />
Der Artenreichtum auf dem<br />
Betriebsgelände nimmt sogar noch zu,<br />
wenn eine Verwilderung teilweise zugelassen<br />
wird. Ein weiteres Kooperationsbeispiel<br />
für gelebten Artenschutz<br />
liefert der Steinbruch der Heidelberg-<br />
Cement AG in Nußloch. Der seltene<br />
Bienenfresser gräbt hier seit mehreren<br />
Jahren wieder seine Brutröhren<br />
in die Abbruchkanten. Während der<br />
Brutzeit des schillernden „Paradiesvogels“<br />
erhält die örtliche NABU-Gruppe<br />
44 Ausgabe 9 | Mai 2018 | Umweltdialog.de
Bauen <strong>und</strong> Wohnen<br />
Weitere Informationen<br />
f SCHWEGLER Vogel- <strong>und</strong> Naturschutzprodukte GmbH<br />
www.schwegler-natur.de<br />
f Bauanleitungen für Vogel-Nistkästen<br />
www.nabu.de/tiere-<strong>und</strong>-pflanzen/voegel/helfen/nistkaesten/<br />
f Bauanleitungen für Insektenhotels<br />
http://www.insekten-hotels.de/bauanleitung.html<br />
f Anleitung zum Bau einer Trockenmauer<br />
www.hausjournal.net/trockenmauer-<strong>bauen</strong><br />
f Optigrün – Gründachspezialist<br />
www.optigruen.de<br />
Foto: Torsten Haag<br />
f Rekultivierung von RWE-Tagebauflächen<br />
www.forschungsstellerekultivierung.de<br />
Foto: Andreas Scholz<br />
Oben links: Salbei- <strong>und</strong><br />
Mauerpfefferkolonien auf dem<br />
Dach der Kunsthalle Würth<br />
Oben rechts: Nistplatz auf dem<br />
Golfplatz<br />
Unten rechts: Anbringung eines<br />
Nistkastens auf dem Golfplatz in<br />
Friedrichsruhe<br />
von HeidelbergCement ein exklusives<br />
Zugangsrecht zum Steinbruch.<br />
Singvögel auf Golfplätzen kein Handicap<br />
Dass ökologische Vielfalt auf gepflegtem<br />
Rasengrün möglich ist, zeigt sich<br />
auch auf dem Golfplatz in Friedrichsruhe.<br />
Die Geschäftsleitung des Golf-<br />
Clubs Heilbronn-Hohenlohe hatte<br />
nichts dagegen, als Jürgen Laucher<br />
zusammen mit seinen Kollegen vom<br />
NABU Öhringen im März 2018 erstmals<br />
Nistkästen auf dem Golfgelände<br />
aufstellte.<br />
Die Idee, das Golfgrün mit Nistkästen<br />
für heimische Singvögel zu bestücken,<br />
kam Jürgen Laucher beim Golfspielen.<br />
„Die Landschaft hier auf dem Golfplatz<br />
in Friedrichsruhe ist sehr vielseitig.<br />
Es gibt viele alte Bäume, mehrere<br />
Seen, offene Flächen <strong>und</strong> kleine<br />
Waldstücke“, erklärt der passionierte<br />
Hobby-Golfer. An den Seen auf dem<br />
Golfplatzgelände hat der Tierarzt im<br />
Ruhestand schon Zwergtaucher <strong>und</strong><br />
Teichrohrsänger entdeckt. Inzwischen<br />
hängen r<strong>und</strong> 60 Nistkästen auf<br />
dem Golfplatzgelände. Jürgen Laucher<br />
hofft, dass er auf seinen ornithologischen<br />
Führungen den Besuchern zukünftig<br />
noch mehr Vogelarten zeigen<br />
kann.<br />
Spannende Vogelbeobachtungen auf<br />
industriellem Terrain sind für Naturschützer<br />
auch in den Fabrikfilialen<br />
von Südzucker im süddeutschen<br />
Raum möglich. Wenn aus Rüben<br />
Zucker gewonnen wird, fällt massig<br />
Wasser an. Das Abwasser reinigt Südzucker<br />
in fabrikeigenen Klärteichen.<br />
Die Klärteiche locken seit vielen Jahren<br />
seltene Vogelarten an. R<strong>und</strong> um<br />
den Klärteich in Offenau bieten regionale<br />
Naturschutzgruppen regelmäßig<br />
ornithologische Führungen an. f<br />
Ausgabe 9 | Mai 2018 | Umweltdialog.de<br />
45
Bauen <strong>und</strong> Wohnen<br />
Fotos: Fabian Stürtz / vdi<br />
Markus Pfeil macht aus Gebäuden<br />
ganzheitliche Energiesparer.<br />
vom Keller<br />
bis zum Dach<br />
Man könnte es fast übersehen:<br />
Das neue Gebäude der<br />
Deutschen B<strong>und</strong>esstiftung<br />
Umwelt (DBU) in Osnabrück gibt<br />
sich auf den ersten Blick zurückhaltend.<br />
Die Form <strong>und</strong> Konturen folgen<br />
einem klaren Konzept. Ziel, Sinn <strong>und</strong><br />
Zweck sind ein sparsamerer Umgang<br />
mit Ressourcen <strong>und</strong> Energie. Hinter<br />
dem Energiekonzept des Projekts<br />
steckt der Ingenieur Markus Pfeil.<br />
Mit seinem Ingenieurbüro entwickelt<br />
er ganzheitliche Energielösungen für<br />
Bauten jeder Art. Das Ergebnis seiner<br />
Arbeit in Osnabrück: Mit 15 KWh/m2<br />
(das entspricht 1,5 Liter Heizöl) wird<br />
nur noch ein Bruchteil der Heizenergie<br />
vergleichbarer Gebäude benötigt.<br />
Dank einer Reihe weiterer Maßnahmen<br />
wird sogar mehr Energie erzeugt<br />
als selbst verbraucht. Das Prinzip<br />
nennt sich Plusenergiehaus.<br />
Hausgemachte Klimatechnik<br />
Es gehört zum Selbstverständnis<br />
einer Umweltorganisation wie der<br />
DBU, selbst mit gutem Beispiel voranzugehen.<br />
Entsprechend entwickelte<br />
Markus Pfeil das Energiekonzept mit<br />
einem hohen ökologischen Anspruch.<br />
Das beginnt bei der vorbildlichen Nutzung<br />
von Baumaterialien wie Holz für<br />
die Rahmenkonstruktion <strong>und</strong> recycelbarem<br />
Hanf für die Wärmedämmung.<br />
Große Fensterflächen mit regelbarem<br />
Licht- <strong>und</strong> Wärmeeintrag sorgen für<br />
viel Tageslicht <strong>und</strong> vermeiden Überhitzungen.<br />
Deckenstrahlplatten regeln<br />
ganzjährlich die Temperatur:<br />
Sie kühlen im Sommer <strong>und</strong> heizen im<br />
Winter. Ein hocheffizientes Blockheizkraftwerk<br />
liefert die Wärme <strong>und</strong> eine<br />
große Fotovoltaikanlage auf dem Dach<br />
liefert zusätzlich Strom. Energiezukunft<br />
an allen Ecken <strong>und</strong> Enden.<br />
„Spielen war für mich immer mit<br />
Technik verb<strong>und</strong>en.“<br />
Die Begeisterung für Technik reicht<br />
bei Markus Pfeil weit zurück: „Bauen,<br />
Löten <strong>und</strong> Schweißen wurden mir<br />
quasi in die Wiege gelegt”. Als Sohn<br />
eines Mechanikers hatte er von Kindesbeinen<br />
an Kontakt zu Technik <strong>und</strong><br />
schraubte bereits mit zehn Jahren am<br />
ersten eigenen Auto herum. „An meinem<br />
Vater ist auf jeden Fall ein Ingenieur<br />
verloren gegangen”, sagt Markus<br />
Pfeil. Für den Sohn war der Weg<br />
zum Maschinenbaustudium vorgezeichnet.<br />
Doch im Studium stellte sich<br />
schnell heraus, dass seine eigentliche<br />
Liebe der Energietechnik galt. Gerade<br />
die Fotovoltaik war Mitte der 1990er<br />
ein neues, spannendes <strong>und</strong> gleichzeitig<br />
wichtiges Feld. Aus der Berufung<br />
wurde bald ein Beruf <strong>und</strong> schließlich<br />
ein eigenes Ingenieurbüro, das er mit<br />
seinem Kollegen Holger Koch 1997<br />
gründete. „Es geht um ganzheitliche<br />
Energiekonzepte: von der energieeffizienten<br />
Gebäudehülle bis zu innovativen<br />
Techniken wie Geothermie, Biomasse<br />
<strong>und</strong> Solarenergie”, sagt Markus<br />
Pfeil.<br />
Das Thema spielt inzwischen auch in<br />
seinem Leben eine ganzheitliche Rolle.<br />
Als Professor der Münster School<br />
of Architecture vermittelt er angehenden<br />
Architekten sein Wissen. Zudem<br />
plant <strong>und</strong> baut er für seine Familie<br />
<strong>und</strong> zusammen mit 13 weiteren Familien<br />
in Köln zwei Mehrfamilienhäuser<br />
nach neuesten energetischen, ökologischen<br />
<strong>und</strong> sozialen Gesichtspunkten.<br />
Markus Pfeil gönnt sich nur ein<br />
Hobby, das sich nicht an neuesten Klimastandards<br />
orientiert, das er dafür<br />
aber umso nachhaltiger pflegt. In seiner<br />
Freizeit schraubt er mit viel Leidenschaft<br />
an seinem Mercedes Benz,<br />
Baujahr 1966, den er seit über 25 Jahren<br />
straßentauglich hält. f<br />
Aus Ingenieurgeschichten des VDI<br />
46 Ausgabe 9 | Mai 2018 | Umweltdialog.de
Natur<br />
am<br />
Arbeitsplatz<br />
Wenn Büros<br />
glücklich machen<br />
Von Jennifer Nicolay<br />
Wenn es um die Schönheit der Natur geht, brauchen wir<br />
sie alle. Die sinnliche Erfahrung von Ästhetik in der Natur<br />
mindert nachweislich Stress <strong>und</strong> regt die Fantasie an. Das<br />
kann man auch im Stadtleben <strong>und</strong> in modernen Büro-Innenräumen<br />
nutzen: Mit dem sogenannten Biophilic Design<br />
bringt der Hersteller modularer Bodenbeläge Interface die<br />
Natur ganz bewusst zurück an den Arbeitsplatz. Das sorgt<br />
für mehr Ges<strong>und</strong>heit, Wohlbefinden <strong>und</strong> Kreativität.<br />
Fragt man Menschen danach, wo sie sich am zufriedensten,<br />
am kreativsten <strong>und</strong> am produktivsten fühlen, wird kaum<br />
jemand antworten: im Büro. Vielmehr wird man Antworten<br />
bekommen wie: an einem See, mit dem Blick aufs Meer<br />
oder zu Hause im Garten. In natürlicher Umgebung fühlen<br />
Menschen sich nachweislich wohler. Doch unser Alltag<br />
sieht bekanntlich anders aus, <strong>und</strong> so wird der direkte<br />
Kontakt zur Natur oftmals zu einer unerfüllten Sehnsucht.<br />
Das ist das Ergebnis des „Human Spaces Reports“ von Interface,<br />
der unter der Leitung des Organisationspsychologen<br />
Professor Sir Cary Cooper entstanden ist. Darin wurden<br />
7.600 Büroangestellte aus 16 Ländern befragt, welche<br />
Wirkung die Büroumgebung auf ihr Wohlbefinden hat. Die<br />
Ergebnisse: Viele Angestellte werden krank, leiden >><br />
Foto: Interface<br />
47
Bauen <strong>und</strong> Wohnen<br />
an Depressionen oder Unkonzentriertheit, wenn sie sich<br />
überwiegend in einer Umgebung ohne jeglichen Naturbezug<br />
aufhalten.<br />
In Deutschland arbeiten nach Angaben des Reports 84 Prozent<br />
der Menschen in einer städtischen Umgebung. Die allermeiste<br />
Arbeitszeit verbringen wir in Innenräumen. Und<br />
das oft ohne Bezug zur Natur: 43 Prozent der Deutschen<br />
sollen laut Human Spaces Report keine Grünbepflanzung<br />
am Arbeitsplatz haben, 41 Prozent nicht einmal natürliches<br />
Tageslicht. Das Potenzial für Veränderungen zugunsten<br />
von Ges<strong>und</strong>heit, Wohlbefinden <strong>und</strong> Produktivität ist<br />
entsprechend hoch. Bereits kleine Veränderungen wie das<br />
Aufstellen von Pflanzen oder der Blick ins Grüne können<br />
nämlich den Stresslevel signifikant senken. Da lag es für<br />
Interface nahe, genau an dieser Stelle innovative Lösungen<br />
zu entwickeln <strong>und</strong> anzubieten. Der gewählte Ansatz beruht<br />
auf der Theorie der Biophilie.<br />
Was genau ist Biophilie?<br />
„Biophilie ist das angeborene, biologisch bedingte, menschliche<br />
Bedürfnis nach Kontakt mit der Natur.“ Das Zitat<br />
stammt von der Unternehmensberatung Terrapin Bright<br />
Green. Den theoretischen Hintergr<strong>und</strong> dazu liefert der<br />
deutsch-amerikanische Psychoanalytiker <strong>und</strong> Philosoph<br />
Erich Fromm, der die Biophilie in den 1960er Jahren als<br />
dem Menschen innewohnende Eigenschaft definierte.<br />
Auch der Biologe E. O. Wilson baute eine Theory of Biophilia<br />
auf, die davon ausgeht, dass die Verbindung zur Natur<br />
ein menschliches Bedürfnis ist <strong>und</strong> sich positiv auf Wohlbefinden,<br />
Produktivität <strong>und</strong> Beziehungen auswirkt.<br />
Im Laufe der letzten Jahre entwickelten sich auf dieser Basis<br />
praxisnahe Architektur- <strong>und</strong> Design-Ansätze: Biophilic<br />
Design findet dabei nicht nur in Innenräumen, sondern<br />
auch bei der Entwicklung ganzer Smart Cities Anwendung.<br />
Dahinter steht mehr, als einige Grünflächen auf Häusern<br />
<strong>und</strong> in Parks zu integrieren oder ein paar Zimmerpflanzen<br />
ins Büro zu stellen. Es spricht ein Urbedürfnis <strong>und</strong> evolutionäres<br />
Erbe an, das den Menschen in Beziehung zur Natur<br />
setzt. Dadurch wird die Natur besonders wertgeschätzt. Das<br />
Foto: Interface<br />
Design-Konzept bedient sich dazu verschiedener Wahrnehmungsmuster,<br />
die Menschen als positiv, beruhigend oder<br />
anregend empfinden.<br />
Woran orientiert sich das Biophilic Design?<br />
Auch bei Interface nutzt man die Erkenntnisse von Biophilic<br />
Design, <strong>und</strong> hierbei insbesondere die „14 Patterns<br />
of Biophilic Design“, die Terrapin Bright Green 2014 vorstellte.<br />
Diese Muster gliedern sich in drei Kategorien: Die<br />
erste Kategorie greift direkt die Natur im Raum auf, also<br />
beispielsweise die Sicht auf Pflanzen oder das Vorhandensein<br />
von Wasser. Auch natürliches Licht, Verbindungen zu<br />
Terrassen <strong>und</strong> Innenhöfen oder kinetische bzw. bewegliche<br />
Wandelemente gehören in die Kategorie der Natur im<br />
Raum.<br />
Die zweite Kategorie greift Analogien zur Natur auf. Das<br />
sind in der Regel nicht-organische <strong>und</strong> indirekte Anklänge<br />
an die Natur, etwa Farben <strong>und</strong> biomorphe Formen oder<br />
auch Bodenstrukturen <strong>und</strong> symbolische Anspielungen auf<br />
bestimmte Muster, die man in der Natur vorfindet.<br />
Die dritte Kategorie ist etwas abstrakter. Sie betrifft die<br />
Charakteristik des Raumes. Dabei greift man das Bedürfnis<br />
nach Überblick oder Rückzug auf, spielt aber auch mit<br />
der Sensation, von einem Geheimnis überrascht zu werden<br />
oder ein Risiko einzugehen. Dadurch wird die Fantasie angeregt<br />
<strong>und</strong> kreatives Potenzial kann sich entfalten. In der<br />
Raumgestaltung fallen etwa Balkone, höher liegende Ge-<br />
48 Ausgabe 9 | Mai 2018 | Umweltdialog.de
Bauen <strong>und</strong> Wohnen<br />
bäudeteile mit durchsichtigen Geländern oder Bodenplatten<br />
in das Wahrnehmungsmuster Risiko. Auditive Reize<br />
wie Musik aus einer nicht wahrnehmbaren Quelle erleben<br />
wir als geheimnisvoll.<br />
Wie setzt Interface das Biophilic Design um?<br />
Um die Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> das Wohlbefinden am Arbeitsplatz<br />
<strong>und</strong> in der Lebenswelt zu steigern, setzt Interface gezielt<br />
Biophilic Design bei seinen K<strong>und</strong>en in der Praxis ein. „We<br />
make carpet tile, but we sell design“, lautet ein Slogan des<br />
Unternehmens, der sofort spürbar ist, wenn man entsprechend<br />
gestaltete Räume betritt. Die modularen Bodenbelagslösungen<br />
mit ihren verschiedenen Mustern, Texturen<br />
<strong>und</strong> Farben sind dabei Teil eines umfassenderen Innenraumdesigns,<br />
das zum Verweilen, zur Rekreation <strong>und</strong> Kreation<br />
einlädt.<br />
Im Mai letzten Jahres hat Interface dazu die Kollektion Global<br />
Change vorgestellt, die das biophile Design besonders<br />
interpretiert: „Global Change wurde von den Übergängen<br />
in der Natur inspiriert. Mit organischen Mustern <strong>und</strong> linearen<br />
Strukturen verknüpft diese Kollektion Menschen<br />
mit der Erde, den Morgen mit dem Abend <strong>und</strong> die Nacht<br />
mit dem Tag“, informiert die Unternehmenshomepage. Die<br />
Global-Change-Produkte sind speziell dafür ausgelegt, miteinander<br />
kombiniert zu werden, <strong>und</strong> bieten so eine große<br />
Bandbreite an sinnlichen <strong>und</strong> visuellen Erfahrungen.<br />
Für Global Change verwendet Interface darüber hinaus umweltfre<strong>und</strong>liches<br />
Solution-Dyed-Polyamid, was die Produkte<br />
besonders nachhaltig macht: „Als eine unserer umweltfre<strong>und</strong>lichsten<br />
Kollektionen unterstützt sie unser Ziel, ein<br />
lebensfähiges Klima zu schaffen, <strong>und</strong> bringt uns letztlich<br />
einen wichtigen Schritt weiter auf unserer Climate Take<br />
Back-Mission.“<br />
Foto: Interface<br />
Interface selbst setzt beispielsweise das Biophile Design<br />
in seinem deutschen Hauptstandort im Krefelder Mies van<br />
der Rohe Business Park um. Dort haben die Concept Designer<br />
verschiedene Bodenbelagstexturen verwendet, um eine<br />
besondere Haptik unter den Fußsohlen zu erzeugen. Hochflorige<br />
Teppichfasern wechseln sich mit kürzeren Fasern<br />
ab <strong>und</strong> ahmen einen natürlichen Untergr<strong>und</strong> nach. Die geradlinige<br />
Architektur wird durch organische Formen der<br />
Möbel <strong>und</strong> Lampen aufgebrochen, ein Wasserfall sorgt für<br />
ein angenehmes Raumklima. In der Raumaufteilung gibt<br />
es Überblickspunkte <strong>und</strong> sichtgeschützte Bereiche, die als<br />
Rückzugsort dienen.<br />
Der Standort ist so konzipiert, dass sich die Mitarbeiter in<br />
Krefeld wie zu Hause fühlen. Dabei können sie selbst flexibel<br />
entscheiden, ob ihnen nach Kommunikation, nach entspanntem<br />
Arbeiten oder fokussierter Konzentration ist. Die<br />
durch die unterschiedliche Gestaltung der einzelnen Räume<br />
<strong>und</strong> Einheiten entstandene Heterogenität im Gesamtbild<br />
ist gewollt: „Interface ist nicht einfarbig, nicht regelmäßig,<br />
nicht berechenbar <strong>und</strong> nicht langweilig – genauso<br />
wie wir dies aus unserer natürlichen Umgebung kennen.“<br />
Die positiven Effekte, die das Raumdesign auf die Mitarbeiter<br />
hat, werden aktuell ausgewertet. f<br />
Biophilic Design in Krefeld<br />
Ausgabe 9 | Mai 2018 | Umweltdialog.de<br />
49
Zum Wandel<br />
des Wohnens<br />
Von Christine Hannemann
Foto: Monkey Business / stock.adobe.com<br />
Privatheit, eine enorme<br />
technische Ausstattung<br />
<strong>und</strong> die Infrastrukturanbindung<br />
an Zentralheizung,<br />
Kanalisation oder<br />
den öffentlichen Nahverkehr<br />
kennzeichnen unser<br />
heutiges Wohnen. Wir geben<br />
eine Menge Geld aus,<br />
um den Wert der Wohnausstattung<br />
zu steigern<br />
<strong>und</strong> mehr Platz zu haben.<br />
Demgegenüber schrumpft<br />
das, was in der Wohnung<br />
zwingend erledigt werden<br />
muss. Aber warum<br />
wird dennoch in unserem<br />
Kulturkreis an der eigenen<br />
Wohnung festgehalten?<br />
Wohnen gehört zu den elementaren<br />
Bedürfnissen des<br />
Menschen <strong>und</strong> weckt Assoziationen<br />
wie Sicherheit, Schutz,<br />
Geborgenheit, Kontakt, Kommunikation<br />
<strong>und</strong> Selbstdarstellung. Gleichzeitig<br />
ist das Wohnen einem ständigen<br />
Wandel unterworfen <strong>und</strong> weist sehr<br />
unterschiedliche Ausprägungen auf,<br />
regional, sozial, individuell. Wie die<br />
Gr<strong>und</strong>bedürfnisse befriedigt werden,<br />
verändert sich im historischen Maßstab<br />
ebenso wie für jeden Menschen<br />
im Laufe seines Lebenszyklus. Die<br />
Wohnung stellt für die meisten Haushalte<br />
den Lebensmittelpunkt dar. Sie<br />
beeinflusst den Alltag von Familien,<br />
die individuellen Entfaltungsmöglichkeiten,<br />
die Sozialisationschancen von<br />
Kindern, Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> Wohlbefinden.<br />
Die Wohnung bestimmt, wie Intimität<br />
<strong>und</strong> Privatsphäre geschützt werden.<br />
Wohnen bedeutet mehr als nur Unterkunft,<br />
sie ist auch Ort <strong>und</strong> Medium der<br />
Selbstdarstellung <strong>und</strong> der Repräsentation.<br />
Im Wohnen manifestiert sich<br />
der soziale Status. Lage <strong>und</strong> Standort<br />
(Viertel, Straße), Wohnform (Villa,<br />
Mietshaus), Wohnumfeld sowie Architektur<br />
haben während der gesamten<br />
Wohnungsbaugeschichte immer<br />
auch die gesellschaftliche Stellung<br />
der Bewohner abgebildet. Das Bürgertum<br />
im 19. Jahrh<strong>und</strong>ert residierte in<br />
Landhäusern <strong>und</strong> Villen oder bewohnte<br />
die „Belle Etage“ der Bürgerhäuser.<br />
Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde<br />
das Eigenheim neben dem Auto zum<br />
wichtigen Statussymbol. Dagegen bedeutet<br />
der Verlust der Wohnung – die<br />
Wohnungslosigkeit – einen starken<br />
sozialen Abstieg <strong>und</strong> tendenziell eine<br />
Ausgrenzung aus der Gesellschaft.<br />
Idealtypus des modernen Wohnens<br />
Unsere heutige Vorstellung vom<br />
Wohnen hat sich wesentlich erst mit<br />
der Urbanisierung <strong>und</strong> Industrialisierung,<br />
also seit der Entstehung der Moderne,<br />
herausgebildet. Sie wird durch<br />
fünf Merkmale charakterisiert, die<br />
den Massenwohnungsbau zumindest<br />
bis in die 1970er Jahre beschrei- >><br />
Ausgabe 9 | Mai 2018 | Umweltdialog.de<br />
51
Bauen <strong>und</strong> Wohnen<br />
ben. Diese Merkmale erklären, warum<br />
sich heute das Wohnen in einer Wohnung<br />
mit hierarchisch-funktionell angeordneten<br />
Räumen – Wohnzimmer,<br />
Schlafzimmer, Kinderzimmer, Küche,<br />
Bad, Flur – als „Wohnleitbild“ stark<br />
verfestigt hat.<br />
Zu den idealtypischen Kennzeichen<br />
zählen:<br />
f Trennung von Arbeiten <strong>und</strong> Wohnen:<br />
Wohnen als Ort der „Nichtarbeit"<br />
f Begrenzung von Personen: Wohnen<br />
als Lebensform der Kleinfamilie<br />
f Auseinandertreten von Öffentlichkeit<br />
<strong>und</strong> Privatheit – Wohnen als Ort der<br />
Intimität<br />
f Entstehung des Wohnungsmarkts –<br />
Wohnung als Ware<br />
f Einfluss technischer Entwicklungen<br />
– Wohnen als Ort der Technisierung<br />
Postmoderne Transformation der<br />
Lebensverhältnisse<br />
Waren Sozialer Wohnungsbau <strong>und</strong><br />
technische Normierungen kennzeichnend<br />
für die Entwicklungen in der<br />
zweiten Hälfte des 20. Jahrh<strong>und</strong>erts,<br />
wandelt sich das Wohnen heute vor allem<br />
durch die postmoderne Transformation<br />
aller Lebensverhältnisse, insbesondere<br />
durch Individualisierung,<br />
Alterung sowie Entgrenzung <strong>und</strong> Subjektivierung<br />
der Erwerbsarbeit.<br />
Individualisierung<br />
Individualisierung meint einen mit<br />
der Industrialisierung <strong>und</strong> Modernisierung<br />
der westlichen Gesellschaften<br />
einhergehenden Übergangsprozess<br />
des Individuums von der Fremd- zur<br />
Selbstbestimmung. In der gegenwärtigen<br />
postmodernen Gesellschaft prägt<br />
eine qualitativ neue Radikalität diesen<br />
Prozess. Gesellschaftliche Gr<strong>und</strong>muster,<br />
wie die klassische Kernfamilie,<br />
zerfallen. Der zunehmende Zwang<br />
zur reflexiven Lebensführung bewirkt<br />
die Pluralisierung von Lebensstilen,<br />
<strong>und</strong> Identitäts- <strong>und</strong> Sinnfindung werden<br />
zur individuellen Leistung. Für<br />
das Wohnen relevant ist dabei vor<br />
allem die Singularisierung als freiwillige<br />
oder unfreiwillige Form des<br />
Alleinwohnens <strong>und</strong> der Schrumpfung<br />
der Haushaltsgrößen. Gerade die mit<br />
dem Alleinwohnen verb<strong>und</strong>enen<br />
Verhaltensweisen <strong>und</strong> Bedürfnisse<br />
verändern die Infrastruktur in den<br />
Innenstädten: Außerhäusliche Einrichtungen<br />
wie Cafés <strong>und</strong> Imbissmöglichkeiten<br />
bestimmen zunehmend die<br />
öffentlich sichtbare Infrastruktur in<br />
den Stadtteilen. Dies gilt gleichermaßen<br />
für Angebote von Dienstleistungen<br />
<strong>und</strong> Kommunikation aller Art.<br />
Alterung<br />
Ein immer größerer Anteil von Menschen<br />
wohnt im Alter allein. Dies betrifft<br />
insbesondere Frauen, die in Privatwohnungen<br />
leben, resultierend aus<br />
der nach wie vor längeren Lebenserwartung<br />
von Frauen <strong>und</strong> dem immer<br />
stärker <strong>und</strong> besser zu realisierenden<br />
Wunsch, länger in den eigenen vier<br />
Wänden zu bleiben. Vor allem aber<br />
bleiben „die Alten“ auch länger „jung“,<br />
aktiv <strong>und</strong> vital. Traditionelle Altenheime<br />
entsprechen nicht dem vorherrschenden<br />
Wunsch nach Erhaltung der<br />
gewohnten, selbstständigen Lebensführung.<br />
Neue Modelle sind hier etwa<br />
die Alten-Wohngemeinschaft <strong>und</strong> das<br />
Mehrgenerationenhaus.<br />
Entgrenzung <strong>und</strong> Subjektivierung<br />
der Arbeit<br />
Besonders einschneidend <strong>und</strong> für<br />
Stadtentwicklung <strong>und</strong> Veränderung<br />
der Ansprüche an das Wohnen besonders<br />
relevant ist die zeitliche Entgrenzung<br />
von Arbeit. Arbeitszeiten<br />
sind immer weniger an Tages- <strong>und</strong><br />
Nachtzeiten geb<strong>und</strong>en, wie beispielsweise<br />
bei der Schichtarbeit. Diese<br />
zeitliche Entgrenzung wird flankiert<br />
durch die räumliche: Flexible Arbeitsmodelle<br />
wie das Arbeiten am heimischen<br />
Schreibtisch oder außerhalb<br />
des Büros werden immer mehr zum<br />
Normalfall der Erwerbstätigkeit. Für<br />
die Lebensverhältnisse dramatisch ist<br />
vor allem die rechtliche Entgrenzung<br />
von Arbeit. Hier wird auch von Deregulierung<br />
gesprochen. Indikatoren<br />
für diese Wertung sind das vermehrte<br />
Aufkommen von Zeit- <strong>und</strong> Leiharbeit,<br />
von befristeten Verträgen <strong>und</strong> einem<br />
verringerten Kündigungsschutz.<br />
Von „Subjektivierung“ wird gesprochen,<br />
weil die Forschung eine Intensivierung<br />
von „individuellen“, das heißt<br />
persönlich involvierten Wechselverhältnissen<br />
zwischen Mensch <strong>und</strong><br />
Betrieb beziehungsweise betrieblich<br />
organisierten Arbeitsprozessen konstatiert.<br />
Gemeinsam ist diesen Entwicklungen,<br />
dass Entgrenzung <strong>und</strong><br />
Subjektivierung die systematische<br />
Ausdünnung zur Folge hat. So sind<br />
beispielsweise Tarifverträge für immer<br />
weniger Erwerbstätige relevant,<br />
immer mehr arbeiten in temporären<br />
Arbeitsverhältnissen, in Praktika oder<br />
in Projekten. Des Weiteren bedeuten<br />
Entgrenzung <strong>und</strong> Subjektivierung<br />
52 Ausgabe 9 | Mai 2018 | Umweltdialog.de
Bauen <strong>und</strong> Wohnen<br />
auch, dass sich die Strukturen von<br />
Arbeit dynamisieren: Beispielsweise<br />
wird räumliche Flexibilität immer notwendiger.<br />
Damit verändern sich auch<br />
die Anforderungen an das Wohnen<br />
<strong>und</strong> die Lage, Größe <strong>und</strong> Ausstattung<br />
der Wohnungen. Schon 2020 wird<br />
nur noch die Hälfte der Angestellten<br />
in Deutschland vorwiegend im Büro<br />
sitzen.<br />
Foto: Halfpoint / stock.adobe.com<br />
Wie das Wohnen die Stadt verändert<br />
Angesichts der Individualisierung bekommt<br />
die Wohnfunktion in der Stadt<br />
eine neue Bedeutung als Reurbanisierung.<br />
War lange Zeit die Suburbanisierung der bestimmende<br />
Trend des Wohnens, wird heute wieder das Wohnen<br />
in den Städten zum bevorzugten Ziel verschiedenster <strong>und</strong><br />
disparater „Nutzergruppen“. Über die tatsächliche Renaissance<br />
der Stadt wird in der Fachwelt zwar heftig gestritten,<br />
unübersehbar aber sind die Veränderungen in innerstädtischen<br />
Wohngebieten: Wohnstandorte, die früher – pauschal<br />
gesprochen – hauptsächlich von sozial Schwachen,<br />
verschiedene Ethnien mit Migrationshintergr<strong>und</strong> eingeschlossen,<br />
bewohnt wurden, prägen heute junge Familien,<br />
Edelurbaniten, Baugemeinschaften, Studierende <strong>und</strong> Jungakademiker<br />
sowie Senioren- <strong>und</strong> andere Residenzen innerstädtische<br />
Wohnmilieus. Die Struktur der Stadtbewohner<br />
wird älter <strong>und</strong> sichtlich bunter: Veränderte Lebensstile bedingen<br />
Wohnformen jenseits der klassischen abgeschlossenen<br />
Kleinwohnung mit Wohn-, Schlaf- <strong>und</strong> Kinderzimmer.<br />
Darüber hinaus wird Multilokalität für immer mehr Menschen<br />
zur sozialen Praxis, insbesondere für Berufstätige.<br />
Mobilität ist ein Schlüsselerfordernis gegenwärtiger<br />
gesellschaftlicher Verhältnisse, fast zwangsläufig eine<br />
Gr<strong>und</strong>bedingung der Erwerbsarbeit. Eine spezifische Form<br />
des Mobilseins, die sich auch als Spannungsfeld zwischen<br />
Mobilität <strong>und</strong> Sesshaftigkeit konstituiert, ist das multilokale<br />
Wohnen, also die Organisation des Lebensalltags über<br />
zwei oder mehr Wohnstandorte hinweg. Multilokalität<br />
hat inzwischen einen solchen Umfang <strong>und</strong> solche Spezifik<br />
erlangt, dass in der sozialräumlichen Forschung diese<br />
soziale Praxis der Lebensführung „gleichberechtigt neben<br />
Migration <strong>und</strong> Zirkulation“ gestellt wird. Wohnen kann<br />
sich sogar auf „Übernachten“, auf die reine Behälterfunktion,<br />
reduzieren: Soziale Einbindung, gar nachbarschaftliches<br />
Engagement oder kulturelle Inwertsetzung werden<br />
nicht am – zeitlich gesehen – „Meistwohnort“ realisiert,<br />
sondern nur am Ort des zeitlich weniger genutzten Hauptwohnsitzes.<br />
Zwar bleibt die Angewiesenheit auf die Containerfunktion<br />
der Wohnung als gr<strong>und</strong>legende Existenzform des Menschen<br />
konstant, aber ihr jeweiliger lokaler Stellenwert<br />
verschiebt sich, wird hybrider: Temporäre Wohnformen<br />
jeder Art werden ubiquitärer. Gerade mit den Mitteln von<br />
modernen Kommunikationstechnologien kann das Heimischsein<br />
zu Orten hergestellt, erhalten, aber auch konstituiert<br />
werden, die nicht auf den aktuellen Wohnsitz bezogen<br />
sind. f<br />
Gekürzte Fassung des Essays<br />
„Zum Wandel des Wohnens“, im<br />
Original erschienen in der APuZ<br />
„Wohnen“ von 2014.<br />
Ausgabe 9 | Mai 2018 | Umweltdialog.de<br />
53
Bauen <strong>und</strong> Wohnen<br />
Collaborative Living<br />
Architektur eines<br />
neuen Lebenskonzepts<br />
Die Sharing Economy brachte in den letzten Jahren die herrschende Ordnung in immer mehr<br />
Lebens- <strong>und</strong> Wirtschaftsbereichen vollständig durcheinander. Die Kernidee hinter den Konzepten<br />
von Airbnb, Uber <strong>und</strong> car2go: Zugang <strong>und</strong> Nutzung sind wichtiger als Eigentum. Lässt<br />
sich dieses Prinzip auch auf unsere Wohnkultur übertragen? Eine Frage wie diese stellt sich<br />
angesichts der Urbanisierung <strong>und</strong> des demografischen <strong>und</strong> gesellschaftlichen Wandels umso<br />
drängender, da die Städte immer größer bzw. voller werden <strong>und</strong> sich gleichzeitig die Art, wie die<br />
Menschen wohnen, verändert.<br />
Von Caspar Schmitz-Morkramer<br />
Die Herausforderungen, vor denen Städte in Zukunft stehen,<br />
sind klar: Bezahlbarer Wohnraum ist ebenso gefragt<br />
wie lebenswerte Städte mit Rückzugsorten, Grünflächen<br />
<strong>und</strong> Freiräumen. Eines der kommenden Konzepte, die darauf<br />
eine Antwort geben, sind Micro-Apartments. Ist „Collaborative<br />
Living“ ein weiterer Teil der Lösungsstrategie<br />
auf dem Weg zu lebenswerteren Städten? Wie müssen architektonische<br />
Konzepte aussehen, die sich für diese neue<br />
Idee des geteilten Wohnens eignen?<br />
Das Prinzip der Schnittstelle: So funktioniert die<br />
Sharing Economy<br />
Um diese Fragen zu beantworten, ist es zunächst wichtig zu<br />
verstehen, wie die Sharing Economy funktioniert. Das Faszinierende<br />
an den neuen Sharing-Konzepten ist, dass die<br />
dahinter stehenden Unternehmen im Verhältnis zu ihrer<br />
Reichweite sehr klein sind. Über Airbnb werden beispielsweise<br />
weltweit über 1,5 Millionen Wohnungen angeboten.<br />
Airbnb selbst zählt aber gerade einmal 600 Mitarbeiter.<br />
Foto: Amanda Dahms<br />
Der Gr<strong>und</strong> für dieses ungleiche Verhältnis zwischen Reichweite<br />
<strong>und</strong> Unternehmensgröße liegt am Prinzip, das hinter<br />
54 Ausgabe 9 | Mai 2018 | Umweltdialog.de
Bauen <strong>und</strong> Wohnen<br />
der Sharing Economy steckt. Sie beruht<br />
auf dem Prinzip der Schnittstelle.<br />
Über diese Schnittstellen in Form<br />
von Homepages oder Apps werden<br />
Wohnungen, Mitfahrgelegenheiten,<br />
Autos etc. vermittelt. Im Falle von<br />
Airbnb betreibt das Start-up lediglich<br />
die Plattform, über die sich jeder kostenlos<br />
anmelden <strong>und</strong> sein Haus, seine<br />
Wohnung oder einen Teil davon zur<br />
Vermietung anbieten kann.<br />
Kann man Wohnen auslagern?<br />
Wenn es allerdings um das Wohnen<br />
geht, ist die Sache nicht ganz so einfach<br />
wie im Fall von Uber oder Airbnb.<br />
Insbesondere mir als Architekten<br />
stellen sich Fragen, die das gängige<br />
Weltbild von traditioneller Wohnarchitektur<br />
auf den Kopf stellen: Wie<br />
ist es praktisch umsetzbar, in der eigenen<br />
Wohnung keine Küche mehr<br />
zu haben? Wird dann nur ab <strong>und</strong> zu<br />
eine gemeinschaftlich nutzbare Küche<br />
verwendet? Schon diese erste Überlegung<br />
stößt in der Praxis auf erhebliche<br />
Schwierigkeiten. Wenn bestimmte<br />
Wohnbereiche eingespart <strong>und</strong> dazu<br />
aus den eigenen vier Wänden ausgelagert<br />
werden sollen, wird der vorhandene<br />
Wohnraum nicht automatisch<br />
kleiner oder günstiger.<br />
Sprich: Der große Teil des Bestands<br />
an Wohnungen in den Städten ist entsprechend<br />
für solche strukturellen<br />
Veränderungen der Wohnkultur nur<br />
bedingt geeignet. Meiner Überzeugung<br />
nach wird es darum in Zukunft<br />
eine steigende Nachfrage nach neuen<br />
architektonischen Entwürfen geben,<br />
die sich besser für Collaborative<br />
Living eignen. Im Zentrum wird es darum<br />
gehen, die Frage zu beantworten:<br />
Wie sehen solche architektonischen<br />
Modelle aus, die einer Sharing Economy<br />
entgegenkommen?<br />
Inbegriff für Mobilität: Der Container<br />
als Lebens- <strong>und</strong> Wohnraum<br />
Seit den 1920er Jahren gab es immer<br />
wieder Versuche, modulare Bauweisen<br />
zu erproben <strong>und</strong> dafür standardisierte<br />
Bauteile zu entwickeln, die<br />
beliebig je nach Bedarf kombiniert<br />
werden können. Das Prinzip des Teilens<br />
<strong>und</strong> temporären Nutzens ist mit<br />
so einer Vorstellung durchaus kompatibel.<br />
Einer der am erfolgreichsten<br />
standardisierten, modularen Gegenstände<br />
ist der Container.<br />
Der Container ist eine Erfindung der<br />
globalisierten Welt, die seit dem Ausbau<br />
des Eisenbahnschienennetzes<br />
immer mehr zusammenwuchs. Der<br />
Container ist der Inbegriff für Mobilität<br />
<strong>und</strong> Globalisierung. Der internationale<br />
Frachtverkehr machte es im 20.<br />
Jahrh<strong>und</strong>ert notwendig, sich auf einen<br />
standardisierten Transportbehälter zu<br />
verständigen. 1956 wurde erstmals<br />
ein solcher internationaler Standard<br />
für den Frachtverkehr auf LKWs <strong>und</strong><br />
Schiffen festgelegt. Seit den 1970er<br />
Jahren wurden diese Frachtcontainer<br />
für temporäre Nutzungen wie Büroräume,<br />
temporäre Kliniken oder als<br />
Wohnraum genutzt. Vor allem in den<br />
USA fand diese Form des Wohnens<br />
großen Anklang.<br />
Das Wohnen im Container hat seinen<br />
ganz eigenen Reiz. Einer der großen<br />
Vorteile, die diese Wohnform hat,<br />
ist sicher an erster Stelle der Preis.<br />
Schnell <strong>und</strong> kostengünstig lassen sich<br />
Container in Wohnraum verwandeln –<br />
beispielsweise für Studenten. Die Vorstellung<br />
aber, dass im Container nur<br />
billiger Wohnraum entstehen kann,<br />
ist allerdings falsch.<br />
Collaborative Living setzt sich<br />
durch<br />
Die Dezentralisierung des Wohnens<br />
kommt den Gegebenheiten unserer<br />
Gesellschaft entgegen. Die demografische<br />
Entwicklung in den letzten<br />
Jahren hat mehrere <strong>Trends</strong> gezeigt.<br />
Die traditionelle Familie ist – leider<br />
– ein Auslaufmodell. Neben jungen<br />
Menschen leben immer mehr ältere<br />
Menschen allein <strong>und</strong> lassen damit die<br />
Single-Haushalte zur meistverbreiteten<br />
Wohnform werden. Patchwork-Familien<br />
<strong>und</strong> Mehrgenerationen-Haushalte<br />
liegen ebenfalls wieder im<br />
Trend.<br />
Angesichts dieser demografischen<br />
<strong>und</strong> gesellschaftlichen Entwicklung<br />
scheint es nur konsequent zu sein,<br />
dass sich das Collaborative Living als<br />
neuer Megatrend durchsetzen wird.<br />
Die Funktionen, die eine Wohnung<br />
erfüllen muss, lassen sich auf das<br />
Wesentliche reduzieren, wenn es eine<br />
entsprechende Ausweichmöglichkeit<br />
gibt, die dazu noch einen Mehrwert<br />
hat. Für ältere Menschen können<br />
Gemeinschaftsküchen <strong>und</strong> gemeinsam<br />
benutzte Esszimmer insbesondere<br />
deswegen interessant sein, weil<br />
sie zugleich als Orte der Begegnung<br />
dienen. >><br />
Ausgabe 9 | Mai 2018 | Umweltdialog.de<br />
55
Bauen <strong>und</strong> Wohnen<br />
Neue Gemeinschaftskonzepte am<br />
Beispiel des Wohnquartiers „Le<br />
Flair“<br />
Das „Le Flair“ in Düsseldorf setzt auf<br />
ein neues Gemeinschaftskonzept.<br />
Anstatt in jeder Wohnung ein Gästezimmer<br />
einplanen zu müssen, bietet<br />
das Projekt den Bewohnern eine<br />
Gästewohnung an, die allen gleichermaßen<br />
zur Nutzung zur Verfügung<br />
steht. Des Weiteren gibt es einen Gemeinschaftsraum,<br />
der von allen Bewohnern<br />
des Quartiers für besondere<br />
Anlässe gebucht werden kann. All<br />
diese gemeinschaftlich genutzten Flächen<br />
<strong>und</strong> noch weitere Dienstleistungen<br />
werden im „Le Flair“ über einen<br />
Servicepoint, in dem tagsüber ein Ansprechpartner<br />
vor Ort ist, organisiert.<br />
Collaborative Living ist die Renaissance<br />
des öffentlichen Raums<br />
Meine These ist, dass nicht nur der<br />
private Wohnraum auf das Wesentliche<br />
reduziert, sondern im gleichen<br />
Zug auch der öffentliche Raum aufgewertet<br />
werden wird. Wie schon früher<br />
die Marktplätze Orte der Begegnung<br />
<strong>und</strong> des zwanglosen Aufenthalts waren,<br />
wird es zu einer Renaissance von<br />
öffentlichen Orten kommen. Auch diese<br />
werden einen Wandel durchlaufen<br />
<strong>und</strong> sich den Wohnbereichen angleichen,<br />
die in Wohnungen der Reduzierung<br />
zum Opfer fallen.<br />
Bars werden zu wohnzimmerähnlichen<br />
Lounges, öffentliche Bäder werden<br />
zu Wohlfühl-Spas. Restaurants<br />
werden Bereiche zur Verfügung stellen,<br />
in denen man gemeinsam mit<br />
Fre<strong>und</strong>en kochen <strong>und</strong> essen kann.<br />
Schon jetzt gibt es erste Start-ups wie<br />
EatWith, Travelingspoon oder ShareDnD,<br />
die private Angebote zum Mitessen<br />
vermitteln. Alternativ werden<br />
sich neue Wohn- <strong>und</strong> Baukonzepte<br />
56 Ausgabe 9 | Mai 2018 | Umweltdialog.de
Bauen <strong>und</strong> Wohnen<br />
Fotos Servicepoint Le Flair: Christoph Pforr<br />
wie Baugruppen oder Genossenschaften<br />
vermehrt durchsetzen, bei denen<br />
ein Teil der gebauten Fläche gemeinschaftlich<br />
genutzt wird. Durch solche<br />
Gemeinschaftsflächen kann jede<br />
einzelne Wohnung kostengünstiger<br />
gebaut werden. Und schließlich wird<br />
es immer mehr (mobile) Containerwohnungen<br />
in allen Preis- <strong>und</strong> Wohnsegmenten<br />
geben, die im Bedarfsfall<br />
vollständig an einen anderen Ort<br />
transportiert werden können. In den<br />
USA sind Trailerparks, bei denen<br />
die Containerwohnungen mit einem<br />
Truck an einen anderen Ort verfrachtet<br />
werden, schon seit Jahrzehnten zur<br />
Normalität geworden.<br />
Und doch wird es auch hier so sein:<br />
Neue Wohnformen werden sich entwickeln,<br />
was im Umkehrschluss nicht<br />
heißt, dass es die herkömmlichen<br />
Wohnformen nicht mehr weiter geben<br />
wird. Wir werden uns nur darauf einstellen<br />
müssen, dass das Angebot an<br />
Wohnen vielfältiger, spannender <strong>und</strong><br />
einfallsreicher werden muss. Eine<br />
große Herausforderung an uns als<br />
Städteplaner <strong>und</strong> Architekten.<br />
Caspar Schmitz-Morkramer ist<br />
Architekt <strong>und</strong> Inhaber des Architekturbüros<br />
meyerschmitzmorkramer<br />
(www.msm.archi). f<br />
Vom Gemeinschaftsraum mit modernem<br />
Kamin über das Gästeapartment<br />
bis hin zum Besprechungsraum können<br />
die Bewohner im „Le Flair“ Flächen<br />
je nach Bedarf buchen.<br />
Fotos: Christoph Pforr<br />
Ausgabe 9 | Mai 2018 | Umweltdialog.de<br />
57
Bauen <strong>und</strong> Wohnen<br />
EINFACH MAL PLATZ SPAREN<br />
Foto: Steffen Jaenicke<br />
Viele machen sich beim Bauen <strong>und</strong> Wohnen Gedanken über die Umwelt. Sie benutzen natürliche<br />
Rohstoffe <strong>und</strong> lassen ihr Haus energetisch sanieren. Auch drehen sie die Heizung runter,<br />
bevor sie lüften oder schalten ihre Hausgeräte über Nacht aus. Aber mit räumlichem Platz<br />
gehen Menschen gerne verschwenderisch um. Doch der ist rar <strong>und</strong> wird immer teurer. Dabei<br />
gibt es neue Bauvarianten <strong>und</strong> Möbel, die einem ein Leben auf „kleinem Fuße“ ermöglichen.<br />
58 Ausgabe 9 | Mai 2018 | Umweltdialog.de
Bauen <strong>und</strong> Wohnen<br />
Von der Toilette bis zur Küche <strong>und</strong><br />
zum Schlafzimmer in fünf Schritten:<br />
Das wohl bekannteste Miniatur-Wohnkonzept<br />
sind die sogenannten „Tiny<br />
Houses“. Schlafen, kochen, duschen:<br />
das alles ist in solch einem Häuschen<br />
möglich – auf durchschnittlich<br />
6,4 Quadratmetern Wohnfläche. Mit<br />
Tiny Houses werden Gebäude in der<br />
Machart kleiner Hütten bezeichnet.<br />
Sie sind meistens auf Rädern montiert<br />
<strong>und</strong> man kann sie als Anhänger umherziehen.<br />
Auf kleinster Fläche nutzen<br />
sie jeden Kubikmeter durchdacht<br />
aus, um möglichst viel Wohnraum zu<br />
schaffen – mit allem, was ein Mensch<br />
in der Regel so braucht. Die Idee dahinter<br />
ist einleuchtend: Auf kleinstem<br />
Raum lebt es sich kostengünstig <strong>und</strong><br />
zugleich weitaus umweltverträglicher.<br />
Das „winzige Haus“ hat seinen Ursprung<br />
in den USA <strong>und</strong> ist dort sehr<br />
beliebt. Kein W<strong>und</strong>er: gesetzliche<br />
Vorgaben zum Standort <strong>und</strong> zu Baugenehmigungen<br />
gibt es in Amerika in<br />
der Regel nicht. In Deutschland herrschen<br />
dagegen strengere Vorschriften.<br />
Maximal zwei Wochen darf ein<br />
Wohnwagen auf öffentlichen Plätzen<br />
<strong>und</strong> Straßen parken, <strong>und</strong> auch das<br />
dauerhafte Wohnen in so einem Häuschen<br />
ist nicht überall möglich. Trotzdem<br />
kommt der Trend allmählich in<br />
Deutschland an.<br />
Auch für Städte geeignet?<br />
Auch die Studentin Julia Wehdeking<br />
hat gemeinsam mit einer Kommilitonin<br />
ein Mini-Haus auf Rädern entworfen.<br />
Dafür gewann sie einen Preis<br />
<strong>und</strong> nutzte das Geld gleich, um ihren<br />
Entwurf in die Tat umzusetzen. Das<br />
Besondere an ihrem Tiny House: alles<br />
soll nachhaltig sein. Statt Isolierwolle<br />
verwendet sie getrocknetes Seegras.<br />
Später soll es Solarzellen auf dem<br />
Dach haben <strong>und</strong> eine Komposttoilette.<br />
„Die Herausforderung ist, dass alles<br />
auf so kleinem Raum ist. Man muss<br />
sich überlegen: Was brauche ich?“, erklärt<br />
Wehdeking dem NDR.<br />
Bauberaterin Isabella Bosler ist ebenfalls<br />
vom Wohnen auf kleinstem Raum<br />
fasziniert. Deshalb gründete sie ein<br />
Online-Infoportal zu den Tiny Houses.<br />
„Der Zuspruch, den wir bekommen,<br />
ist enorm“, sagt sie. „Viele Menschen<br />
sind fasziniert von dem Thema.“ Mittlerweile<br />
gibt es in Deutschland mehrere<br />
Handwerksbetriebe, die den Bau<br />
der kleinen Häuser in ihrem Portfolio<br />
anbieten.<br />
Viele Architekten setzten sich bei<br />
der Städteplanung ebenfalls mit dem<br />
Konzept auseinander. Die Idee: Tiny<br />
Houses würden auf den Dächern von<br />
innerstädtischen Häusern für mehr<br />
Wohnraum sorgen. Das klingt unglaubwürdig,<br />
wäre aber ein Schritt<br />
in die richtige Richtung. Laut einer<br />
Studie der Universität Darmstadt aus<br />
dem Jahr 2016 könnten deutschlandweit<br />
1,5 Millionen zusätzliche Wohnungen<br />
geschaffen werden, wenn<br />
man die bestehenden Mehrfamilienhäuser<br />
der Baujahre 1950 bis 1989<br />
mit einigen Tiny Houses auf den Dächern<br />
aufstockte.<br />
Mikroapartments<br />
In teuren Großstädten liegen sie längst<br />
im Trend: Mikroapartments. Oftmals<br />
bereits fertig möbliert, finden hier vor<br />
allem Studenten, Singles <strong>und</strong> Pendler<br />
auf 20 Quadratmetern Platz im überteuerten<br />
Wohnungsmarkt. Wem >><br />
Ausgabe 9 | Mai 2018 | Umweltdialog.de<br />
59
Bauen <strong>und</strong> Wohnen<br />
die Mikroapartments zu klein sind, um Gäste zu empfangen,<br />
der kann in einigen Gebäuden auf Gemeinschaftsräume<br />
ausweichen. So bietet zum Beispiel die i Live-Gruppe in<br />
ihren Häusern Terrassen, Lounge- <strong>und</strong> Barräume, die die<br />
Mieter gemeinsam nutzen können.<br />
Auch ein Fitnessraum <strong>und</strong> eine Bibliothek sind im Angebot:<br />
„Unser Serviceangebot fokussiert dabei möglichst vielseitig<br />
die Interessen <strong>und</strong> Bedürfnisse unserer Bewohner.<br />
Zentraler Dreh- <strong>und</strong> Angelpunkt sind dabei unsere i Live-<br />
App sowie unser Community Manager vor Ort“, erklärt das<br />
Unternehmen. Dieser organisiert Freizeitevents wie gemeinsame<br />
Kochkurse oder Skifahrten.<br />
Foto: Enrico Lapponi / stock.adobe.com<br />
Kompakter geht's nicht<br />
Kleine Räume nützen gar nichts, wenn die Möbel dazu<br />
nicht passen oder zu groß sind. Wer praktische Lösungen<br />
für platzsparende Möbel benötigt, kann auf kompakte Alternativen<br />
zurückgreifen. So gibt es Möbelstücke, die unterschiedliche<br />
Funktionen miteinander kombinieren, den<br />
Luftraum im Zimmer <strong>und</strong> den Platz unter der Treppe nutzen.<br />
Manche kann man sogar zusammenfalten. f<br />
BUCHTIPP<br />
Wer noch weitere <strong>Tipps</strong> sucht, um platzsparend zu leben,<br />
wird hier fündig:<br />
66 Raumw<strong>und</strong>er für ein entspanntes Zuhause, lebendige<br />
Nachbarschaft <strong>und</strong> grüne Städte<br />
Irgendwie ist immer zu wenig Platz: Ungenutzte Dinge<br />
sammeln sich an, füllen Schubladen <strong>und</strong> Abstellkammer;<br />
Kinder vergrößern den Haushalt <strong>und</strong> brauchen irgendwann<br />
ein eigenes Zimmer. Auf der anderen Seite stehen Räume<br />
leer, weil niemand permanent Gäste hat oder das Haus im<br />
Grünen für die alleinstehende Oma zu groß geworden ist.<br />
Das Buch präsentiert 66 Anregungen <strong>und</strong> <strong>Tipps</strong>, die dabei<br />
helfen, diesen Herausforderungen zu begegnen. Platz<br />
schaffen, Freiräume gewinnen, Zusammenrücken – die<br />
Möglichkeiten für ein anderes, modernes Wohnen sind<br />
immens, <strong>und</strong> die Auswirkungen sind es ebenso: Alte Menschen<br />
finden wieder Anschluss, junge Städter bezahlbaren<br />
Wohnraum. Kieze <strong>und</strong> Viertel würden lebendiger, wenn<br />
Jung <strong>und</strong> Alt sich näherkommen, Zugereiste <strong>und</strong> Alteingesessene<br />
sich gegenseitig bereichern.<br />
Daniel Fuhrhop:<br />
„Einfach anders wohnen“,<br />
28 Seiten,<br />
oekom verlag München 2018<br />
ISBN-13: 978-3-96238-016-8<br />
EUR 14,00 EUR<br />
60 Ausgabe 9 | Mai 2018 | Umweltdialog.de
Bauen <strong>und</strong> Wohnen<br />
Sie sind von der CSR-Berichtspflicht<br />
der EU betroffen?<br />
Oder Sie wollen Ihre <strong>Nachhaltig</strong>keitsdaten<br />
gegenüber Ihren Stakeholdern berichten?<br />
Sie haben aber keine Zeit, komplexe<br />
Richtlinien zu studieren?<br />
Und Sie wollen keine komplizierte<br />
Software auf Ihrem Rechner<br />
installieren?<br />
Dann haben wir für Sie<br />
die richtige Lösung!<br />
Mit dem Softwaretool CSRmanager können Sie einfach, effizient<br />
<strong>und</strong> sicher Ihre <strong>Nachhaltig</strong>keitsdaten managen, evaluieren <strong>und</strong><br />
nach internationalen Standards reporten.<br />
Weitere Informationen finden Sie unter<br />
www.csr-manager.org!<br />
Oder sprechen Sie uns persönlich an:<br />
Tel. +49 (0) 251 200 782 0<br />
E-Mail: support@csr-manager.org<br />
macondo publishing GmbH - Dahlweg 87 - D - 48153 Münster<br />
Ausgabe 9 | Mai 2018 | Umweltdialog.de<br />
Tel. +49 (0) 251 200 782 0 - E-Mail: support@csr-manager.org<br />
61
Bauen <strong>und</strong> Wohnen<br />
<strong>Nachhaltig</strong>keit ist die<br />
neue Heimat<br />
Foto: Ihar Bublikau / stock.adobe.com<br />
62 Ausgabe 9 | Mai 2018 | Umweltdialog.de
Bauen <strong>und</strong> Wohnen<br />
Wohnen ist die Weise, in der wir uns in der Welt befinden <strong>und</strong> der Versuch zu leben,<br />
ohne sich zu verlieren. Im Zuge gesellschaftlicher Umwälzungen sowie veränderter<br />
Lebensmodelle <strong>und</strong> Ansprüche gewinnt die Sehnsucht nach Heimat immer mehr<br />
an Bedeutung – <strong>und</strong> damit nach Privatheit, Geborgenheit, Ruhe <strong>und</strong> Wärme. Die<br />
neue Gemütlichkeit, geprägt durch Materialien wie Holz, Baumwolle, Leder, Filz<br />
<strong>und</strong> Naturstein, ist die Antwort auf unsere rastlose Gesellschaft. Wer ihr entfliehen<br />
will, schließt die Tür hinter sich <strong>und</strong> zelebriert die eigene Wohnkultur, in der wir uns<br />
ganz als uns selbst erfahren <strong>und</strong> „wirklich“ sind.<br />
Von Dr. Alexandra Hildebrandt<br />
Das Wohnen aber<br />
ist der Gr<strong>und</strong>zug<br />
des Seins.<br />
„Martin Heidegger<br />
(„Bauen, Wohnen, Denken“, 1951)<br />
Diese Wohnkultur zeichnet sich durch folgende <strong>Trends</strong><br />
aus:<br />
Dekoration<br />
Je mehr die grüne Welt draußen schrumpft, desto mehr<br />
hält sie Einzug in unser Zuhause, in dem Alltagsobjekte<br />
wie Aufbewahrungsorte einer intakten Natur erscheinen.<br />
Angesichts der „wachsenden“ Untergangsszenarien wird<br />
der Ruf nach Dekoration immer lauter, was durch steigende<br />
Auflagenzahlen von Idyll-Magazinen wie „Landlust“,<br />
„LandIdee“ oder „Mein schönes Land“ noch verstärkt<br />
wird.<br />
Die schöne neue Ding- <strong>und</strong> Motivwelt wird zum Appell,<br />
„den Tag zu pflücken“ (Horaz), was zu einem elementaren<br />
Prinzip des glücklichen Lebens gehört. Die eigenen vier<br />
Wände sind nicht nur Rückzugsort, sondern auch Beziehungsort.<br />
Essbereich<br />
Einrichtungsgegenstände gewinnen zunehmend an Wohlfühlcharakter,<br />
was sich auch im Essbereich zeigt: Hier dominiert<br />
der Trend zu ausladenden Tischen <strong>und</strong> gepolsterten<br />
Sitzbänken sowie komfortablen Armlehnstühlen, die<br />
Großzügigkeit <strong>und</strong> behagliche Wärme vermitteln.<br />
Farben<br />
Zu den Trendfarben gehören samtige Nudetöne (Creme,<br />
Karamell <strong>und</strong> Schoko), aber auch pastellige Grün-, Blauoder<br />
Grautöne. Da die Gesellschaft unruhig <strong>und</strong> unübersichtlich<br />
geworden ist, dominiert eine Bewegung des Rückzugs<br />
<strong>und</strong> des Minimalismus, verb<strong>und</strong>en mit dem Wunsch<br />
nach Beständigkeit <strong>und</strong> Sicherheit. Grau ist deshalb zu einem<br />
Understatement geworden. Ein besonderer Trend ist<br />
heute betongrau: Neben den vielen Vorteilen, den Beton für<br />
das Baugewerbe bietet, wird das Material gerade in der Küchenbranche<br />
neu entdeckt.<br />
>><br />
Ausgabe 9 | Mai 2018 | Umweltdialog.de<br />
63
Bauen <strong>und</strong> Wohnen<br />
Küche<br />
In Deutschland ist der Küchenmarkt<br />
ein Milliardengeschäft mit stetig<br />
wachsenden Umsätzen. Viele Deutsche<br />
investieren inzwischen mehr<br />
in die eigene Küche als ins Auto, das<br />
längst kein Statussymbol mehr ist.<br />
Hier verbinden sich heute ebenfalls<br />
innovative Technologien, intelligente<br />
Funktionen, nachhaltiges Design <strong>und</strong><br />
traditionelles Handwerk zu einzigartigen<br />
<strong>und</strong> emotionalen Produkten. Das<br />
ist nicht „abgefahren“, sondern hat<br />
mit der Lust am Bleiben <strong>und</strong> am Analogen<br />
zu tun. Es geht darum, sich aus<br />
der Dauererreichbarkeit auszuklinken,<br />
achtsam <strong>und</strong> in sich ruhend im<br />
Hier <strong>und</strong> Jetzt zu sein <strong>und</strong> einer Sache<br />
seine volle Aufmerksamkeit zu schenken.<br />
Trendforscher versprechen sich<br />
von der Küche der Zukunft, dass sie<br />
unsere Ernährung gesünder <strong>und</strong> den<br />
Genuss vielseitiger macht. Dies hängt<br />
vor allem damit zusammen, dass<br />
nachhaltige Lebensweisen bereits in<br />
der Gestaltung unseres Alltags <strong>und</strong><br />
Lebensumfelds immer mehr an Bedeutung<br />
gewinnen. Das gilt auch für<br />
die Einrichtung <strong>und</strong> Nutzung der Küche.<br />
Dabei sind nicht nur ökologische<br />
Gesichtspunkte von Bedeutung, sondern<br />
auch die Steigerung der eigenen<br />
Lebensqualität durch ges<strong>und</strong>e Nahrungsmittel<br />
sowie die Verwendung<br />
nachhaltig produzierter Küchenmöbel<br />
<strong>und</strong> Elektrogeräte. Die moderne Küche<br />
stillt unsere Sehnsucht nach Heimat<br />
<strong>und</strong> Überschaubarkeit in einer<br />
globalisierten Welt.<br />
Möbel<br />
„Einladende“ Möbel ziehen verstärkt<br />
in moderne Wohn- <strong>und</strong> Bürowelten<br />
ein. In Zukunft werden vor allem Erdtöne<br />
- braun bis ocker – eine größere<br />
Rolle spielen. Schwarz hat es allerdings<br />
schwer, weil damit Bedrohung<br />
<strong>und</strong> Pessimismus assoziiert werden.<br />
Maßarbeit <strong>und</strong> <strong>Nachhaltig</strong>keit sowie<br />
ressourcenschonende Fertigungstechniken<br />
gewinnen beim Möbelkauf in<br />
einer Zeit voller Technisierung, Digitalisierung,<br />
Massenproduktion, Komplexität<br />
<strong>und</strong> Tempowechsel immer<br />
mehr an Bedeutung – vor allem der<br />
Werkstoff Holz als „analoger Ruhepol"<br />
wird immer beliebter. Er ist das verbindende<br />
<strong>und</strong> identitätsstiftende Element<br />
zwischen uns <strong>und</strong> der Welt, der<br />
sich im besten Wortsinn von etwas<br />
Höherem ableitet: dem Baum. Wer<br />
ihn verstehen will, muss den Wald als<br />
Ganzes begreifen.<br />
Die Wertschätzung des Handwerks<br />
in Zeiten tiefgreifender gesellschaft-<br />
Foto: Federico Rostagno / stock.adobe.com<br />
Foto: lulu / stock.adobe.com<br />
Foto: fotofabrika / stock.adobe.com<br />
64 Ausgabe 9 | Mai 2018 | Umweltdialog.de
Bauen <strong>und</strong> Wohnen<br />
licher Veränderungen <strong>und</strong> Instabilität<br />
ist unter anderem darauf<br />
zurückzuführen, dass alles nicht<br />
Greifbare immer mehr für Unbehagen<br />
sorgt. Selbstbestimmung ist zu einem<br />
der prägendsten Begriffe der Gegenwart<br />
geworden, denn es geht darum,<br />
die Kontrolle über alltägliche Dinge<br />
in einer Zeit der Technisierung <strong>und</strong><br />
Kommerzialisierung aller Lebensbereiche<br />
zurückzuholen.<br />
Motive<br />
Je härter die Realität, desto ausgeprägter<br />
ist die Sehnsucht nach Leichtigkeit,<br />
nach dem Schwebenden, das<br />
man festhalten möchte, aber doch<br />
nicht wirklich fassen kann. So tauchen<br />
seit einigen Jahren vor allem<br />
Wolkenmotive auf Textilien, Handyhüllen,<br />
Schneidbrettern <strong>und</strong> Sitzmöbeln<br />
auf. Wo Wolken sind, ist auch die<br />
Engelkunst nicht weit, die bereits in<br />
den 1990er Jahren eine Renaissance<br />
erlebte.<br />
Polster<br />
In den vergangenen Jahren präsentierte<br />
die Möbel- <strong>und</strong> Einrichtungsbranche<br />
ein Wolkenmeer aus Stoffen<br />
<strong>und</strong> Drapeterien, aber auch ausladende<br />
watteweiche Sitzlandschaften.<br />
Die „gepolsterten“ Errungenschaften<br />
stammen bereits aus dem 16. Jahrh<strong>und</strong>ert,<br />
zuvor gab es Felle <strong>und</strong> Stroh.<br />
Die Polstergarnitur ist eine Erfindung<br />
aus dem 18. Jahrh<strong>und</strong>ert, bestehend<br />
aus einem Sofa <strong>und</strong> zwei Armlehnstühlen.<br />
Auch sie erlebt gerade eine<br />
Renaissance.<br />
Schlafbereich<br />
Schlafen <strong>und</strong> Matratzen gehören derzeit<br />
zu den größten Lifestyle-<strong>Themen</strong>.<br />
Die niederländische Trendforscherin<br />
Lidewij „Li“ Edelkoort sagte bereits<br />
vor einigen Jahren voraus, dass wir<br />
künftig mehr in Schlafbereichen leben<br />
werden, weil die Grenzen von Arbeit<br />
<strong>und</strong> Muße in unserer beunruhigten<br />
westlichen Kultur immer fließender<br />
werden. Schlafzimmer werden als<br />
Orte des Träumens künftig immer<br />
wichtiger, weil wir im Schlafen lernen,<br />
körperlich stillzuhalten <strong>und</strong> der Geist<br />
vom rationalen Denken befreit wird.<br />
Sie sind heute immer auch Rettungsräume,<br />
die uns helfen, unser Leben<br />
zusammenzuhalten <strong>und</strong> „schlafwandlerische<br />
Sicherheit“ (Paul Valéry) zu<br />
lernen, die uns hilft, der inneren <strong>und</strong><br />
äußeren Unruhe vorbehaltlos zu begegnen.<br />
Schlafbereiche sind aber auch deshalb<br />
so bedeutsam, weil das Bett zu<br />
den wichtigsten Möbelstücken im Leben<br />
eines Menschen gehört, der darin<br />
etwa ein Drittel seiner Lebenszeit<br />
verbringt. Die Matratze ist ein Gr<strong>und</strong>element<br />
des Wohnens <strong>und</strong> der Inbegriff<br />
von Intimität <strong>und</strong> Körperlichkeit.<br />
Schlaf ist elementar in einer Welt, in<br />
Foto: lulu / stock.adobe.com<br />
der Menschen täglich Stress ausgesetzt<br />
sind. Eine nachhaltige Gesellschaft<br />
sollte dafür Sorge tragen, dass<br />
Schlaf eine leistungsfreie Zone bleibt<br />
– ein Ruhebereich, der sich selbst genügt.<br />
Teppiche<br />
Der Teppich feierte in den vergangenen<br />
Jahren ein grandioses Comeback,<br />
nachdem jahrelang vor allem Parkett,<br />
Linoleum oder Estrich in Wohn- <strong>und</strong><br />
Arbeitsräumen verlegt wurden. Er ist<br />
so etwas wie ein „mentaler Rückzugsraum“<br />
in Zeiten der Globalisierung<br />
<strong>und</strong> Digitalisierung. Der Vintage-Look<br />
vieler Teppiche (aus entfärbten Versatzstücken<br />
alter Teppiche werden<br />
neue kombiniert) steht für die Sehnsucht<br />
nach Verwurzelung, Einzigartigkeit,<br />
Authentizität <strong>und</strong> Handwerkskunst.<br />
Wohntextilien<br />
Anbieter von nachhaltigen Heim- <strong>und</strong><br />
Wohntextilien werben heute verstärkt<br />
mit der „Gemütlichkeit in den eigenen<br />
vier Wänden“ (memolife). Da Wohntextilien<br />
direkten Hautkontakt haben,<br />
achten immer mehr Menschen darauf,<br />
dass sie frei von Schadstoffen sind.<br />
Urban Jungle<br />
Als Urban Jungle wird innen fortgesetzt,<br />
was als Urban Gardening im<br />
Außenbereich begann: Zuerst ließen<br />
die Stadtbewohner Salat <strong>und</strong> Blumen<br />
auf Dächern, zwischen Pflastersteinen,<br />
Hinterhöfen <strong>und</strong> Hauswänden<br />
sprießen – nun sind es Zierpflanzen<br />
in der Wohnung, die Wände, Regale<br />
<strong>und</strong> Fensterbänke bedecken. „Urban<br />
Jungle” steht für einen grünen Rückzugsort<br />
zwischen Asphalt <strong>und</strong> Beton.<br />
Gern gekauft werden grüne Lifestyleprodukte<br />
wie Plant-Hanger oder<br />
„Boob-Pot” (die ganz nebenbei an einen<br />
weiblichen Oberkörper erinnern).<br />
Zimmerpflanzen gehören ebenfalls zu<br />
den neuen Statussymbolen.<br />
<strong>Nachhaltig</strong>keit ist die neue Heimat. f<br />
Ausgabe 9 | Mai 2018 | Umweltdialog.de<br />
Foto: virtua73 / stock.adobe.com<br />
65
Bauen <strong>und</strong> Wohnen<br />
Besser wohnen<br />
Qi<br />
“<br />
dank „fließendem<br />
Foto: Skandinavisk<br />
Jeder kennt diese Situation: Eine Wohnung ist schön eingerichtet,<br />
mit gut aufeinander abgestimmten Bodenbelägen<br />
<strong>und</strong> Möbeln – aber trotzdem fühlt man sich nicht<br />
richtig wohl. In solchen Fällen würden Anhänger der aus<br />
China stammenden Lehre des Feng-Shui vermuten, dass<br />
einzelne Elemente in der Einrichtung die Harmonie des<br />
Raums stören. Manchmal reicht schon eine kleine Veränderung,<br />
um den Gesamteindruck deutlich zu verbessern.<br />
Die ostasiatische Harmonielehre erfreut sich auch in<br />
Deutschland immer größerer Beliebtheit. Sie geht davon<br />
aus, dass wir überall von der Lebensenergie „Qi“ umgeben<br />
sind. Das Qi muss in Bewegung bleiben, um für einen Ausgleich<br />
zwischen den fünf Gr<strong>und</strong>elementen Feuer, Metall,<br />
Erde, Holz <strong>und</strong> Wasser zu sorgen. Für die Einrichtung einer<br />
Wohnung oder eines Gartens bedeutet das: nirgendwo<br />
darf der Fluss dieser Lebensenergie blockiert werden.<br />
Je höher die Bewegung des Qi, desto höher auch das persönliche<br />
Wohlbefinden. Ein enger Eingangsbereich hinter<br />
der Wohnungstür wirkt beispielsweise hemmend auf den<br />
Energiefluss. Laut Feng-Shui sollten Kleidung <strong>und</strong> Schuhe<br />
im Flur in einem geschlossenen Schrank verstaut werden.<br />
Abger<strong>und</strong>ete Möbelkanten <strong>und</strong> der geschickte Einsatz von<br />
Spiegeln <strong>und</strong> Bildern können den Eindruck von Weite vermitteln<br />
<strong>und</strong> so Blockaden aufheben. Ganz wichtig ist die<br />
Positionierung des Schlafzimmers – dem Ruhepol der Wohnung.<br />
Nach den Regeln des Feng-Shui sollte es möglichst<br />
weit vom Haupteingang der Wohnung entfernt liegen <strong>und</strong><br />
am besten nicht an ein Badezimmer oder WC angrenzen. So<br />
würde die Harmonie des Schlafplatzes gestört.<br />
66 Ausgabe 9 | Mai 2018 | Umweltdialog.de
Bauen <strong>und</strong> Wohnen<br />
Die Wirkung von Feng-Shui ist bislang<br />
wissenschaftlich nicht belegbar. Wohl<br />
aber spürbar, glaubt man den Berichten<br />
von K<strong>und</strong>en. In Deutschland ist<br />
das sogenannte „Business Feng-Shui“<br />
sehr beliebt. Vor allem von Einzelunternehmern<br />
<strong>und</strong> Konzernen wird dies<br />
gern in Anspruch genommen. Die Beweggründe<br />
dafür sind meist persönlich,<br />
ein Gefühl von Unwohlsein oder<br />
der Wunsch nach Veränderung.<br />
Hygge – dänische Gemütlichkeit<br />
„Hygge“ – was auf Deutsch etwa so<br />
viel wie „Gemütlichkeit“ bedeutet<br />
– ist ein Trend aus Dänemark, der<br />
mittlerweile immer stärker Einzug in<br />
die deutschen Haushalte hält. Sogar<br />
bis nach Großbritannien <strong>und</strong> in die<br />
USA hat er es schon geschafft. Was<br />
macht ihn so beliebt? Glaubt man den<br />
unzähligen Ratgebern, bringt Hygge<br />
mehr Freude <strong>und</strong> Entspannung in die<br />
eigenen vier Wände. Dazu braucht es<br />
nicht viel: Einige (am besten viele!)<br />
Kerzen <strong>und</strong> ein paar Pflanzen für die<br />
richtige Atmosphäre. Bequeme Kissen<br />
<strong>und</strong> dicke Wolldecken, in die man sich<br />
gemütlich einkuscheln kann. Etwas<br />
Leckeres zu essen, im Idealfall selbst<br />
gebacken oder gekocht (Kalorien werden<br />
hier nicht gezählt!). Und ein paar<br />
liebe Fre<strong>und</strong>e oder die Familie, damit<br />
man sich bei netten Gesprächen gemeinsam<br />
entspannen kann (das Handy<br />
bleibt natürlich ausgeschaltet!).<br />
Als nicht besonders hyggelig gelten<br />
übrigens Diskussionen über Politik<br />
sowie Hektik, Streit <strong>und</strong> Lärm. Einige<br />
sehen diesen Trend als schöne<br />
Illusion an, als Verschließen vor der<br />
Wirklichkeit. Andere wiederum nehmen<br />
ihn als Möglichkeit wahr, dem<br />
Alltagsstress zu entfliehen <strong>und</strong> sich<br />
mal wieder auf das „Wesentliche“ wie<br />
die Familie oder das Lesen eines Buches<br />
konzentrieren zu können. Das<br />
macht – bei aller Realitätsflucht – den<br />
Charme dieser Lebensweise aus: dass<br />
sie den Blick auf die schönen Dinge im<br />
Leben lenkt. Das kann ein Buch, eine<br />
Kerze oder ein Stück Schokoladetorte<br />
sein. Da verw<strong>und</strong>ert es nicht, dass die<br />
Dänen laut Weltglücksreport zu den<br />
glücklichsten Menschen der Welt zählen.<br />
Neo-Biedermeier: Zu Hause ist es<br />
doch am Schönsten<br />
In einer Zeit, in der befristete Verträge<br />
eher die Regel als die Ausnahme<br />
sind, die Welt sich immer schneller<br />
zu drehen scheint <strong>und</strong> selbst das Aussuchen<br />
des richtigen Kaffeegetränks<br />
eine kleine Herausforderung ist, sehnen<br />
sich vor allem die 20- bis 30-Jährigen<br />
hierzulande nach Sicherheit <strong>und</strong><br />
Einfachheit. Aufgewachsen sind sie in<br />
einer Zeit der Instabilität: Die Währung,<br />
das Klima <strong>und</strong> auch die Weltwirtschaft<br />
gerieten ins Wanken. Das<br />
wiederum führe zu einem erhöhten<br />
Sicherheitsbedürfnis, stellten etwa<br />
Forscher vom Zukunftsinstitut aus<br />
Frankfurt fest. Das eigene Zuhause<br />
wird somit zum Rückzugsort, Nostalgie<br />
wieder „modern“.<br />
Neo-Biedermeier nennt sich dieser<br />
Trend, der für die Flucht vor der Welt<br />
in die eigenen vier Wände steht. Politikverdrossenheit,<br />
Angst vor Terror<br />
<strong>und</strong> der drohende Verlust der Privatsphäre<br />
durch die Digitalisierung sind<br />
nur ein paar der Triebfedern dieser<br />
(nicht ganz so) neuen Bewegung.<br />
Schon im 19. Jahrh<strong>und</strong>ert zogen sich<br />
die Menschen aus der Öffentlichkeit<br />
zurück ins traute Heim, um den politischen<br />
<strong>und</strong> gesellschaftlichen Unsicherheiten<br />
der damaligen Zeit zu<br />
entgehen.<br />
Heute ist das Ganze sogar noch einfacher:<br />
Die moderne Technik macht’s<br />
möglich. Statt ins Kino zu gehen, verbringt<br />
man den Abend mit diversen<br />
Streaming-Portalen lieber gemütlich<br />
auf der Couch, der Konzertbesuch<br />
wird durch Musik aus der neuen Anlage<br />
ersetzt. Lebensmittel lassen sich<br />
online bestellen, die Möglichkeit von<br />
Homeoffice verlagert sogar das Arbeitsleben<br />
in die private Umgebung.<br />
Rückzug in die Gemütlichkeit des<br />
Privaten ist hier das Stichwort. Im<br />
Gegensatz zu dem eher weniger nachhaltigen<br />
Onlineshopping steht der<br />
schlichte Einrichtungsstil der neuen<br />
„Generation Biedermeier“, wie sie<br />
von den Wissenschaftlern des Kölner<br />
Rheingold-Instituts genannt wird.<br />
Klarheit, Funktionalität <strong>und</strong> Einfachheit<br />
dominieren, die Materialien stammen<br />
bestenfalls aus lokalen Quellen.<br />
In den Großstädten zeigt sich derweil<br />
ein Trend zur Gruppenbildung, die<br />
Stadt wird dörflich inszeniert. Man<br />
will „gemeinsam allein sein“. Deutlich<br />
wird das vor allem am Immobilienmarkt,<br />
wie der Immobilienreport 2015<br />
des Frankfurter Zukunftsinstituts herausgestellt<br />
hat. In neue Häuser investiert<br />
man gemeinsam, Wohneigentum<br />
finanziert sich durch Baugruppen. Das<br />
hat nicht nur Vorteile für den eigenen<br />
Geldbeutel: die „Generation Biedermeier“<br />
erschafft sich so ihre eigene<br />
(Wahl-) Großfamilie. Fragt sich nur,<br />
ob diese Sehnsucht nach mehr Sicherheit<br />
<strong>und</strong> Einfachheit bloß ein (Wohn-)<br />
Trend ist oder vielleicht sogar für den<br />
Anfang einer neuen gesellschaftlichen<br />
Bewegung steht. f<br />
Ausgabe 9 | Mai 2018 | Umweltdialog.de<br />
67
Bauen <strong>und</strong> Wohnen<br />
Wieso? Weshalb?<br />
Warum? Wer nicht<br />
fragt, bleibt dumm!<br />
UmweltDialog bietet verlässlichen <strong>und</strong> objektiven <strong>Nachhaltig</strong>keits-Journalismus.<br />
Klar, verständlich, kompakt <strong>und</strong> überparteilich.<br />
e.<br />
e.<br />
.<br />
ll.<br />
Ausgabe 9<br />
Mai 2018<br />
9,00 EUR<br />
Iss Iss was?<br />
Ausgabe 8<br />
Wie die Food-Industrie nachhaltig werden kann<br />
Wie die Food-Industrie nachhaltig werden kann<br />
November 2017<br />
Ausgabe 8<br />
9,00 EUR<br />
November 2017<br />
9,00 EUR<br />
Trautes Heim,<br />
Glück allein?<br />
So können wir nachhaltig umweltdialog.de <strong>bauen</strong> <strong>und</strong> wohnen<br />
umweltdialog.de<br />
global<br />
compact<br />
Deutschland<br />
+<br />
GRATIS<br />
Die aktuelle Ausgabe<br />
des deutschen<br />
Global Compact<br />
Jahrbuches.<br />
WE SUPPORT<br />
Deutschland<br />
2030<br />
– Wie können wir die<br />
SDGs umsetzen?<br />
2017<br />
01.11.17 12:44<br />
01.11.17 12:44<br />
umweltdialog.de<br />
Jetzt einfach bestellen:<br />
macondo.de/produkt/abo<br />
Telefon: +49 (0) 251 / 20078 2-0 | E-Mail: bestellung@macondo.de<br />
Jahresabonnement UmweltDialog-Magazin: Zwei Ausgaben des UmweltDialog-Magazins frei Haus für Euro 18,–<br />
www.umweltdialog.de<br />
68 Ausgabe 9 | Mai 2018 | Umweltdialog.de
Bauen <strong>und</strong> Wohnen<br />
Schloss Tempelhof:<br />
Eine Ökokommune<br />
mit Vorbildcharakter<br />
Fotos: Schloss Tempelhof<br />
Von Fee Hovehne <strong>und</strong> Sonja Scheferling<br />
Wenn wir wirklich Verantwortung für uns<br />
<strong>und</strong> unsere Nachkommen übernehmen<br />
wollen, müssen wir bei uns selbst anfangen:<br />
Nach diesem Motto leben die Menschen<br />
im Ökodorf Schloss Tempelhof. Ihr<br />
Ziel ist es, sich weitestgehend autark mit<br />
Biolebensmitteln <strong>und</strong> Energie zu versorgen<br />
<strong>und</strong> solidarische Wirtschaftskreisläufe zu<br />
etablieren. Schloss Tempelhof ist ein gutes<br />
Beispiel dafür, wie verlassene Orte wiederbelebt<br />
werden können.<br />
Landschaftsidylle pur: Nichts als Felder, Wiesen <strong>und</strong> vereinzelte<br />
Bäume umranden Schloss Tempelhof nahe Kreßberg<br />
in Schwäbisch Hall. Doch wer denkt, dass die Siedlung<br />
ein einsamer Ort ist, der irrt gewaltig. Denn: Schloss<br />
Tempelhof ist die Heimat von über 100 Menschen, die hier<br />
wohnen, zum Teil arbeiten <strong>und</strong> ihr Konzept von einer nachhaltigen<br />
Lebensweise verwirklichen. So kann man auf Familien<br />
mit Kindern, Menschen mittleren Semesters oder<br />
Senioren treffen.<br />
Das Besondere ist, dass sich alle Bewohner dem solidarischen<br />
Gedanken verpflichtet fühlen <strong>und</strong> zum Wohle aller<br />
handeln wollen. Wichtige Entscheidungen werden nur im<br />
Konsens getroffen <strong>und</strong> die Gemeinschaft führt sich selbst<br />
nach dem All-Leader-Prinzip. Das bedeutet, dass jedes Mitglied<br />
für die gesamte Entwicklung der Gemeinschaft Verantwortung<br />
trägt.<br />
>><br />
Ausgabe 9 | Mai 2018 | Umweltdialog.de<br />
69
Bauen <strong>und</strong> Wohnen<br />
Wie alles begann<br />
Die Geschichte der Gemeinschaft begann<br />
2007, als sich eine Gruppe von<br />
Gleichgesinnten aus dem Raum München<br />
dazu entschloss, ihre Version<br />
von einem zukunftsfähigen Zusammenleben<br />
umzusetzen. Drei Jahre<br />
lang suchten sie, bis sie das geeignete<br />
Objekt dafür gef<strong>und</strong>en hatten:<br />
„Der erste Eindruck war schon hart“,<br />
erzählte Agnes Schuster, eine der<br />
Mitbegründerinnen, gegenüber dem<br />
Stadtmagazin Rotour. Kein W<strong>und</strong>er,<br />
standen doch die Gebäude der Siedlung<br />
zuvor vier Jahre lang leer <strong>und</strong><br />
mussten dementsprechend renoviert<br />
werden.<br />
Die Siedlung Schloss Tempelhof hat<br />
eine lange Vergangenheit, die über<br />
mehrere Jahrh<strong>und</strong>erte reicht. Vor<br />
dem 30-jährigen Krieg erbaut, entwickelte<br />
sich der Adelssitz zu einer<br />
Wohnsiedlung. Im 19. Jahrh<strong>und</strong>ert<br />
wurde das Objekt dann zu einer<br />
Kindererziehungsanstalt umfunktioniert,<br />
<strong>und</strong> in den 1980er Jahren fand<br />
dort eine Behindertenwerkstatt ihre<br />
Räume, die das Ensemble aber 2006<br />
verließ.<br />
Zu dem Besitz gehören aktuell insgesamt<br />
31 Hektar Boden, bestehend<br />
aus vier Hektar Baugr<strong>und</strong> mit zahlreichen<br />
Gebäuden <strong>und</strong> 27 Hektar Agrarland.<br />
Bodenspekulation ausgeschlossen<br />
Privatbesitz an Gr<strong>und</strong> <strong>und</strong> Boden gibt<br />
es bei den Tempelhofern nicht. Die gemeinnützige<br />
Schloss Tempelhof Stiftung<br />
hat die Liegenschaft erworben<br />
<strong>und</strong> per Erbpachtvertrag mit 99 Jahren<br />
Laufzeit an die Genossenschaft<br />
vergeben. Das Objekt wurde so jegli-<br />
70 Ausgabe 9 | Mai 2018 | Umweltdialog.de
Bauen <strong>und</strong> Wohnen<br />
Impressionen der Gemeinschaft<br />
Schloss Tempelhof<br />
Mindesteinlage von 30.000 Euro Mitglied<br />
in der Genossenschaft werden;<br />
vorausgesetzt, die anderen sind einverstanden.<br />
Dafür erhält er ein Anrecht<br />
auf 36 Quadratmeter Wohnraum<br />
<strong>und</strong> wird an dem Projekt beteiligt.<br />
Das Genossenschaftsmodell bildet so<br />
das finanzielle <strong>und</strong> rechtliche F<strong>und</strong>ament,<br />
das dieses soziale Experiment<br />
erst ermöglicht: „Wer hier leben will,<br />
investiert in ein Lebenskonzept“, zitiert<br />
Rotour Stefanie Raysz, die auch<br />
in Tempelhof wohnt. Allerdings müssen<br />
die Mitglieder finanziell unabhängig<br />
sein, denn der Tempelhof ist kein<br />
Hort für gesellschaftliche Aussteiger.<br />
So pendeln einige der Mitglieder wöchentlich<br />
zur Arbeit nach München<br />
oder Ulm.<br />
Arbeit vor Ort<br />
cher künftigen Bodenspekulation entzogen:<br />
„Die Genossenschaft ist eine<br />
geeignete demokratische Rechtsform<br />
für die Verwaltung der solidarischen<br />
Betriebe, denn jeder hat unabhängig<br />
von der Höhe seiner Einlage das gleiche<br />
Stimmrecht“, erklärt die Gemeinschaft<br />
auf ihrer Homepage. Zusätzlich<br />
wurde als Träger von gemeinnützigen<br />
Projekten ein Verein gegründet.<br />
Neben dem Seminar <strong>und</strong> Veranstaltungsbereich<br />
gibt es unter dem Dach<br />
des Vereins eine freie Schule sowie<br />
Jugendprojekte.<br />
Wer beitreten möchte, muss eine<br />
einjährige Annäherungsphase mitmachen<br />
<strong>und</strong> kann dann gegen eine<br />
Andere wiederum sind selbstständig<br />
<strong>und</strong> können vor Ort tätig sein. So wie<br />
Max Thulè, der mit seiner Familie<br />
ebenfalls in Tempelhof lebt <strong>und</strong> die<br />
MoWo Tempelhof GmbH gegründet<br />
hat. Ob in modularer Wabenstruktur<br />
oder als Wagen auf Rädern: Der studierte<br />
Maschinenbauer stellt kleinen<br />
Wohnraum aus baubiologischen Materialien<br />
her – ganz individuell nach<br />
den jeweiligen Wünschen der K<strong>und</strong>en.<br />
Von Hand gefertigt, setzt er dabei auf<br />
langlebige, regionale, ökologische <strong>und</strong><br />
transportable Lösungen: „Ich bin mit<br />
dem Thema von mobilen Wohneinheiten<br />
schon von der Wiege an groß<br />
geworden, da meine Eltern den Traum<br />
hatten, in einem alten Salamander<br />
Schuhverkaufsbus durch die Lande<br />
zu ziehen, mit mir als Säugling“, so<br />
Thulè.<br />
Arbeit gibt es in Tempelhof auch an<br />
anderen Stellen. Beispielsweise in einer<br />
der Großküchen, in denen >><br />
Ausgabe 9 | Mai 2018 | Umweltdialog.de<br />
71
Bauen <strong>und</strong> Wohnen<br />
das Essen gegen einen festen monatlichen<br />
Beitrag für alle Tempelhofer<br />
gekocht wird: „Heute arbeiten bereits<br />
22 Frauen <strong>und</strong> Männer in der Gärtnerei,<br />
im Ackerbau, der Tierhaltung, in<br />
der Käserei, Imkerei, Bäckerei <strong>und</strong><br />
in unserer Kantinenküche – <strong>und</strong> verwirklichen<br />
so eine solidarische Landwirtschaft,<br />
die alle Bewohner ges<strong>und</strong><br />
<strong>und</strong> umfassend ernährt. Weitere 15<br />
Arbeitsplätze entstanden im Seminar-<br />
<strong>und</strong> Gästehaus, dem Energie- <strong>und</strong><br />
Baubereich, der Verwaltung, beim<br />
„Mobilen Wohnen” <strong>und</strong> in der freien<br />
Schule“, so die Tempelhofer. Unabhängig<br />
davon müssen alle Mitglieder<br />
pro Woche mehrere St<strong>und</strong>en Gemeinschaftsdienst<br />
leisten.<br />
Traditionelle Dorftugenden aktiviert<br />
Mit ihrem Konzept knüpfen die Tempelhofer<br />
im Gr<strong>und</strong>e genommen an<br />
klassische Funktionen traditioneller<br />
Dörfer an: „Dorfbewohner haben eine<br />
hohe Kompetenz, lokale Fragen <strong>und</strong><br />
Probleme ehrenamtlich oder genossenschaftlich<br />
anzugehen <strong>und</strong> Verantwortung<br />
für das Gemeinwesen zu<br />
tragen. Selbstverantwortung <strong>und</strong> Anpackkultur<br />
sind im Dorf tief verwurzelt“,<br />
sagt etwa der Humangeograf<br />
Gerhard Henkel. „Insgesamt ist das<br />
vorsorgende Leben <strong>und</strong> Wirtschaften<br />
auf dem Lande stärker verbreitet als<br />
in der Großstadt.“<br />
Neben der Lebensmittelversorgung<br />
<strong>und</strong> der Bereitstellung von Rohstoffen<br />
<strong>und</strong> Naturgütern sind Fürsorglichkeit,<br />
Natur- <strong>und</strong> Menschennähe <strong>und</strong><br />
Gemeinsinn für Henkel alles wichtige<br />
Funktionen <strong>und</strong> Tugenden, die Dörfer<br />
trotz des Urbanisierungstrends für<br />
eine Gesellschaft unverzichtbar machen.<br />
Davon ist auch das Zukunftsinstitut<br />
überzeugt: „Das Dorf hat Zukunft.<br />
Als Landidyll <strong>und</strong> Lieferant für erneuerbare<br />
Energien erlebt das Dorf eine<br />
Renaissance. Künftig wird es wieder<br />
sehr viel enger mit der Stadt vernetzt<br />
sein.“<br />
Städter profitieren<br />
Das trifft auch auf Schloss Tempelhof<br />
zu. Bewohner umliegender Städte wie<br />
Crailsheim oder Dinkelsbühl können<br />
Mitglied in der Solidarischen Landwirtschaft<br />
werden. Dafür erhalten<br />
sie einmal in der Woche an zentralen<br />
Abholstellen eine Gemüsekiste mit<br />
saisonalen, frischen Produkten <strong>und</strong><br />
selbstgebackenem Brot. Wer keine<br />
Lust auf eine feste Mitgliedschaft hat,<br />
kann alternativ im Hofladen der Gemeinschaft<br />
einkaufen, der mehrmals<br />
in der Woche geöffnet hat.<br />
Mit ihrem Angebot bedienen die<br />
Tempelhofer eine Entwicklung, die<br />
künftig weiter zunimmt <strong>und</strong> die vor<br />
allem ges<strong>und</strong>heitsbewusste Städter<br />
überzeugt: der Trend nach nachhaltig<br />
erzeugten Lebensmitteln: „Der<br />
Öko-Landbau bevorzugt Regional- <strong>und</strong><br />
Direktvermarktung <strong>und</strong> zieht damit<br />
Käufer aus den Städten aufs Land. Zudem<br />
ist die Herstellung <strong>und</strong> Verarbeitung<br />
von biologischen Lebensmitteln<br />
aufwendiger als die konventionelle<br />
Produktion“, so das Zukunftsinstitut.<br />
„Dadurch entstehen neue Beschäftigungsmöglichkeiten<br />
auch jenseits<br />
der landwirtschaftlichen Tätigkeiten,<br />
denn Biohöfe entwickeln sich zu kleinen<br />
Knotenpunkten des Austausches,<br />
Lernens <strong>und</strong> nachhaltigen Konsums.“<br />
Andere sollen von ihnen lernen<br />
Damit stößt man bei den Tempelhofern<br />
auf offene Ohren. Die Gemeinschaft<br />
ist unter anderem Mitglied des<br />
Global Ecovillage Network Europe, zu<br />
dem viele verschiedene nachhaltige<br />
Siedlungen <strong>und</strong> Ökodörfer weltweit<br />
gehören. Die Teilnehmer nutzen die<br />
Organisation auch dafür, um Ideen<br />
<strong>und</strong> Informationen auszutauschen<br />
oder beispielsweise Technologien zu<br />
transferieren.<br />
Das deutsche Netzwerk hat das Projekt<br />
„Leben in zukunftsfähigen Dörfern“<br />
initiiert, das die Zusammenarbeit von<br />
Siedlungen aus verschiedenen Regionen<br />
Deutschlands mit einem ansässigen<br />
Ökodorf unterstützt. Auch Tempelhof<br />
nimmt daran teil. Das Projekt<br />
richtet sich an Gemeinden, die etwa<br />
durch soziologische Probleme wie<br />
Abwanderung oder ökologische Probleme<br />
wie den Verlust von Artenvielfalt<br />
betroffen sind. „Die gemeinsame<br />
Kooperation für eine zukunftsfähige<br />
Dorfentwicklung soll es ermöglichen,<br />
übertragbare Erfahrungen zu sammeln<br />
<strong>und</strong> ein methodisches Vorgehen<br />
zu entwickeln, von dem letztlich zahlreiche<br />
weitere ländliche Gemeinden<br />
in vergleichbarer Situation Inspiration<br />
<strong>und</strong> Ermutigung erhalten können“,<br />
so das Netzwerk auf seiner Homepage.<br />
Reallabor für experimentelles<br />
Wohnen<br />
Neue Ideen erproben, Erfahrungen teilen<br />
<strong>und</strong> Wissen zugänglich machen:<br />
Das liegt den Tempelhofern auch<br />
bei einem ganz speziellen Projekt<br />
am Herzen. Eine Gruppe innerhalb<br />
der Gemeinschaft hat 2016 das erste<br />
„Earthship“-Haus in Deutschland fertiggestellt.<br />
Dieses dient r<strong>und</strong> 25 Bewohnern<br />
als Gemeinschaftsgebäude,<br />
in dem sich eine Küche, Waschräume,<br />
sanitäre Anlagen <strong>und</strong> ein Aufenthaltsraum<br />
befinden. Private Rückzugsmög-<br />
72 Ausgabe 9 | Mai 2018 | Umweltdialog.de
Bauen <strong>und</strong> Wohnen<br />
lichkeiten finden die Bewohner in Jurten,<br />
Bauwagen <strong>und</strong> anderen mobilen<br />
Wohneinheiten, die um das Earthship<br />
angeordnet sind.<br />
Wissenschaftlich begleitet, will die<br />
Gemeinschaft durch den Bau einen<br />
Beitrag zur Umweltbildung leisten:<br />
„Gleichzeitig ist es eine ideelle <strong>und</strong><br />
praktische Plattform für Diskussionen<br />
zu Ökologie <strong>und</strong> <strong>Nachhaltig</strong>keit sowie<br />
mögliche zukunftsfähige Lebens- <strong>und</strong><br />
Wohnformen“, so die Tempelhofer.<br />
Doch was macht das Haus so besonders?<br />
Earthship-Gebäude wie in Tempelhof<br />
werden aus bereits benutzten<br />
Materialien wie Autoreifen, Flaschen<br />
oder Getränkedosen in Kombination<br />
mit natürlichen Baustoffen errichtet.<br />
Darüber hinaus sind die Häuser<br />
autark: „Stellt Euch ein Haus vor, das<br />
sich selbst heizt, sein Wasser liefert,<br />
Essen produziert. Es braucht keine<br />
teure Technologie, recycelt seinen eigenen<br />
Abfall, hat seine Energiequelle.<br />
Es kann überall von jedem gebaut werden,<br />
aus Dingen, die die Gesellschaft<br />
wegwirft“, beschreibt der US-Amerikaner<br />
Michael Reynolds das Konzept,<br />
das er vor 40 Jahren erf<strong>und</strong>en hat <strong>und</strong><br />
dessen Nachbau er weltweit begleitet.<br />
Und so funktioniert es<br />
In der Theorie funktionieren die Häuser<br />
immer nach denselben Prinzipien.<br />
Dazu gehören etwa die Stromerzeugung<br />
mittels Windkraft oder Fotovoltaik,<br />
das hausinterne Anpflanzen von<br />
Obst <strong>und</strong> Gemüse oder das Sammeln<br />
von Regenwasser über die Dachoberfläche,<br />
das danach in Zisternen gespeichert<br />
wird. In der Praxis müssen<br />
die Funktionen natürlich an die jeweiligen<br />
klimatischen Verhältnisse <strong>und</strong><br />
an das nationale Recht angepasst werden.<br />
So dürfen etwa die Tempelhofer<br />
in Deutschland das gesammelte Wasser<br />
nur für die Beete, die Waschmaschine<br />
<strong>und</strong> die Toilette nutzen. Es zu<br />
trinken, ist hingegen nicht erlaubt. f<br />
Foto: „earthship-construction9“<br />
von Jenny Parkins unter CC-BY-2.0<br />
Foto: „earthship-exterior32“<br />
von Jenny Parkins unter CC-BY-2.0<br />
Foto: „earthship-interior27“<br />
von Jenny Parkins unter CC-BY-2.0<br />
Bauweisen von „Earthship“-Häusern<br />
Ausgabe 9 | Mai 2018 | Umweltdialog.de<br />
73
Bauen <strong>und</strong> Wohnen<br />
Wer will schon ins Altersheim?<br />
Der demografische Wandel wird alle Bereiche<br />
unserer Gesellschaft erfassen. Schon<br />
jetzt gibt es in Deutschland r<strong>und</strong> 17 Millionen<br />
Menschen, die mindestens 65 Jahre alt sind.<br />
Tendenz steigend, wie das statistische B<strong>und</strong>esamt<br />
informiert. Das erfordert Infrastrukturen,<br />
die den öffentlichen Raum, den Nahverkehr<br />
<strong>und</strong> das Wohnen neu gestalten <strong>und</strong> an<br />
die Bedürfnisse von Senioren anpassen.<br />
Foto: Halfpoint / stock.adobe.com<br />
Man ist so alt, wie man sich fühlt. Und viele ältere Menschen<br />
fühlen sich eindeutig jünger, als sie tatsächlich<br />
sind. Eigenen Angaben zufolge führt die Mehrheit der über<br />
65-jährigen auch entsprechend dazu ein abwechslungsreiches,<br />
mobiles <strong>und</strong> aktives Leben. Zu diesen Ergebnissen<br />
kommt die aktuelle Altersstudie des Versicherers Generali.<br />
Die Selbstwahrnehmung der Senioren passt allerdings<br />
nicht zu unserem gesellschaftlichen Bild, das wir über das<br />
Altern haben. Dieses fokussiert sich immer noch auf <strong>Themen</strong><br />
wie Pflege <strong>und</strong> Hilfsbedürftigkeit: „Es darf nicht mehr<br />
bloß darum gehen, alte Menschen zu versorgen. Vielmehr<br />
brauchen wir Strukturen, in denen Menschen zugleich Sorge<br />
empfangen <strong>und</strong> Sorge tragen können“, sagt etwa Professor<br />
Andreas Kruse von der Universität Heidelberg.<br />
Ein Design für alle<br />
Im Bereich Bauen <strong>und</strong> Wohnen gehören dazu beispielsweise<br />
das Konzept des betreuten Wohnens, Mehrgenerationenwohnprojekte<br />
oder Alters-WGs, die bei Senioren immer<br />
beliebter werden: „In unserer künftigen Pro-Aging-Gesellschaft<br />
sind Begriffe wie ‚altersgerecht‘, ‚Seniorenresidenz‘<br />
oder gar ‚Altersheim‘ weitgehend aus dem Sprachgebrauch<br />
verschw<strong>und</strong>en“, informiert etwa das Zukunftsinstitut. Das<br />
sei einerseits das Ergebnis des „Downaging“, also der länger<br />
anhaltenden Fitness <strong>und</strong> Vitalität bei höherer Lebensdauer,<br />
<strong>und</strong> andererseits auch die Folge von neuen Konzepten,<br />
die es Menschen ermöglichen, lange in den eigenen<br />
vier Wänden zu leben.<br />
Wie das geht, zeigen Ageless- <strong>und</strong> Universal-Design-Ansätze.<br />
Diese gestalten Produkte, Umgebungen <strong>und</strong> Systeme<br />
so, dass möglichst viele Menschen sie ohne zusätzliche<br />
Anpassungen nutzen können: „Ein wesentlicher Aspekt<br />
dabei ist, dass Barrierefreiheit <strong>und</strong> Ästhetik nicht länger<br />
als Gegensätze voneinander koexistieren. Fortschritte<br />
im Bereich Ambient Assisted Living (AAL) befördern als<br />
Gestaltungsprinzip von elektronischen Produkten bis<br />
hin zu Dienstleistungen immer stärker den Trend zu einem<br />
selbstbestimmten Leben im Alter“, so das Zukunftsinstitut.<br />
Ambient Assisted Living<br />
Altersgerechte Assistenzsysteme nutzen moderne<br />
Kommunikations- <strong>und</strong> Informationstechnologien, um<br />
den Alltag von Senioren <strong>und</strong> beeinträchtigten Menschen<br />
sicherer <strong>und</strong> angenehmer zu gestalten. Dabei<br />
passt sich die Technik zwingend den Bedürfnissen der<br />
Menschen an <strong>und</strong> nicht umgekehrt.<br />
Beispiele hierfür sind smarte Funktionen, die den Herd<br />
<strong>und</strong> elektronische Geräte automatisch abschalten oder<br />
die Raumtemperatur <strong>und</strong> Beleuchtung selbstständig<br />
steuern.<br />
74 Ausgabe 9 | Mai 2018 | Umweltdialog.de
Bauen <strong>und</strong> Wohnen<br />
Wie die Bewohner die sozialen <strong>und</strong> ambulanten Dienste<br />
in den Wohnquartieren nutzen, analysieren zurzeit Pflegewissenschaftler<br />
der Universität Bielefeld, wie die Neue<br />
Westfälische berichtet. Dafür begleiten <strong>und</strong> befragen die<br />
Experten über zwei Jahre 50 Mieter <strong>und</strong> interviewen darüber<br />
hinaus Mitarbeiter <strong>und</strong> Dienstleister. Ziel ist es, die<br />
Stärken <strong>und</strong> Schwächen des Bielefelder Modells zu identifizieren<br />
<strong>und</strong> Erkenntnisse zu sammeln, inwiefern der Ansatz<br />
weiter auf andere Städte übertragbar ist. f<br />
„Bullerbü“ für Senioren<br />
Bosau ist eine 700-Seelen-Gemeinde am Plöner See,<br />
unweit der Ostseeinsel Fehmarn. Auf einer Fläche von<br />
rd. 50.000 Quadratmetern entsteht derzeit das Seniorendorf<br />
„Uhlenbusch“. Die kleine Ökosiedlung wird<br />
aus 30 Wohnhäusern <strong>und</strong> mehreren Gemeinschaftsgebäuden<br />
bestehen. Außerdem wird es in dem Dorf<br />
einen kleinen Laden geben, ein Wasch- <strong>und</strong> Badehaus<br />
<strong>und</strong> Werkstätten für Holz- <strong>und</strong> Metallarbeiten.<br />
Zusätzlich bewirtschaftet die Dorfgemeinschaft eine<br />
große Gartenfläche <strong>und</strong> hält auf einer Weide Hühner<br />
<strong>und</strong> Schafe.<br />
Bielefeld zeigt, wie es geht<br />
Und dieses spielt sich künftig auch für alte Menschen<br />
hauptsächlich in der Stadt ab. Deswegen ist es umso wichtiger,<br />
dass eine moderne Quartiersgestaltung diese Ansätze<br />
aufgreift. Vorbildcharakter hat hier die Stadt Bielefeld mit<br />
dem „Bielefelder Modell“, das b<strong>und</strong>esweit kopiert wird. Das<br />
Besondere: In fast allen Stadtteilen können Menschen barrierefreie<br />
Wohnungen in Wohnanlagen mieten, in denen<br />
ein sozialer Dienstleister 24 St<strong>und</strong>en am Tag erreichbar<br />
ist. Die Hilfs- <strong>und</strong> Betreuungsangebote können alle Mieter<br />
nutzen; bezahlt wird nur das, was wirklich in Anspruch genommen<br />
wird, so die Bielefelder Gesellschaft für Wohnen<br />
<strong>und</strong> Immobiliendienstleistungen (BGW), die das Modell initiiert<br />
hat.<br />
Integriert in die bestehende Wohnumgebung <strong>und</strong> mit guter<br />
infrastruktureller Anbindung, sollen hier nicht nur alte,<br />
sondern auch Menschen mit Behinderungen Raum finden.<br />
„Aber nicht nur für diese Personengruppen, sondern<br />
übergreifend für alle, haben Wohnsituationen <strong>und</strong> Nachbarschaft<br />
einen entscheidenden Einfluss auf die Lebensqualität<br />
im Alltag“, sagt die BGW. „Die Anforderungen an<br />
die Quartiersentwicklung sind damit hoch. Wohnquartiere<br />
müssen mehr <strong>und</strong> mehr generationengerecht, kultursensibel<br />
<strong>und</strong> inklusiv sein.“<br />
Die Vision der Initiatoren Caroline <strong>und</strong> Ulrich Reimann:<br />
aktiv <strong>und</strong> selbstbestimmt alt werden, gemeinsam<br />
mit anderen. „Der Uhlenbusch ist ein Konzept<br />
– an diesem Ort werden vorwiegend Menschen wohnen,<br />
die ihre Lebensarbeitszeit hinter sich haben. Sie<br />
werden hier ein selbstbestimmtes Leben führen – mit<br />
gegenseitiger Hilfe <strong>und</strong> vielen, ganz unterschiedlichen<br />
Aktivitäten. Naturnah, ökologisch, umweltfre<strong>und</strong>lich<br />
<strong>und</strong> weitgehend energieautark“, liest man auf der<br />
Homepage des Seniorendorfes. Anfang September<br />
2017 standen bereits 15 der 30 Wohneinheiten. Mitte<br />
2018 soll die Siedlung fertiggestellt werden. Dann<br />
stehen auf dem Gr<strong>und</strong>stück 60 bis 70 Quadratmeter<br />
große Reihenhäuser sowie 90 Quadratmeter große<br />
freistehende Gebäude <strong>und</strong> Doppelhäuser.<br />
Die Häuser im Uhlenbusch wurden barrierefrei gebaut<br />
<strong>und</strong> besonders nachhaltig konzipiert. Sie kommen<br />
weitestgehend ohne Baustoffe mit chemischen<br />
Zusätzen aus. Ihre Beheizungs- <strong>und</strong> Haushaltsstromversorgung<br />
beziehen sie hauptsächlich durch<br />
eigens produzierten Strom aus Fotovoltaikanlagen.<br />
Die Nutzung von Erdöl ist in der Siedlung tabu. „Der<br />
wirtschaftliche <strong>und</strong> soziale Wandel in unserer Zeit<br />
macht es erforderlich, unseren bisherigen Lebensstil<br />
zu hinterfragen. Aufgr<strong>und</strong> knapper Ressourcen in<br />
so gut wie jedem Bereich müssen neue Formen <strong>und</strong><br />
Konzepte des Zusammenlebens gef<strong>und</strong>en werden –<br />
insbesondere für das Alter“.<br />
Ausgabe 9 | Mai 2018 | Umweltdialog.de<br />
75
Bauen <strong>und</strong> Wohnen<br />
(Gem)einsam<br />
alt werden?<br />
Der Pflegenotstand ist jetzt<br />
auch in der öffentlichen Diskussion<br />
angekommen: Junge<br />
Pfleger malen in Talkshows<br />
Horrorszenarien vom Alltag<br />
auf Station <strong>und</strong> in den Heimen.<br />
Überlastet <strong>und</strong> ausgebrannt<br />
sind die wenigen<br />
Idealisten, die es trotz Überforderung<br />
<strong>und</strong> unzureichender<br />
Bezahlung noch in der<br />
Pflege hält. Dunkle Zeiten für<br />
eine zusehends überalternde<br />
Gesellschaft? UmweltDialog<br />
hat sich außerhalb des Pflegeheims<br />
nach alternativen<br />
Wohnkonzepten umgesehen.<br />
Von Lucas Beesten<br />
„Ich finde es wichtig, dass ich weiß:<br />
Wenn es mir mal schlecht geht, ist jemand<br />
da. Und lässt mich nicht einfach<br />
liegen.“ Lambertus Kleine Stegemann<br />
blickt ernst in die Kamera der Lokalzeit,<br />
als er die Worte spricht. Als Rentner<br />
ist er direkt betroffen von der Debatte,<br />
die seit Monaten Deutschland<br />
beschäftigt. Und zusammen mit dem<br />
Verein „Leben in der Nachbarschaft“<br />
(LiNa) hat er seine eigene Antwort auf<br />
die Frage nach einem würdevollen Altern<br />
gef<strong>und</strong>en.<br />
76 Ausgabe 9 | Mai 2018 | Umweltdialog.de<br />
Foto: WavebreakmediaMicro / fotolia.com
Bauen <strong>und</strong> Wohnen<br />
Stegemann wohnt mit seiner Frau<br />
<strong>und</strong> 24 anderen Senioren in einer<br />
Senioren-Genossenschaft in Haltern<br />
am See. Der Clou: Zwar leben die Bewohner<br />
in 18 getrennten Wohnungen.<br />
Diese befinden sich aber alle in einem<br />
zentralen Haus mit zusätzlichen Gemeinschaftsräumen.<br />
Im Mittelpunkt<br />
steht das Zusammenleben <strong>und</strong> Miteinander.<br />
Jeder steuert bei, was er<br />
kann: Die Bewohner unterstützen sich<br />
gegenseitig bei anfallenden Reparaturen<br />
oder im Haushalt. Die Fassade des<br />
Hauses muss erneuert werden? Wer<br />
Zeit hat, beteiligt sich an Diskussion<br />
<strong>und</strong> Bewältigung der Aufgabe. Aber<br />
auch Freizeitaktivitäten <strong>und</strong> Ausflüge<br />
planen die Genossen gemeinschaftlich.<br />
Angst vor Vereinsamung hat in<br />
dieser Gemeinschaft niemand.<br />
Damit das Projekt kein Einzelfall<br />
bleibt, geht das Land NRW die Herausforderungen<br />
des demografischen<br />
Wandels mit seiner <strong>Nachhaltig</strong>keitsstrategie<br />
an <strong>und</strong> fördert eine altersgerechte<br />
Stadt- <strong>und</strong> Quartiersentwicklung.<br />
Die Senioren-WG<br />
Noch näher kommen sich die Bewohner<br />
einer Senioren-Wohngemeinschaft.<br />
Ähnlich wie in der Genossenschaft<br />
steht hier das Miteinander<br />
im Vordergr<strong>und</strong>; der Anteil des gemeinschaftlichen<br />
Wohnbereichs ist<br />
allerdings noch größer. Esszimmer,<br />
Badezimmer <strong>und</strong> Küche sind Gemeinschafträume<br />
für alle. So engagiert die<br />
Bewohner im Zusammenleben auch<br />
sind: Je nach Krankenakte ist natürlich<br />
trotzdem professionelle Pflege <strong>und</strong><br />
medizinische Versorgung vonnöten.<br />
Deshalb unterstützen bei Bedarf z.B.<br />
Diakoniestationen die Wohngemeinschaften<br />
mit zusätzlicher Pflege <strong>und</strong><br />
Betreuungsangeboten. Das hat seinen<br />
Preis: Neben Miete <strong>und</strong> Nebenkosten<br />
kommen Pauschalen für Küche,<br />
Waschküche, Renovierungs-Rücklagen,<br />
Reinigung, Haushaltsgeld <strong>und</strong><br />
eben Betreuungspauschale hinzu.<br />
Über 2.000 Euro monatlich kann das<br />
einen Bewohner kosten. Wer später<br />
mal in einer WG alt werden möchte,<br />
sollte also zeitig mit dem Sparen anfangen.<br />
Künstler unter sich<br />
Trotz aller Unkenrufe – auch in der<br />
konventionelleren Pflege ist längst<br />
nicht alles schlecht. In Weimar wurde<br />
ein Seniorenstift der besonderen Art<br />
geschaffen: In der Marie-Seebach-Stiftung<br />
verbringen zum Großteil Kulturschaffende<br />
ihren Lebensabend. 25 Prozent<br />
der Bewohner sind pensionierte<br />
Künstler, Maler <strong>und</strong> Schauspieler.<br />
Die Bewohner schwelgen dabei nicht<br />
bloß in Erinnerungen an ihre kreative<br />
Vergangenheit: Konzerte, Theateraufführungen,<br />
Lesungen, Literaturgottesdienste<br />
<strong>und</strong> Gesprächsr<strong>und</strong>en sind<br />
fester Bestandteil des Programms im<br />
Seniorenstift. „Unterhaltungsprogramme<br />
<strong>und</strong> Kaffeetrinken alleine reichen<br />
vielen nicht. Was wir brauchen,<br />
sind Angebote, die ihren unterschiedlichen<br />
Interessen, Bedürfnissen <strong>und</strong><br />
kulturellen Erfahrungen Rechnung<br />
tragen“, sagt Diplom-Pädagogin Dr.<br />
Kim de Groote gegenüber dem PROconcept-Magazin.<br />
Ein großer Vorteil der gemeinschaftlichen<br />
Einrichtung: Die Logistik übernimmt<br />
die Hausverwaltung. Egal ob<br />
putzen, spülen oder waschen, die Bewohner<br />
sind von hauswirtschaftlichen<br />
Aufgaben befreit. Damit das funktioniert,<br />
braucht es Geräte, die für eine<br />
solche Nutzlast ausgelegt sind <strong>und</strong><br />
den besonderen hygienischen Anforderungen<br />
in einem Pflegeheim entsprechen.<br />
Der Hersteller Miele bietet<br />
Produkte, die speziell an die Bedürfnisse<br />
von Heimbewohnern angepasst<br />
sind. Die Gewerbegeschirrspüler des<br />
Traditionsunternehmens reinigen das<br />
Geschirr mittels hoher Temperaturen<br />
<strong>und</strong> Desinfektionsprogrammen besonders<br />
gründlich von Keimen.<br />
Das neue Testverfahren „PRO-Hygiene“<br />
nimmt die Keimfreiheit in den<br />
Wäschereien noch genauer in den<br />
Blick: Mit dem Verfahren prüft der<br />
Miele-K<strong>und</strong>endienst bei der Wartung<br />
der Waschmaschinen, wie effizient<br />
Waschmittel <strong>und</strong> -verfahren zusammenwirken<br />
<strong>und</strong> kann die Zusammenstellung<br />
so genau anpassen.<br />
Smarte Technologie für den<br />
Einzelnen<br />
Nicht jedem liegt das Altwerden in<br />
der Gemeinschaft. Eine neue Technologie<br />
kann hier Abhilfe schaffen:<br />
LiNX 3D heißt das erste smarte Hörgerät<br />
für das iPhone. In einer Kooperation<br />
von ReSo<strong>und</strong> GN <strong>und</strong> Miele<br />
entwickelt, soll LiNX 3D Haushaltsgeräte<br />
mit einem Hörgerät verbinden.<br />
Statusmeldungen <strong>und</strong> Hinweise der<br />
Haushaltsgeräte können so direkt<br />
in die Gehörgänge der Benutzer gestreamt<br />
werden. „Neben Meldungen<br />
könnten zukünftig auch Warnhinweise<br />
– etwa ‚Gefrierschranktür steht offen‘<br />
– oder Zubereitungshinweise wie<br />
‚Bitte Spargel einschieben‘ übertragen<br />
werden“, sagt ReSo<strong>und</strong> Deutschland<br />
Geschäftsführer Joachim Gast<br />
gegenüber dem Presseportal. Smarte<br />
Technologie wird zukünftig also auch<br />
dazu beitragen, dass sich alleinlebende<br />
Senioren nicht allein gelassen fühlen<br />
müssen. f<br />
Ausgabe 9 | Mai 2018 | Umweltdialog.de<br />
77
Bauen <strong>und</strong> Wohnen<br />
Es kommt<br />
Leben in die<br />
Das ist der Moment, vor dem sich jeder Hausbesitzer fürchtet: Schimmel in den eigenen vier<br />
Wänden. Mikroorganismen wie Pilze <strong>und</strong> Bakterienkulturen haben beim Wohnungsbau oder gar<br />
im Haushalt nichts zu suchen, gelten als Zeichen mangelnder Hygiene. Bis jetzt. Unser Bild der<br />
winzigen Lebewesen könnte sich in den nächsten Jahren radikal verändern.<br />
Für viele Menschen ist Keimfreiheit ein Synonym für<br />
Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> Sauberkeit. Dabei sind bei Weitem<br />
nicht alle Mikroorganismen ges<strong>und</strong>heitsschädlich,<br />
viele sogar überlebenswichtig. Obwohl Forscher schon seit<br />
über 300 Jahren Bakterien beschreiben <strong>und</strong> katalogisieren,<br />
sind wahrscheinlich nicht einmal 95 Prozent aller existierenden<br />
Arten bekannt. Kreative in Kunst <strong>und</strong> Architektur<br />
haben jetzt das Potenzial der verrufenen Lebewesen erkannt.<br />
Dabei ist die Verbindung von Natur <strong>und</strong> Architektur gar<br />
nicht neu. Bereits nach dem ersten Weltkrieg strebten progressive<br />
Architekten wie Hugo Häring oder Hans Scharoun<br />
nach Harmonie zwischen Gebäude <strong>und</strong> Natur. Für ihre Bauten<br />
verwendeten sie größtenteils natürliche Baumaterialien.<br />
Die hier vorgestellten Projekte stehen damit im Geiste<br />
dieser organischen Architektur <strong>und</strong> führen das Konzept<br />
konsequent fort.<br />
Abfall als wertvoller Rohstoff<br />
Warum nicht den Gasherd <strong>und</strong> die Heizung mit Abfall betreiben?<br />
Was auf den ersten Blick abwegig scheint, ist das<br />
erklärte Ziel von Philips Design. Mit dem „Microbial Home“<br />
stellen die Designer ein visionäres, geschlossenes Wohnkonzept<br />
vor. Bakterien zersetzen hier Abfälle zu Biogas.<br />
Das modular aufgebaute System nutzt dieses anschließend<br />
als Energiequelle. Der Begriff „Müll“ verliert seine Bedeutung,<br />
wenn Abfall als Rohstoff begriffen wird: Es ist die<br />
Vision der vollendeten Kreislaufwirtschaft in den eigenen<br />
vier Wänden.<br />
Mit dem „Paternoster“ als integriertes Modul ist das System<br />
nicht nur auf biologischen Abfall beschränkt. Die Upcycling-Maschine<br />
soll Kunststoffabfälle mithilfe von Enzymen<br />
zersetzen. Als Produkt entstehen essbare Pilze.<br />
Ebenfalls in das System integriert sind ein urbaner Bienenstock,<br />
leuchtende Bakterien in den Lampen <strong>und</strong> Was-<br />
78 Ausgabe 9 | Mai 2018 | Umweltdialog.de
Bauen <strong>und</strong> Wohnen<br />
serfilter in den Sanitäranlagen. Selbst<br />
Exkremente könnten so nach den Vorstellungen<br />
der Designer als Nähr- <strong>und</strong><br />
Rohstoff für die Bakterien dienen.<br />
Gezüchtete Häuser aus<br />
genmanipulierten Bäumen<br />
Eine ähnliche, aber noch radikalere<br />
Idee verfolgt Mitchell Joachim. Der<br />
promovierte Architekt forscht seit Jahren<br />
an nachhaltiger Architektur <strong>und</strong><br />
entwickelte die Vision des „Fab Tree<br />
Hab“: Aus gentechnisch veränderten<br />
Bäumen sollen „gezüchtete“ Häuser<br />
entstehen, die in einer symbiotischen<br />
Beziehung zu ihrer Umwelt stehen.<br />
Dabei produziert ein Fab Tree Hab<br />
während seines gesamten Lebenszyklus<br />
Nahrung für seine Bewohner.<br />
Auch hier entsteht kein Abfall oder<br />
Abwasser im klassischen Sinne, alles<br />
findet im geschlossenen Kreislauf<br />
Simulationen: Mitchell Joachim, Terreform ONE<br />
Ausgabe 9 | Mai 2018 | Umweltdialog.de<br />
Foto: Courtesy of Phil Ross & Workshop Residence<br />
zwischen Ökosystem <strong>und</strong> Haus seine<br />
(Wieder-)Verwendung.<br />
Das klingt stark nach Science-Fiction.<br />
Joachim selbst scheut diesen<br />
Vergleich aber nicht. Gegenüber dem<br />
Zukunftsinstitut sagte er: „Die Ideen,<br />
die wir vorbringen, basieren auf bereits<br />
serienmäßig existierenden Technologien.<br />
Wir ändern nur die Lösungsgr<strong>und</strong>lage<br />
<strong>und</strong> tun Dinge, die nicht<br />
immer offensichtlich sind. Wir haben<br />
kein Problem damit, über Science-Fiction<br />
nachzudenken – wir begrüßen es<br />
sogar.“ Noch sind allerdings nicht alle<br />
für das Projekt benötigten Technologien<br />
ausgereift. Beispielsweise fehlen<br />
organische Fenster. Deshalb wird es<br />
wohl noch eine Weile dauern, bis der<br />
visionäre Architekt dem ersten Fab<br />
Tree Hab den Lebensfunken einhauchen<br />
kann.<br />
Kreativ mit Pilzen<br />
Bodenständiger geht es in den Werkräumen<br />
des Künstlers Philipp Ross<br />
zu. Der ehemalige Küchenchef hat<br />
während seiner Arbeit am Herd die<br />
Liebe zu Speisepilzen entdeckt <strong>und</strong><br />
nutzt sie jetzt als Rohstoff für Möbelstücke<br />
<strong>und</strong> Skulpturen. Der Vorteil:<br />
Im Gegensatz zu Baumaterialien wie<br />
Beton bleiben Pilze über einen längeren<br />
Zeitraum formbar, sind hitze- <strong>und</strong><br />
lichtempfindlich.<br />
Die jahrelange Arbeit mit dem exotischen<br />
Material hat allerdings auch den<br />
gebürtigen New Yorker zu visionärem<br />
Denken beflügelt: In seinem Projekt<br />
„Mycotecture“ soll ein komplettes Gebäude<br />
aus Speisepilzen gezüchtet <strong>und</strong><br />
errichtet werden. „Wir können jetzt<br />
schon in zwei Wochen eine Menge an<br />
Lederersatzstoff aus Pilzen züchten,<br />
für die man in der Massentierhaltung<br />
zwei Jahre bräuchte. Und dabei benötigen<br />
Pilze nur Abfall als Nährstoff.<br />
Sie sind der Rohstoff der Zukunft“,<br />
Oben: Die Vision des „Fab Tree Hab“<br />
Unten: Aus Speisepilzen gezüchteter<br />
Stuhl<br />
Foto: Susana Cámara Leret<br />
Die „Latro Algen Lampe“<br />
sagt Ross in einem Video auf seiner<br />
Internetseite.<br />
Das Algen-Kraftwerk<br />
Geht es nach den Vorstellungen des<br />
Designers Mike Thompson, werden<br />
Algen zukünftig als Energiequelle dienen.<br />
Der Engländer entwickelte das<br />
Konzept der „Latro Algen Lampe“: In<br />
einer Hängelampe befindliche Algen<br />
betreiben Fotosynthese <strong>und</strong> produzieren<br />
Strom, der in einer Batterie<br />
gespeichert wird. Das benötigte CO 2<br />
stammt dabei aus der Atemluft, die<br />
über ein M<strong>und</strong>stück zugeführt wird.<br />
Vorerst bleibt das Algen-Kraftwerk<br />
aber ebenfalls noch Zukunftsmusik.<br />
Das schreckt die Pioniere des organischen<br />
Designs aber nicht davor ab,<br />
ihre futuristischen Ideen zu verfolgen.<br />
Schließlich hat Hermann Hesse einmal<br />
bemerkt: „Man muss das Unmögliche<br />
versuchen, um das Mögliche zu<br />
erreichen.“ f<br />
79
Bauen <strong>und</strong> Wohnen<br />
Holland<br />
in Not<br />
Aquakulturen gezüchtet werden. Die<br />
Nährstoffe erhalten die Algen von Abwässern,<br />
die vom Festland ins Meer<br />
gelangen – <strong>und</strong> filtern so ganz nebenbei<br />
das Wasser.<br />
Simulation: Blue21<br />
Von Julia Arendt<br />
Die Menschen des 21. Jahrh<strong>und</strong>erts<br />
zieht es in die Städte.<br />
Prognosen zufolge soll der Bevölkerungsanteil<br />
dort im Jahr 2050<br />
bei 70 Prozent liegen – derzeit beträgt<br />
er etwas mehr als 50 Prozent. Den<br />
größten Andrang werden die kleineren<br />
<strong>und</strong> mittelgroßen Orte mit bis zu<br />
fünf Millionen Einwohnern erleben.<br />
Das stellt Städteplaner <strong>und</strong> Ingenieure<br />
vor gewaltige Herausforderungen.<br />
Genügend Wohn- <strong>und</strong> Arbeitsraum<br />
muss her. Dieser soll den Bewohnern<br />
nicht nur eine hohe Lebensqualität<br />
bieten – gleichzeitig sollen Luftverschmutzung<br />
<strong>und</strong> die Auswirkungen<br />
des Klimawandels verringert werden.<br />
Es wird also höchste Zeit, die nachhaltige<br />
Stadtentwicklung der Zukunft<br />
im Blick zu haben.<br />
Küstenstädte lernen schwimmen<br />
Der Klimawandel hat weitreichende<br />
Folgen. So rechnen Forscher damit,<br />
dass etwa der Meeresspiegel durch<br />
Polar- <strong>und</strong> Gletscherschmelze bis zum<br />
Jahr 2100 stellenweise bis zwei Meter<br />
ansteigen wird. Das niederländische<br />
Unternehmen „Blue21“ hat dafür die<br />
Zukunftslösung: Es entwickelt Baukonzepte,<br />
wie Küstenstädte sich etwa<br />
auf dem Meer über schwimmende<br />
Plattformen ausdehnen können. Die<br />
Vision des Projekts: die schwimmenden<br />
Städte stehen in enger Verbindung<br />
mit dem Festland <strong>und</strong> bilden<br />
eine Symbiose. Sie versorgen sich<br />
selbstständig mit Energie, <strong>und</strong> als<br />
Nahrungsquelle sollen den Menschen<br />
Algen dienen, die über Hydro- <strong>und</strong><br />
Ein solches Konzept klingt sehr futuristisch,<br />
wird aber nötig sein: Die<br />
Macher von Blue21 haben errechnet,<br />
dass die fortschreitende Umweltzerstörung,<br />
die wachsende Weltbevölkerung<br />
<strong>und</strong> der steigende Bedarf an<br />
Lebensmitteln dazu führen wird, dass<br />
im Jahr 2050 zwischen 13 Millionen<br />
<strong>und</strong> 36 Millionen Quadratkilometer<br />
bewohnbares Land fehlen. Was also<br />
tun? Ihr Vorschlag sieht die Verlagerung<br />
eines Teils der Produktion von<br />
Nahrungsmitteln <strong>und</strong> Biokraftstoffen<br />
aufs Wasser vor. Zwischen 2,4 <strong>und</strong> 5,4<br />
Millionen Quadratkilometer schwimmende<br />
Urbanisation auf dem Meer,<br />
könnten den erwarteten Mangel an<br />
Landfläche lindern helfen.<br />
Ein Kuhstall auf dem Wasser<br />
Die Niederländer pflegen eine Beziehung<br />
zum Wasser, die weltweit seinesgleichen<br />
sucht. Ein Viertel des Landes<br />
liegt unterhalb des Meeresspiegels;<br />
95 Prozent aller Polder Europas sind<br />
dort zu finden. Wer etwa vor 150 Jahren<br />
das Gebiet des heutigen Amsterdamer<br />
Flughafens Schiphol besucht<br />
hätte, wäre ohne Boot aufgeschmissen<br />
gewesen. Wenn in Schipohl <strong>und</strong> an<br />
allen anderen tief liegenden Regionen<br />
nicht ständig Wasser abgepumpt<br />
<strong>und</strong> die Küsten nicht ständig mit Sand<br />
aufgeschüttet würden, läge die niederländische<br />
Küste 60 Kilometer weiter<br />
östlich, so die Universität Münster.<br />
80 Ausgabe 9 | Mai 2018 | Umweltdialog.de
Bauen <strong>und</strong> Wohnen<br />
Simulation: BELADON<br />
Die Floating Farm ermöglicht einen geschlossenen<br />
Kreislauf von Wasser, Energie <strong>und</strong> Abfall.<br />
Die Niederländer wissen aber nicht nur, wie man dem<br />
Meer durch mächtige Deiche <strong>und</strong> Entwässerungssysteme<br />
Land abtrotzt. Sie haben auch gelernt, auf dem Wasser<br />
zu leben. Mit Hausbooten <strong>und</strong> schwimmenden Häusern<br />
beispielsweise. Der neueste Ansatz geht aber noch einen<br />
Schritt weiter: Künftig sollen Kühe auf einer riesigen Potonfläche<br />
im Hafen von Rotterdam ihre Heimat haben; in<br />
einem schwimmenden Hightech-Kuhstall. Zweigeschossig,<br />
sollen beim Projekt „Floating Farm“ bis zu 40 Kühe im ersten<br />
Stock Platz finden <strong>und</strong> täglich mehrere 100 Liter Milch<br />
geben. Im Untergeschoss sind Gewächshäuser zur Futtermittelproduktion<br />
<strong>und</strong> eine Molkerei vorgesehen, in der die<br />
Milch weiterverarbeitet wird.<br />
Die Idee dahinter: Da viele alte Hafenbecken mittlerweile<br />
zu klein für große Containerschiffe sind, soll der ungenutzte<br />
Raum eine neue Bestimmung bekommen <strong>und</strong> in Zeiten<br />
knapp werdender Flächen sollen dort lokal frische Lebensmittel<br />
erzeugt werden, wo viele Menschen leben. f<br />
Forscher wollen Städte aus Vulkanasche <strong>bauen</strong><br />
Mischung aus Beton <strong>und</strong> Gesteinspulver reduziert Energiebedarf<br />
Forscher des Massachusetts Institute of Technology<br />
(MIT) haben gemeinsam mit Kollegen der Kuwait Fo<strong>und</strong>ation<br />
for the Advancement of Science ein Pilotprojekt<br />
gestartet, um Gebäude <strong>und</strong> ganze Stadtteile in Zukunft<br />
aus einer Mischung aus herkömmlichem Beton <strong>und</strong> Vulkanasche<br />
zu <strong>bauen</strong>. Die Vorteile: Das fein pulverisierte<br />
Vulkangestein kommt in der Natur häufig vor, kann bei<br />
kleinerer Partikelgröße die Materialstärke verbessern<br />
<strong>und</strong> reduziert den Energiebedarf.<br />
Partikelgröße entscheidend<br />
„Indem wir einen gewissen Prozentsatz des traditionellen<br />
Betons durch Vulkanasche ersetzen, können wir<br />
den Energieaufwand, der nötig ist, um dieses Material<br />
herzustellen, auf signifikante Weise reduzieren“, zitiert<br />
„TechXplore“ Oral Buyukozturk vom Department of Civil<br />
and Environmental Engineering des MIT. So konnte<br />
etwa bei einem Modellversuch in Kuwait-Stadt gezeigt<br />
werden, dass sich bei einem Stadtteil mit 26 Gebäuden<br />
eine Energieersparnis von 16 Prozent ergibt, wenn man<br />
bei dessen Errichtung anstatt des normalen Betons ein<br />
50:50-Gemisch aus Beton <strong>und</strong> Vulkanasche verwendet.<br />
Je nachdem, wie fein das vulkanische Gestein pulverisiert<br />
wird, kann eine Beigabe dieses natürlich vorkommenden<br />
Stoffes zudem dazu führen, dass sich die<br />
Stärke des dadurch gewonnenen Materials verbessert.<br />
„Wenn man das Gestein bis auf eine Partikelgröße<br />
von sechs Mikrometern zermahlt, steigert das die<br />
Härte, wirkt sich aber auch auf den Energieaufwand<br />
aus“, erläutert Buyukozturk. Die oben angegebenen 16<br />
Prozent Energieersparnis lassen sich nämlich nur bei<br />
einer Partikelgröße von 17 Mikrometern erreichen. „Man<br />
kann das anpassen, wie man es haben möchte“, so der<br />
MIT-Forscher.<br />
Ziel: CO 2<br />
-Emissionen senken<br />
Laut Buyukozturk <strong>und</strong> seinen Kollegen ist Beton nach<br />
Wasser das am häufigsten verwendete Material auf der<br />
Welt. Die Energiebilanz seiner Herstellung ist allerdings<br />
nicht wirklich nachhaltig: Zuerst müssen größere Gesteinsbrocken<br />
wie etwa Kalkstein aus Steinbrüchen herausgesprengt<br />
werden, dann müssen diese Brocken zu<br />
Mühlen transportiert werden, wo sie zerkleinert werden,<br />
um anschließend unter hohen Temperaturen verschiedene<br />
Prozesse über sich ergehen zu lassen.<br />
„Solch eine energieintensive Herstellung erzeugt einen<br />
deutlich spürbaren ökologischen Fußabdruck. Auf<br />
die Produktion von herkömmlichem Zement entfallen<br />
weltweit gerechnet r<strong>und</strong> fünf Prozent der Kohlendioxidemissionen.<br />
Ziel unseres Projektes ist es, neue Möglichkeiten<br />
aufzuzeigen, wie sich der Kohlendioxidausstoß<br />
durch nachhaltige Zusatzstoffe oder Alternativen zu<br />
Beton deutlich senken lässt“, fasst der MIT-Experte<br />
zusammen.<br />
Ausgabe 9 | Mai 2018 | Umweltdialog.de<br />
81
Bauen <strong>und</strong> Wohnen<br />
guter<br />
Letzt<br />
Zu<br />
Wehe,<br />
wenn der Sprachassistent<br />
böse auf dich ist!<br />
Zahlreiche Nutzer des Sprachassistenten „Amazon Echo“<br />
berichten im Internet von „bösartigem Gelächter“, das von<br />
ihrem Gerät ausgeht. Einige User beschreiben das unverhohlene<br />
Gackern von Alexa als „hexenartig“ <strong>und</strong> „extrem<br />
gruselig“. Befehle würden zudem missachtet.<br />
Sprachbefehle ignoriert<br />
Ein Nutzer behauptet hinsichtlich der zahlreichen verängstigten<br />
Beiträge gegenüber „BuzzFeed“, dass er versucht<br />
habe, das Licht auszuschalten. Das Gerät hätte dieses jedoch<br />
wiederholt wieder eingeschaltet, bevor der Sprachassistent<br />
ein „böses Lachen“ von sich gegeben habe. Alexa selbst hat<br />
ein eigenes Lachen, das Nutzer mit einer bestimmten Frage<br />
auslösen können. Dieses würde sich den Berichten zufolge<br />
jedoch deutlich von den kürzlichen Fällen des bösartigen<br />
Gackerns unterscheiden.<br />
Ein anderer Nutzer gibt an, er hätte Alexa befohlen, den Wecker<br />
abzustellen. Der Sprachassistent reagierte dem User<br />
zufolge jedoch auch in diesem Fall mit einem „hexenartigen“<br />
Lachen. Ein weiterer Reddit-User schreibt, dass sein<br />
Alexa-Gerät es abgelehnt habe, das Licht auszuschalten.<br />
„Nach der dritten Bitte reagierte Alexa gar nicht mehr<br />
<strong>und</strong> lachte stattdessen böse. Das Lachen war nicht in der<br />
Alexa-Stimme. Es klang wie eine echte Person“, so der Nutzer.<br />
Störimpulse vermutet<br />
Viele weitere Anwender berichten über ähnliche Vorfälle, in<br />
denen der Sprachassistent Befehlen nicht mehr nachgekommen<br />
sei <strong>und</strong> stattdessen zu lachen begonnen habe. Bislang<br />
ist nicht klar, warum Alexa derzeit ohne eine spezielle Frage<br />
lacht oder eine andere Stimme dafür benutzen kann. Laut<br />
dem Bericht ist der Online-Versandhändler <strong>und</strong> Alexa-Entwickler<br />
Amazon noch nicht auf Anfragen nach weiteren Informationen<br />
über den Störimpuls eingegangen. Erst kürzlich<br />
wurde jedoch auch bekannt, dass Alexa oft durch Geräusche<br />
der Umgebung <strong>und</strong> nicht durch den Nutzer selbst ausgelöst<br />
werden kann. Werbespots wären in vielen Fällen der Gr<strong>und</strong><br />
für ungewollte Befehle gewesen. f<br />
IMPRESSUM<br />
UmweltDialog ist ein unabhängiger Nachrichtendienst<br />
r<strong>und</strong> um die <strong>Themen</strong> <strong>Nachhaltig</strong>keit <strong>und</strong> Corporate<br />
Social Responsibility. Die Redaktion von Umwelt-<br />
Dialog berichtet unabhängig, auch von den Interessen<br />
der eigenen Gesellschafter, über alle relevanten <strong>Themen</strong><br />
<strong>und</strong> Ereignisse aus Politik, Wirtschaft <strong>und</strong> Gesellschaft.<br />
Herausgeber:<br />
macondo publishing GmbH<br />
Dahlweg 87<br />
48153 Münster<br />
Tel.: 0251 / 200782-0<br />
Fax: 0251 / 200782-22<br />
E-Mail: redaktion@umweltdialog.de<br />
Redaktion dieser Ausgabe:<br />
Dr. Elmer Lenzen (V.i.S.d.P.), Sonja Scheferling,<br />
Milena Knoop, Fee Hovehne, Lucas Beesten,<br />
Julia Arendt, Elena Köhn<br />
Bildredaktion:<br />
Marion Lenzen<br />
Gestaltung:<br />
Gesa Weber<br />
Lektorat:<br />
Marion Lenzen, Milena Knoop<br />
klimaneutral<br />
natureOffice.com | DE-220-982644<br />
gedruckt<br />
Klimaneutraler Druck, FSC-zertifiziertes<br />
Papier, CO 2 -neutrale Server<br />
© 2018 macondo publishing GmbH<br />
© Titelbild: shutterstock.com<br />
ISSN<br />
Digital: 2199-1626<br />
Print: 2367-4113<br />
82 Ausgabe 9 | Mai 2018 | Umweltdialog.de
Bisherige Ausgaben<br />
Die nächste Ausgabe<br />
UmweltDialog erscheint am<br />
16.11.2018
Bauen <strong>und</strong> Wohnen<br />
€ 20<br />
Gutschein<br />
für Ihre Bestellung ab € 149,–*<br />
Aktionscode<br />
AZUD18<br />
NACHHALTIG<br />
EINRICHTEN<br />
memo.de<br />
84 Ausgabe 9 | Mai 2018 | Umweltdialog.de<br />
* Gültig bis 31.10.2018 ab einem Bestellwert von € 149,– netto. Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung den Aktionscode an.<br />
Pro K<strong>und</strong>e ist nur ein Gutschein einlösbar. Keine Barauszahlung möglich, nicht nachträglich einlösbar <strong>und</strong> nicht mit anderen Aktionen kombinierbar.