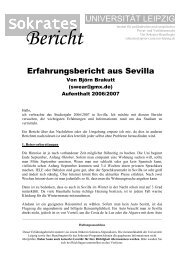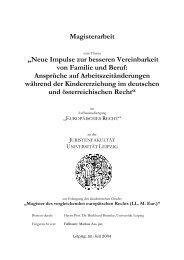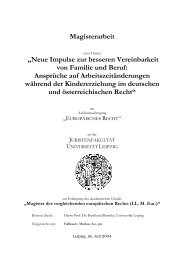Magisterarbeit „Mobiliarsicherheiten ohne Besitzübertragung im ...
Magisterarbeit „Mobiliarsicherheiten ohne Besitzübertragung im ...
Magisterarbeit „Mobiliarsicherheiten ohne Besitzübertragung im ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
dar. 15 Der Gläubiger erlangte dabei nicht das Eigentum, sondern ein<br />
beschränktes dingliches Recht am Pfandgegenstand.<br />
Voraussetzung war eine formlose Einigung der Parteien, das<br />
Vorhandensein einer zu sichernden Forderung und die Übergabe des<br />
Sicherungsobjektes. 16 Dabei sind Pfandrecht und Forderung von<br />
Anfang an streng akzessorisch. 17 Zur Begründung durch körperliche<br />
Übergabe der Sache (Besitzpfand – pignus datum) gesellte sich etwas<br />
später auch die Pfandbestellung durch Vereinbarung des<br />
Besitzkonstituts. 18 Das dadurch ermöglichte besitzlose Pfand setzte sich<br />
in der Folge durch und wurde, ausgehend vom Vermieterpfandrecht,<br />
auf nahezu alle Arten von Forderungen und Sachen ausgeweitet. 19 Auch<br />
die Verpfändung von Rechten (pignus nominis) und Sachgesamtheiten<br />
war dann möglich. 20<br />
Dem Schutz des Pfandrechts diente die dingliche Pfandklage (actio<br />
Serviana), mit welcher der Pfandgläubiger gegen den Verpfänder und<br />
gegen Dritte vorgehen konnte. 21 Bei Fälligkeit und Nichtzahlung durch<br />
den Schuldner war ursprünglich, wie bei der fiducia, ein Verfall an den<br />
Gläubiger vorgesehen. Später wurde die Verfallklausel aus<br />
Schuldnerschutzgründen verboten. An ihre Stelle trat der<br />
Pfandverkauf. 22 Nach erfolgter Pfandverwertung musste ein eventuell<br />
angefallener Überschuss an den Schuldner herausgegeben werden.<br />
Bei Schulderfüllung erlosch das Pfandrecht aufgrund der Akzessorietät;<br />
der Pfandgläubiger war be<strong>im</strong> Besitzpfand zur Herausgabe der Sache<br />
15 Hier liegt letztlich auch die Wiege unserer Begrifflichkeit „Faust“-Pfand, denn die<br />
römischen Juristen leiteten pignus von pugnus (Faust) ab. Vgl. Huwiler, Textbuch<br />
(1999) Rn. 490<br />
16 Kaser/Knütel, Römisches Privatrecht (2003) § 31, Rn. 16<br />
17 Hausmaninger/Selb, Römisches Privatrecht (2001) S. 182; vgl. Huwiler, Textbuch<br />
(1999) Rn. 497<br />
18 Noordraven, Fiduzia (1999) S. 4, Hromadka, Entwicklung des Faustpfandrechts<br />
(1971) S. 15 und 18<br />
19 Kaser/Knütel a.a.O. § 31, Rn. 18; vgl. Huwiler a.a.O. Rn. 507<br />
20 Hausmaninger/Selb a.a.O.<br />
21 Honsell, Römisches Recht (1997) S. 71; Kaser/Knütel a.a.O. § 31, Rn. 37 ff.;<br />
Huwiler a.a.O. Rn. 534<br />
22 Wolff/Raiser, Sachenrecht (1957) S. 518; Kaser/Knütel a.a.O. § 31, Rn. 27, 31;<br />
Be<strong>im</strong> besitzlosen Pfandrecht war der Gläubiger dann berechtigt, die Sache zum<br />
Zwecke des Pfandverkaufs vom Schuldner herauszuverlangen.<br />
6