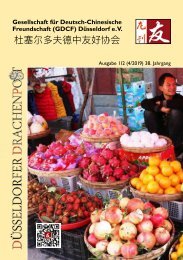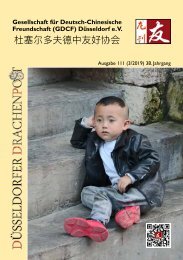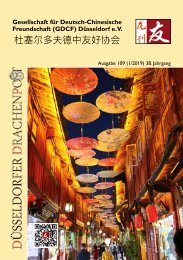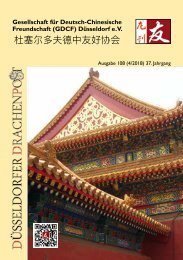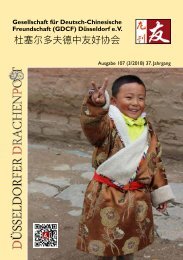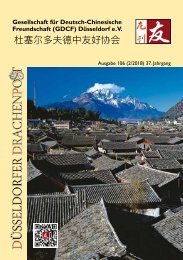Drachenpost 113
Drachenpost 113
Drachenpost 113
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Düsseldorfer Drachenpost – Ausgabe 113 (1/2020) 39. Jahrgang
Ich denke, es war eine aus älteren Zeiten der
Kolonialisierung und imperialen Machtausübung
rund um den Erdball überkommene Arroganz, die
uns in Europa, in den USA – im Westen – in der
Gewissheit wog, niemand in dieser Welt wäre in
der Lage, uns, die wir mit der Industrialisierung die
Zukunft der Menschheit neu erfunden hatten, neue
Wege zeigen zu können. Im Übrigen wurde der sich
auf Industrialisierung gründende Wohlstand hierzulande
inzwischen als Selbstverständlichkeit wahrgenommen,
als gesellschaftliche Errungenschaft
ignoriert mit der Folge, dass technischer Fortschritt
zunehmend mit Zweifeln belegt wurde.
Die Straßen in Chinas Megastädten sind breit
und führen geradeaus bis zum Horizont. Links
und rechts gepflegtes Grün, dahinter Hochhaussiedlungen,
und ganz weit hinten, wo eigentlich
der Horizont sein sollte, erscheinen im Dunst wiederum
Hochhaussiedlungen. Unwillkürlich fallen
mir Bilder aus dem Science-Fiction-Film „Metropolis“
von Fritz Lang (1927) ein. Darin ziehen Autos,
Eisenbahnen und Flugzeuge zwischen spektakulären
Hochhäusern ihre Kreise. Solche Bilder
waren es, die uns Nachkriegskinder in den 1950er
und 1960er Jahren inspirierten. Wissenschaft und
Technik galten uns als Garanten dafür, all das zu
verwirklichen was wir uns wünschten. Und wenn
wir nur wollten, könnten wir zum Mond fliegen,
was wir auch taten. Ich wollte Ingenieur werden
und selbstverständlich das modernste studieren,
was es gab, nämlich Kerntechnik. Bis zum Jahr
2000 so hieß es, hätten wir das Schlaraffenland immerwährend
verfügbarer Fusionsenergie erreicht.
Diesen Optimismus meiner frühen Lebensjahre
entdeckte ich erneut im China der 1980er Jahre,
fand ihn bei meinen Gesprächspartnern 1993,
und er beflügelte mich auch bei meiner aktuellen
Tour durchs Land. Klar, mit einem Hammer kann
man Nägel ins Holz treiben oder aber auch einen
Menschen erschlagen. Technik ist ambivalent.
Kernenergie, 5G-Funkübertragung, Industrie 4.0,
Künstliche Intelligenz – es kommt darauf an, was
wir daraus machen. China hat die Zeit genutzt und
technologisch aufgeholt. Und schon setzt das Land
bei einigen Themen wie der Künstlichen Intelligenz
zum Überholmanöver an. Überwachungskameras
allüberall – das ist anders im China von heute. Automatische
Gesichtserkennung beim Check-in am
Flughafen – wie das geht, und wie es das Reisen
erleichtert, wenn nervige Kontrollen entfallen können,
wurde uns in Chongqing demonstriert.
Die Menschen in China sind pragmatisch.
Man hat sich in den 40 Jahren seit der Öffnung
in der Welt umgeschaut und all jene Technologien
für die eigene Entwicklung genutzt, die zu
diesem Zweck brauchbar erschienen. Oder man
hat die Dinge so lange transformiert, bis sie der
eigenen Kultur angemessen waren. Dabei konnte
man nach Gusto auswählen: Dies nehmen wir,
jenes nicht. Die Schnellzüge in China nutzen
ein eigenes Schienennetz von inzwischen mehr
als 30.000 Kilometern, sind 300 km/h schnell,
schweben völlig ruckelfrei durch die Landschaft
und sind auf die Minute pünktlich. Dabei sehen
die Züge aus wie ein ICE in Deutschland.
In China folgt man Utopien. Für meine Reportage
aus den Sonderwirtschaftszonen habe ich
1993 Plakatwände an den Straßenrändern fotografiert,
die meist futuristische Hochhauswelten
abbildeten. Ein riesiges Plakat in Shenzen zeigte
Deng Xiao Ping als guten Geist einer kommenden
besseren Welt. Bei uns im Westen, in Deutschland
zumal, trägt der Gedanke an Zukunft heute geradezu
dystopische Züge. „How dare you?!“ Auf
Deutsch: „Wie könnt ihr es wagen?!“ schallt es uns
entgegen. In welch grauenhafte technische Welt
habt ihr uns unschuldige Kinder hineingeboren?
Da ist sie wieder, die Ambivalenz der technischen
Entwicklung. Jetzt ist China in einer Reihe
von Fragen in der gleichen Situation wie das
ehemalige westliche Vorbild: Wenn man an der
Spitze ist, muss man selbst den Weg suchen. Es
spricht vieles, nein alles, dafür, diese Wege gemeinsam
zu finden.
Dieter Beste ist seit 1978
Mitglied der GDCF-Düsseldorf.
Er berät wissenschaftliche
Einrichtungen, Ministerien
und Unternehmen in Fragen
der Technik- und Wissenschaftskommunikation
und
begleitet mit seinem Büro
MEDIAKONZEPT die Herausgabe von Publikationen
im Themenspektrum von Technik und
Wissenschaft.
7