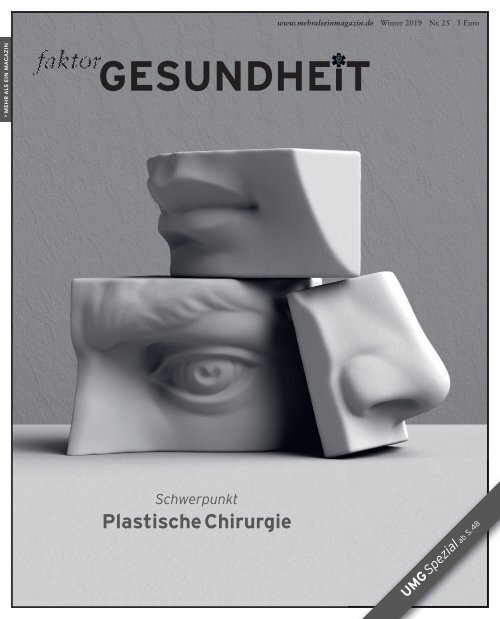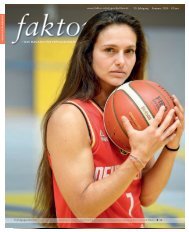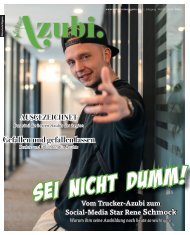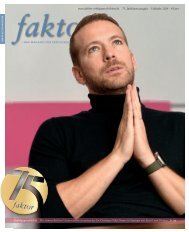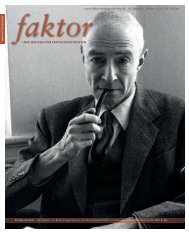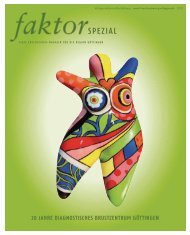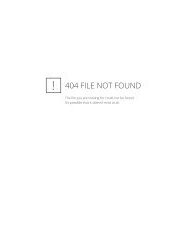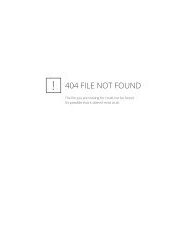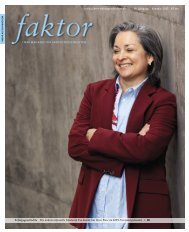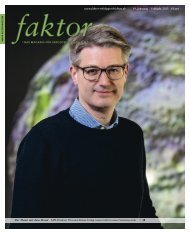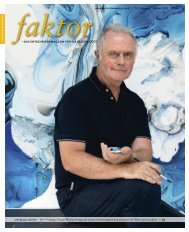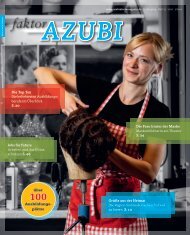faktor Gesundheit Winter 2019
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
www.mehralseinmagazin.de <strong>Winter</strong> <strong>2019</strong> Nr. 25 5 Euro<br />
› MEHR ALS EIN MAGAZIN<br />
GESUNDHEıT<br />
Schwerpunkt<br />
Plastische Chirurgie<br />
UMG Spezial ab S. 48
JAN FÖRSTER Dipl.-Finw.(FH)<br />
Steuerberater<br />
Miriam Engel Dipl.-Kffr.<br />
Steuerberaterin<br />
TATJANA WUCHERPFENNIG B.Sc.<br />
Steuerberaterin<br />
Immer die richtige Finanzmedikation<br />
Damit Abgaben nicht zur bitteren Pille werden, finden Mediziner in Quattek &<br />
Partner ihren „Facharzt“ unter den Steuerberatern. Wir verstehen uns als wirtschaftliche<br />
Wegbegleiter der Heilberufe. Unser Rezept für das monetäre Wohlergehen:<br />
effektive Finanzdiagnostik und wirksame Therapien von der Praxisübernahme<br />
über den laufenden Betrieb bis hin zur Nachfolgeregelung.<br />
Steuerprognosen, Liquiditäts- und Planrechnungen sowie Branchen- und Mehrjahresvergleiche<br />
helfen uns, Probleme frühzeitig zu erkennen und eine entsprechende<br />
„Medikation“ vorzunehmen. Die Ergebnissituation fassen wir nachvollziehbar<br />
in speziellen Quartalsberichten und Überschussrechnungen zusammen.<br />
Als Spezialisten auf dem Gebiet der Heilberufe betreuen wir mit besonders ausgebildeten<br />
und motivierten Mitarbeitern eine Vielzahl von niedergelassenen Medizinern<br />
der verschiedensten Fachrichtungen und Praxen unterschiedlichster<br />
Größenordnungen und Organisationsformen.<br />
Jürgen Hollstein Dipl.-Kfm.<br />
Steuerberater<br />
Roland Haever Dipl.-Kfm.<br />
Wirtschaftsprüfer · Steuerberater<br />
Fritz Güntzler Dipl.-Kfm.<br />
Wirtschaftsprüfer · Steuerberater<br />
Johann-Karl Vietor Dipl.-Kfm.<br />
Steuerberater<br />
Thorsten Kumpe Dipl.-Kfm.<br />
Wirtschaftsprüfer · Steuerberater<br />
Miriam Engel Dipl.-Kffr.<br />
Steuerberaterin<br />
Lutz Becker<br />
Rechtsanwalt<br />
In Kooperation mit<br />
Quattek & Partner Steuerberatungsgesellschaft mbB · Nikolausberger Weg 49 · 37073 Göttingen · Tel. (05 51) 49 70 1-0 · www.quattek.de
editorial<br />
Mal Hand aufs Herz: Woran denken Sie, wenn Sie den Begriff Schönheits-OP hören?<br />
An Botox, Brustvergrößerung und Fettabsaugung? Da sind Sie nicht allein! Und<br />
tatsächlich gehören diese Eingriffe zu den häufigsten in Deutschland.<br />
Doch hinter dem übergreifenden Fachgebiet Plastische Chirurgie verbirgt sich<br />
weit mehr. Um hier einmal etwas Licht ins Dunkel zu bringen, haben wir das Thema in dieser<br />
Ausgabe für Sie ausgiebig durchleuchtet und erstaunliche Erkenntnisse zutage gefördert.<br />
Begonnen mit der unterhaltsamen und durchaus blutrünstigen Geschichte der Plastischen<br />
Chirurgie – von der ersten Nasenoperation in der Antike bis hin zu Nasen à la carte oder dem<br />
Heranzüchten eines neuen Ohrs im eigenen Unterarm. Klingt fiktiv? Gibt es aber wirklich!<br />
Und noch vieles mehr ..., wie Sie in unserem Beitrag ,Eine Reise in die Zukunft‘ über die neuesten<br />
Möglichkeiten zur Verbesserung der Lebenssituation vieler Menschen ab Seite 28 lesen können.<br />
Außerdem haben wir die aktuellsten Zahlen für Sie: Wie viele Männer und Frauen legen sich<br />
jährlich tatsächlich unter das Messer? Welche sind die beliebtesten Schönheits-OPs? Was bewegt<br />
Menschen zu diesem Schritt? Und welchen Stellenwert nehmen Eingriffe dieser Art in unserer<br />
Gesellschaft heute ein?<br />
Natürlich kommen auch wieder einige der führenden Experten auf diesem Gebiet aus unserer<br />
Region zu Wort – wie zum Beispiel Claudia Choi-Jacobshagen. Die Chefärztin der Abteilung<br />
Plastische, Ästhetische und Rekonstruktive Chirurgie am Evangelischen Krankenhaus Weende<br />
möchte Mut machen und aufklären, welche großartigen Möglichkeiten ihr Fachgebiet<br />
beispielsweise für Frauen nach einer Brustkrebsoperation bereithält. Ich wünsche Ihnen eine<br />
erkenntnisreiche Lektüre sowie eine wunderbare <strong>Winter</strong>zeit – und bleiben Sie gesund!<br />
COVER-FOTO: 123RF_ KATISA / FOTO EDITORIAL: LUKA GORJUP<br />
Ihre Elena Schrader<br />
– Chefredakteurin –<br />
schrader@<strong>faktor</strong>-magazin.de<br />
IMPRESSUM<br />
Herausgeber: <strong>faktor</strong> – das Entscheider-Magazin für die Region Göttingen, Entscheider Medien GmbH, Berliner Straße 10, 37073 Göttingen,<br />
Tel. 0551 3098390, Fax 0551 30983911, info@<strong>faktor</strong>-magazin.de, www.<strong>faktor</strong>-magazin.de<br />
Übrigens: Ab Seite 48 wartet noch ein Heft<br />
im Heft auf Sie – unser UMG Spezial !<br />
Herausgeber Marco Böhme (V.i.S.d.P.) Chefredakteurin Elena Schrader Redaktion Sven Grünewald, Claudia Klaft, Stefan Liebig, Lea van der Pütten, Carolin<br />
Schäufele Lektorat CoLibris-Lektoratsbüro Dr. Barbara Welzel Vertrieb Horst Wolf Art-Direktion & Layout Julia Braun Druckerei Silber Druck OHG<br />
GESUNDHEıT 2 | <strong>2019</strong> 3
DIE WISSENSCHAFT HAT FESTGESTELLT<br />
4<br />
GESUNDHEıT 2 | <strong>2019</strong>
FOTO: STOCK.ADOBE.COM<br />
Auch Hühner mögen schöne Menschen<br />
Wissenschaftler der Universität Stockholm trainierten Hühner darauf, durchschnittliche<br />
weibliche, aber nicht männliche menschliche Gesichter zu erkennen<br />
(und umgekehrt). Im darauf folgenden Test pickten die Tiere wesentlich<br />
heftiger, wenn sie Gesichter sahen, die auch menschliche Probanden als besonders<br />
schön beurteilt hatten. Die Forscher schließen daraus, dass Hühner und<br />
Menschen ein gemeinsames Schönheitsideal teilen, das folglich aus den allgemeinen<br />
Eigenschaften des Nervensystems entsteht. Für diese Arbeit erhielten<br />
sie 2003 den Ig-Nobelpreis, eine Auszeichnung der Harvard University für<br />
besonders abstruse Forschungsergebnisse.<br />
Quelle: Spektrum der Wissenschaft<br />
GESUNDHEıT 2 | <strong>2019</strong> 5
NEUIGKEITEN<br />
FOTO: EKW<br />
Azubis am Drücker<br />
Machtübernahme im EKW<br />
Nach rund drei Jahren Beschäftigung<br />
mit den aktuellen Pflegestandards<br />
und medizinischen<br />
Hintergründen haben die 18 Auszubildenden<br />
zum <strong>Gesundheit</strong>s<br />
und Krankenpfleger des<br />
Evangelischen Krankenhauses<br />
GöttingenWeende für drei<br />
Wochen die geriatrische Station<br />
übernommen. Ziel der ‚Schülerstation‘<br />
war es, dass die Azubis ihr<br />
bisheriges Wissen vertiefen und<br />
umsetzen konnten. Sie verantworteten<br />
dabei den Sta tions ablauf,<br />
evaluierten Prozesse und passten<br />
diese an. Begleitet wurden sie<br />
dabei von je einer examinierten<br />
Pflegekraft pro Dienst.<br />
FOTO: FOTOSTUBE HORNIG<br />
Digitalisierung<br />
Labor für eine gesunde Zukunft<br />
in Göttingen<br />
Im Rahmen der Ausschreibung ‚Zukunftslabore Digitalisierung‘ des<br />
Niedersächsischen Ministeriums für Wissenschaft und Kultur hat sich<br />
ein Forschungsverbund unter der Projektleitung der Universitätsmedizin<br />
Göttingen mit seinem Konzept für das im Oktober <strong>2019</strong> gestartete<br />
‚Zukunftslabor <strong>Gesundheit</strong>‘ erfolgreich durchgesetzt und wird nun für<br />
eine Laufzeit von fünf Jahren mit rund 3,7 Millionen Euro gefördert.<br />
Das ‚Zukunftslabor <strong>Gesundheit</strong>‘ soll anwendungsbezogene Antworten<br />
zur Förderung innovativer Lösungen liefern, um digitale Technologien<br />
für die Versorgung und die Pflege zu etablieren.<br />
Hautärztliche Sprechstunde<br />
Neuer Hautarzt im MEC<br />
am Göttinger Bahnhof<br />
Das Team des medizinischen Experten-Centers MEC verstärkt sich.<br />
Bisher sind 18 Ärzte der verschiedensten Fachrichtungen in der<br />
Bahnhofsallee 1d tätig – ab sofort gibt es mit Thomas Neumann (Foto)<br />
Verstärkung im Bereich der Dermatologie. Zusätzlich zu Thomas Fuchs,<br />
der die Dermatologie mit Schwerpunkt im Bereich der Allergologie vertritt,<br />
bietet Neumann jeden Freitag eine hautärztliche Sprechstunde an,<br />
in der es bevorzugt um die Beurteilung und Abklärung von Muttermalen,<br />
Ekzemen, Neurodermitis, Psoriasis und natürlich auch um die<br />
Früherkennung von Hautkrebs geht. Dies sind nur einige Aspekte, die<br />
der ansonsten in Hann. Münden tätige Hautarzt am Göttinger Bahnhof<br />
allen Interessierten anbietet. Eine Abrechnung mit gesetzlichen Krankenversicherern<br />
ist allerdings nicht möglich. Infos und Termine unter:<br />
Tel. 0551 820 74 263.<br />
FOTO: STOCK.ADOBE.COM<br />
6<br />
GESUNDHEıT 2 | <strong>2019</strong>
NEUIGKEITEN<br />
FOTO: STOCK.ADOBE.COM FOTO: ST. MARTINI<br />
Wechsel in Duderstadt<br />
Neuer Anästhesie-Chefarzt<br />
für St. Martini<br />
Es gibt einen Neuen. Seit dem 1. Juli leitet<br />
Michael Pauli-Magnus die Anästhesie<br />
und Intensivmedizin am St. Martini Krankenhaus in Duder stadt.<br />
Der 45-jährige promovierte Facharzt für Anästhesiologie mit den Zusatzbezeichnungen<br />
Notfallmedizin und Intensivmedizin und einem<br />
Masterabschluss in Hospitalmanagement möchte die Weiterentwicklung<br />
der Abteilung und des Standortes insbesondere auch mit Blick<br />
auf die anstehenden Infrastrukturmaßnahmen und die sich in diesem<br />
Zusammenhang wandelnden Arbeitsprozesse mitgestalten. Zuletzt<br />
war er als leitender Oberarzt und stellvertretender Chefarzt in der<br />
Klinik für Anästhesie, Schmerztherapie, Intensiv- und Notfall medizin<br />
der DRK Kliniken Berlin insbesondere für Management und Koordination<br />
der zehn Operationssäle sowie die Restrukturierung des<br />
Medizinischen Aufnahmezentrums verantwortlich.<br />
,ProBeweis‘<br />
Holzmindener Krankenhaus macht sich stark gegen Gewalt<br />
FOTO: EICHSFELD KLINIKUM<br />
Eichsfeld Klinikum spendet<br />
Betten für Afghanistan<br />
Große Lkw sind auf dem Wirtschaftshof im<br />
Eichsfeld Klinikum keine Seltenheit – und doch:<br />
Im Haus Reifenstein fand in diesem Sommer eine<br />
nicht alltägliche Verladeaktion statt. Rund 50 voll<br />
funktionsfähige Patientenbetten einschließlich<br />
Zubehör wurden durch das Eichsfeld Klinikum mit<br />
einer Hilfssendung als Spende nach Afghanistan<br />
geliefert. Der Kontakt lief über ‚Medizinische Hilfe<br />
für Afghanistan e. V.‘. In drei Krankenhäusern in<br />
Kabul, Herat und Kandahar sind die ausrangierten<br />
Betten höchst willkommen.<br />
Gewalt ist eines der größten <strong>Gesundheit</strong>srisiken<br />
für Kinder und Erwachsene. Oft werden<br />
die Taten von häuslicher oder sexueller<br />
Gewalt verschwiegen, da sich die Betroffenen<br />
schämen und sich daher auch nicht<br />
direkt zu einer polizeilichen Anzeige entschließen.<br />
Das Agaplesion Evangelisches<br />
Krankenhaus Holzminden ist deshalb im<br />
Netzwerk ‚ProBeweis‘ aktiv. Das Krankenhaus<br />
Holzminden wie auch die 37 weiteren<br />
Partnerkliniken des Netzwerkes stellen eine<br />
sichere und professionelle Anlaufstelle für<br />
die Betroffenen dar. „In unserer Notaufnahme<br />
oder der gynäkologischen Abteilung erhalten<br />
Betroffene jederzeit eine kostenlose<br />
ärztliche Untersuchung, die Verletzungen<br />
oder Spuren gerichtsverwertbar sichert“, erklärt<br />
Marko Ellerhoff, Geschäftsführer des<br />
Krankenhauses. Die gesammelten Spuren<br />
und Materialien werden im Anschluss drei<br />
Jahre lang eingelagert. So können sich die<br />
Betroffene später immer noch zu einer Anzeige<br />
entschließen und die entsprechenden<br />
Beweise einreichen.<br />
Weitere Infos gibt’s unter:<br />
www.probeweis.de<br />
GESUNDHEıT 2 | <strong>2019</strong> 7
NEUIGKEITEN<br />
Revolution<br />
Fingernägelschneiden<br />
leicht gemacht<br />
FOTO: OTTO BOCK<br />
Verdienstkreuz Erster Klasse<br />
Höchste Ehre für<br />
Unternehmer, Visionär<br />
und Philanthrop Hans<br />
Georg Näder<br />
Der Firma Steinbock Technik aus Göttingen ist eine kleine Revolution<br />
gelungen, die vielen beeinträchtigten Menschen das Leben<br />
erleichtert: Klippfixx. Das Gerät wird einfach mit der mitgelieferten<br />
Schraubzwinge an einem Tisch befestigt. Anschließend nur<br />
noch das Fußpedal aufstellen, und schon startet die Nagelpflege.<br />
Mit diesem kleinen Produkt soll es Menschen, die unter Rheuma,<br />
Arthrose, altersbedingter Muskelschwäche oder einer Halbseitenlähmung<br />
leiden, ermöglicht werden, sich wieder selbstständig die<br />
Fingernägel zu schneiden und so ein Stück Lebensqualität und<br />
Selbstbestimmung zurückzubekommen. Lobenswert!<br />
FOTO: KLIPPFIX<br />
Bundespräsident Frank-Walter<br />
Steinmeier hat Hans Georg Näder<br />
das Verdienstkreuz Erster Klasse des<br />
Verdienstordens der Bundesrepublik<br />
Deutschland verliehen. Der Vorsitzende<br />
des Verwaltungsrates und<br />
Eigentümer von Ottobock erhielt die<br />
Auszeichnung aufgrund seines langjährigen<br />
Einsatzes für den medizinischen<br />
Fortschritt und auch aufgrund<br />
seines gesellschaftlichen Engagements.<br />
„Ich freue mich außerordentlich<br />
über diese Ehrung. Mein Dank<br />
gilt dabei vor allem den Mitarbeiterinnen<br />
und Mitarbeitern bei Ottobock<br />
und allen, die unser gesellschaftliches<br />
Engagement als Familie<br />
unterstützen. Gemeinsam helfen wir<br />
jeden Tag Menschen dabei, ihre<br />
Mobilität zu erhalten oder zurück zugewinnen“,<br />
so Näder.<br />
FOTO: UMG CHRISTOPH MISCHKE<br />
Entschlüsselt<br />
Fortschritte bei der Glasknochenkrankheit<br />
Extrem brüchig wie Glas sind die Knochen von Menschen mit der<br />
genetisch bedingten Erkrankung Osteogenesis imperfecta. Von der<br />
‚Glas knochenkrankheit‘ sind besonders Kinder betroffen – aber auch<br />
Erwachsene. Ein internationales Forscherteam unter Federführung von<br />
Bernd Wollnik (Foto), Direktor des Instituts für Humangenetik an der<br />
Universitätsmedizin Göttingen, konnte nun ein Gen entschlüsseln, das<br />
Hinweise auf einen möglichen Behandlungsansatz liefert. Bisher ist<br />
eine Heilung dieser Krankheit noch nicht möglich.<br />
8<br />
GESUNDHEıT 2 | <strong>2019</strong>
PROFIL<br />
ANZEIGE<br />
Für Ihren Rücken in Göttingen<br />
Das traditionsreiche Rückenfachgeschäft<br />
Studio Neues Sitzen in<br />
Göttingen bietet Ihnen in angenehmer<br />
Atmosphäre individuelle ergonomische<br />
Arbeitsplatzlösungen mit ausgesuchten Produkten<br />
zum Arbeiten im Sitzen und Stehen.<br />
Wir sind ein ErgonomieFachgeschäft mit<br />
über 30 Jahren Erfahrung für den Bereich<br />
Rücken. Wir erstellen Bürokonzepte, die auch<br />
Themen wie Licht, Akustik und Stressreduzierung<br />
am Arbeitsplatz mit einschließen.<br />
Wir arbeiten mit dem Schwerpunkt Sitzergonomie<br />
bundesweit. In unserem Beratungszentrum<br />
können Sie unter fachlicher<br />
Anleitung eine ausgesuchte Auswahl an unterschiedlichen<br />
Sitzmöbeln und SitzSteh<br />
Arbeits plätzen ausprobieren. Wir arbeiten<br />
mit führenden Herstellern und Manufakturen<br />
zusammen, um Ihnen u. a. auch spezielle<br />
Sonderlösungen anbieten zu können.<br />
Wir kommen auch zu Ihnen nach Hause<br />
oder in Ihre Firma. Sprechen Sie uns an<br />
und profitieren Sie von unseren Ideen.<br />
Bitte vereinbaren Sie einen Termin!<br />
KONTAKT<br />
Tilman Shastri Raumvision GmbH<br />
FriedrichEbertStraße 26<br />
37077 Göttingen<br />
Tel. 0551 38489962<br />
shastri@raumvision.eu<br />
www.raumvision.eu<br />
www.studio-neues-sitzen.de<br />
Weil ich Weil ich<br />
neugierig neugierig auf auf<br />
morgen morgen bin. bin.<br />
GDA-Zukunftstag<br />
GDA-Zukunftstag<br />
Jeden ersten Jeden Mittwoch ersten Mittwoch im Monat im Monat<br />
Entdecken Entdecken Sie einen Sie exklusiven einen exklusiven<br />
Weg in Ihre Weg Zukunft. in Ihre Zukunft.<br />
Lernen Sie Lernen uns persönlich Sie uns persönlich kennen kennen<br />
und erleben und Sie erleben die Philosophie Sie die Philosophie<br />
der GDA. der GDA.<br />
Reservierung: Reservierung:<br />
Herr Sascha Herr Franz Sascha Franz<br />
Tel.: 0551 799 Tel.: 2700 0551 799 2700<br />
GDA Göttingen GDA Göttingen<br />
Charlottenburger Charlottenburger Straße 19 Straße 19<br />
37085 Göttingen 37085 Göttingen<br />
www.gda.de www.gda.de<br />
GDA0784_AZ_ZT_Goettingen_RZ.indd 1 16.11.18 16:14<br />
GDA0784_AZ_ZT_Goettingen_RZ.indd 1 16.11.18 16:14
NEUIGKEITEN<br />
FOTO: EKW<br />
TÜV bestanden<br />
Patientenversorgung<br />
auf hohem Niveau<br />
FOTO: HELIOS<br />
Das Evangelische Krankenhaus Göttingen-Weende (EKW) erhält die vierte<br />
erfolgreiche Gesamthaus-Zertifizierung ‚TÜV für Krankenhäuser‘. Mit<br />
diesem Siegel wurde das EKW erneut für seinen hohen Qualitätsstandard<br />
in der Patientenversorgung ausgezeichnet. Das im Jahre 2010 erstmalig<br />
erhaltene Zertifikat steht seitdem für eine Patientenbetreuung, die nach<br />
gesicherten Qualitätsstandards erfolgt. Damit schafft es auch weiterhin<br />
Vertrauen und Sicherheit für Patienten, Beschäftigte und Einweiser.<br />
Helios Albert-Schweitzer-Klinik<br />
Wechsel an der Spitze der Geburtshilfe in Northeim<br />
Seit Juli leitet Ford Cheikh Baker (Foto, l.) die Gynäkologie und Geburtshilfe<br />
der Helios Albert-Schweitzer-Klinik Northeim. Damit löst er den bisherigen<br />
gynäkologischen Chefarzt Josef Fasunek (r.) ab, der sich nach 14 Jahren<br />
Chef arzttätigkeit in den Ruhestand verabschiedet. Ford Cheikh Baker war<br />
zuvor am Mutterhaus der Borromäerinnen in Trier als gynäkologischer<br />
Oberarzt tätig. Neben dem Fortführen der erfolgreichen Entwicklung der<br />
Geburtshilfe wird er das gynäkologische Leistungsspektrum bei der Behandlung<br />
von Krebserkrankungen ausbauen und dadurch vor allem den operativen<br />
Bereich der Gynäkologie weiter stärken.<br />
FOTO: HELIOS<br />
Auf dem neusten Stand<br />
Helios Kliniken gehen<br />
online<br />
Von Akupunktur bis zur Zystektomie<br />
– das neue OnlineMagazin<br />
der Helios Kliniken liefert wissenswerte<br />
Informationen, Experteninterviews<br />
und spannende Hintergrundgeschichten<br />
zu den verschiedensten<br />
<strong>Gesundheit</strong>sthemen.<br />
Neben aktueller Berichterstattung<br />
beleuchtet die Helioseigene<br />
Redaktion regelmäßig ausgewählte<br />
Schwerpunktthemen besonders<br />
intensiv. Einen ersten Vorgeschmack<br />
auf die Bandbreite an Themen und<br />
Artikelformaten gibt es ab sofort<br />
mit den AuftaktDossiers ‚Gesunder<br />
Schlaf‘ und ‚Notfallmedizin‘.<br />
Weitere Infos unter:<br />
www.helios- gesundheit.de/magazin<br />
10<br />
GESUNDHEıT 2 | <strong>2019</strong>
ANZEIGE<br />
FOTO: ALCIRO THEODORO DA SILVA<br />
PROFIL<br />
Stephan Müller, Katrin Züchner, Adrian Schulz und Dirk Schulz<br />
Kompetente Unterstützung bei<br />
• Berufseinstieg<br />
• Praxisgründung<br />
• Praxisübernahme<br />
• Praxisfinanzierung<br />
• Praxisabgabe<br />
• Risk Management<br />
Unternehmensberatung für Zahnheilberufe<br />
Selbstständigkeit und Betriebswirtschaftslehre<br />
? Obwohl die Mehrheit<br />
der Zahnärztinnen und -ärzte in<br />
Deutschland selbstständig tätig ist, haben<br />
wirtschaftliche Inhalte im Studium der<br />
Zahnmedizin keinen Platz. An dieser Stelle<br />
kommt Dirk Schulz ins Spiel, Geschäfts führer<br />
von SMS – Unternehmensberatung für<br />
Zahnheilberufe. Seit über 25 Jahren begleitet<br />
er ausschließlich (Fach-)Zahnärzte in ganz<br />
Deutschland vom Studium bis in den Ruhestand.<br />
SCHON STUDIENABGÄNGERN STEHT<br />
ER bei allen Fragen rund um den Berufsstart<br />
mit Rat und Tat zur Seite. Wie finde ich eine<br />
Assistenzstelle? Was muss in meinem ersten<br />
Arbeitsvertrag stehen? Welche Absicherungen<br />
sind am Anfang notwendig? Welches Gehalt<br />
ist angemessen? Worauf ist zu achten?<br />
Nach Abschluss der Assistenzzeit gibt es<br />
keine Standardlösungen. „Für die weitere<br />
Entwicklung klären wir die persönlichen<br />
Präferenzen, damit wir die Beratung opti mal<br />
ausrichten können“, so Schulz. Die Entscheidung<br />
für eine Anstellung oder die<br />
Selbstständigkeit sollte wohlüberlegt und<br />
gut geplant sein.<br />
Nach wie vor ist eine Selbstständigkeit in<br />
fast allen Fällen lohnend, wobei der Standortwunsch<br />
des Zahnarztes ausschlaggebend<br />
ist. Im Falle einer Neugründung erstellt das<br />
Team von SMS unter anderem eine fundierte<br />
Standort analyse und ermittelt den erforderlichen<br />
Mindestumsatz. Inzwischen überwiegt<br />
aller dings die Zahl der Praxisübernahmen,<br />
bei denen Schulz die Kaufvertragsverhandlungen<br />
mit allem Drum und Dran begleitet.<br />
In jedem Fall wird gemeinsam mit der Zahnärztin<br />
oder dem Zahnarzt ein tragfähiger<br />
Businessplan erstellt. Auch bei den Mietvertragsverhandlungen<br />
und den Finanzierungsgesprächen<br />
ist besonderes Knowhow und ein<br />
Auge für Details notwendig. So kann insbesondere<br />
im Dialog mit Banken über die Einbindung<br />
von öffentlichen Fördermitteln bares<br />
Geld gespart werden. Abgerundet wird dieses<br />
Gesamtpaket mit einem maßgeschneiderten<br />
Absicherungskonzept über den hauseigenen<br />
Maklerdienst.<br />
NACH DEM SCHRITT IN DIE SELBST-<br />
STÄNDIGKEIT wird in regelmäßigen Abständen<br />
der Praxiserfolg mit den Planzahlen<br />
abgeglichen, um bei möglichen Fehlentwicklungen<br />
frühzeitig gegensteuern zu können.<br />
In vielen Fällen steht einige Jahre nach der<br />
erfolgreichen Niederlassung die Aufnahme<br />
einer weiteren Kollegin oder eines Kollegen<br />
an. Hier schließt sich der Kreis zu der Begleitung<br />
und Vermittlung junger Assistenzärztinnen<br />
und -ärzten.<br />
Bei seiner Arbeit kann sich der zertifizier te<br />
Zahnärzteberater neben seinen eigenen langjährigen<br />
Erfahrungen auch auf die Exper ti se<br />
verschiedenster ausgewählter Fachleute<br />
verlassen. So zählen zu dem von ihm gegründeten<br />
„Expertennetzwerk Heilberufe“<br />
Fachanwälte für Medizinrecht, auf Zahnheilberufe<br />
spezialisierte Steuer berater, Praxiseinrichter,<br />
Banken und weitere Dienstleister<br />
im <strong>Gesundheit</strong>swesen. „Auf diese Weise<br />
können wir unseren Zahnärztinnen und<br />
Zahnärzten in allen finanz-, steuer- und vertragsrechtlichen<br />
Fragen eine ganzheitliche<br />
Beratung anbieten“, erklärt Schulz. Mit dieser<br />
bewährten Strategie hat er inzwischen<br />
über 700 Zahnärztinnen und -ärzte erfolgreich<br />
in die Selbständigkeit begleitet.<br />
info@sms-goettingen.de
Bestens gewappnet für<br />
das nächste Jahrzehnt<br />
Die Ärzte am Göttinger Bahnhof installieren die neueste MRT-Generation.<br />
TEXT MARGARETA VOGEL FOTOGRAFIE ALCIRO THEODORO DA SILVA<br />
Gleich zwei MRT-Geräte haben<br />
die beiden Geschäftsführer<br />
Friedemann Baum und Uwe<br />
Fischer in den vergangenen<br />
Wochen in den Räumen ihrer Praxis am<br />
Göttinger Bahnhof, die sowohl das Brustzentrum<br />
Göttingen als auch die Praxis für<br />
moderne Schnittbild diagnostik umfasst,<br />
installiert. Damit sind die letzten Weichen<br />
gestellt, um auch in den kommenden Jahren<br />
eine moderne und innovative Diagnostik<br />
anbieten zu können – nachdem bereits<br />
im vergangenen Jahr ein Mammografiesystem<br />
der jüngsten Generation installiert<br />
worden war. „Wir haben seit unserer Eröffnung<br />
im Jahr 2003 immer angestrebt,<br />
unseren Patienten auf dem Gebiet der<br />
bildgebenden Diagnostik die modernste<br />
und schonendste Technologie anbieten zu<br />
können“, betont Baum. „Mit den neuen<br />
MRT-Systemen, einem 1.5-Tesla- und<br />
einem 3.0-Tesla-Magneten, können wir<br />
auch in Zukunft hochwertige High-End-<br />
Untersuchungen der verschiedenen Körperregionen<br />
durchführen.“<br />
DIE ZWEI NEUEN HOCHLEISTUNGSSYS<br />
TEME der Firma Siemens aus Erlangen<br />
erlauben eine Verkürzung der Untersuchungszeiten<br />
und eine noch höhere<br />
Auflösung und Bildschärfe in der Darstellung<br />
feinster Strukturen. „Hierdurch ergeben<br />
sich insbesondere in der Diagnostik<br />
der verschiedenen Gelenke sowie in der<br />
Früherkennung von Prostata- und Brustkrebs<br />
Vorteile“, erläutert der Radiologe<br />
Vosshenrich, der in erster Linie am<br />
3T-MRT tätig ist. „Darüber hinaus bietet<br />
das 3T-System deutliche Vorteile in der<br />
MR-Abbildung der Hirnstrukturen.“<br />
Zusätzlich können nun auch Untersuchungen<br />
angeboten werden, die mit der<br />
älteren Gerätegeneration nicht so gut<br />
möglich waren. „Dies betrifft zum Beispiel<br />
die quantitative Bestimmung des<br />
Fettgehaltes in der Leber oder computergestützte<br />
Auswertungen von Hirnstrukturen,<br />
die zur Erkennung und Unterscheidung<br />
von Demenzerkrankungen wichtig<br />
sind“, erklärt der Neuroradiologe Michael<br />
Knauth. „Für die nächsten Jahre sind wir<br />
12<br />
GESUNDHEıT 2 | <strong>2019</strong>
Ein starkes Team blickt in die Zukunft: Dr. Ulla Ritter, Prof. Dr. Rolf Vosshenrich, Dr. Susanne Luftner-Nagel,<br />
Dr. Friedemann Baum, Prof. Dr. Katharina Marten-Engelke, Prof. Dr. Uwe Fischer, Nadja Meiser und Prof. Dr. Michael Knauth<br />
damit für Weiterentwicklungen auf dem<br />
Software-Sektor bestens präpariert.“<br />
Außerdem ist für den Bereich der Brustkrebsdiagnostik<br />
geplant, zusammen mit<br />
der Firma Siemens automatisierte Auswerteprogramme<br />
auf dem Boden der künstlichen<br />
Intelligenz zu entwickeln. „Damit<br />
könnte auch anderen Anwendern geholfen<br />
werden, Befunde leichter zu erkennen und<br />
klarer zu bewerten“, sagt Geschäftsführer<br />
Uwe Fischer, der darin ein zusätzliches<br />
Entwicklungspotenzial sieht, das für die<br />
nächsten Jahre ins Auge gefasst wurde.<br />
EIN WEITERER WESENTLICHER VOR<br />
TEIL der beiden jetzt installierten<br />
MR-Systeme ist, dass sie beide einen großen<br />
Innendurchmesser aufweisen, sodass<br />
der Liegekomfort in der Untersuchungsröhre<br />
noch weiter erhöht werden konnte.<br />
Und was wäre eine Neuinstallation, wenn<br />
nicht auch das räumliche Ambiente auf einen<br />
ganz neuen Standard aufgerüstet worden<br />
wäre? Das Innendekor weist in den<br />
neuen Untersuchungsräumen hinterleuchtete<br />
Panoramaimpressionen einer Waldlandschaft<br />
auf – dies schafft für Patienten<br />
wie für MTRA und Ärzte eine angenehme<br />
und beruhigende Grundstimmung.<br />
FÜR DAS INZWISCHEN AUF 20 MIT<br />
ARBEITER angewachsene Team, das im<br />
Brust zentrum Göttingen und in der Praxis<br />
für moderne Schnittbilddiagnostik tätig<br />
ist, bedeuten die Neuanschaffungen<br />
des Mammografiegerätes im Vorjahr und<br />
der zwei Ganzkörper-MRT im Jahr <strong>2019</strong><br />
also nicht nur eine Erweiterung ihres<br />
Untersuchungs angebotes, sondern auch<br />
eine Verbesserung der Detaildarstellung<br />
und damit eine Präzisierung der erhobenen<br />
Befunde.<br />
Praxis für Moderne<br />
Schnittbild Diagnostik<br />
Bahnhofsallee 1d<br />
37081 Göttingen<br />
Tel. 0551 8207422<br />
info@diagnostik-goettingen.de<br />
www.diagnostik-goettingen.de<br />
Diagnostisches Brustzentrum<br />
Göttingen<br />
Bahnhofsallee 1d<br />
37081 Göttingen<br />
Tel. 0551 820740<br />
info@brustzentrum-goettingen.de<br />
www.brustzentrum-goettingen.de<br />
GESUNDHEıT 2 | <strong>2019</strong> 13
Wertschätzung ist das A und O<br />
Bei Quattek & Partner wird vieles möglich gemacht: vor allem für die <strong>Gesundheit</strong> der Angestellten.<br />
TEXT ANJA DANISEWITSCH FOTOGRAFIE ALCIRO THEODORO DA SILVA<br />
Am Empfangstresen der Steuerkanzlei<br />
Quattek & Partner wird jeder<br />
mit einem Lächeln begrüßt. Eine<br />
angenehme Atmosphäre liegt buchstäblich<br />
im Raum. Im Besprechungszimmer gibt es<br />
Kaffee und Kekse – auch mit einem Lächeln<br />
serviert. „Wertschätzung findet bei<br />
uns auf allen Ebenen statt“, sagt Miriam<br />
Engel (Foto), seit 2011 Partnerin der<br />
Kanzlei. „Wir versuchen, in der Kanzlei<br />
vieles möglich zu machen“ sagt die Steuerberaterin,<br />
die alljährlich die <strong>Gesundheit</strong>swoche<br />
bei Quattek & Partner organisiert.<br />
EIGENTLICH HÄTTE SIE einen ‚cooleren‘<br />
Namen verdient: Denn in dieser speziellen<br />
Woche geht es nicht um langweilige Vorsor<br />
ge untersuchungen, sondern um spannende<br />
Themen rund ums Wohlbefinden: Wie<br />
können wir uns im Büro gesünder ernähren?<br />
Wie reduzieren wir Stress? Oder wie<br />
in diesem Jahr: Wie funktioniert eigentlich<br />
gutes Zeitmanagement? Dazu lud die<br />
Kanzlei Zach Davis, Speaker und Bestsellerautor,<br />
ein, um über Zeitintel ligenz<br />
nachzudenken. Denn permanente Ablenkungen<br />
im Arbeitsalltag halten uns davon<br />
ab, in Phasen konzentrierten Arbeitens zu<br />
kommen, durch welche wir produktiver<br />
sein können und zudem weniger gestresst<br />
sind. „An diesem Tag habe auch ich noch<br />
viel lernen können“, erinnert sich Engel.<br />
Und um noch eine Stufe weiterzugehen,<br />
kam noch Coach Vanessa Freitag für einen<br />
Tag in die Kanzlei und sprach über<br />
Glück und den Weg dorthin. Manchmal<br />
reicht ein kurzes Inne halten oder eine<br />
ZenMeditation, um im Arbeitsalltag<br />
wieder Kraft schöpfen zu können.<br />
Welche Themen relevant sind, entscheiden<br />
vor allem die Angestellten. „Wir sind<br />
natürlich ein Wirtschaftsunternehmen.<br />
Aber uns geht es nicht nur um Umsatz.<br />
Wir möchten zufriedene Mandanten und<br />
zufriedene Angestellte – denn das eine bedingt<br />
das andere“, so Engel. „Wir als<br />
Chefs müssen das vorleben und es schaffen,<br />
dass unsere Mitarbeiter genügend Freiraum<br />
spüren.“ Es ist ein Familien gedanke,<br />
der in den Räumen von Quattek & Partner<br />
gelebt wird. Dafür wurde extra ein monatlicher<br />
hauseigener TÜV – TeamÜbergreifende<br />
Veranstaltungen – ins Leben<br />
gerufen. Auch hierbei wird sozusagen<br />
basis demokratisch entschieden, welche<br />
Highlights die nächsten sein sollen. Ein<br />
KaffeeSeminar bei Contigo, Rennrodeln<br />
in Oberhof, Altstadtlauf, Brockenaufstieg,<br />
Grillen im Sommer und Weihnachtsmarkt<br />
im <strong>Winter</strong> – die Ideen gehen scheinbar nie<br />
aus.<br />
„UNSER ZIEL SIND lebenslange Arbeitsverhältnisse<br />
– und dass unsere Mitarbeiter<br />
gern bei uns sind“, sagt die Partner<br />
Steuerberaterin und erinnert sich an eine<br />
ehemalige Mitarbeiterin, die erst mit<br />
80 Jahren in Rente ging, weil sie ihre Arbeit<br />
dort liebte. ƒ<br />
14<br />
GESUNDHEıT 2 | <strong>2019</strong>
ANZEIGE<br />
Sechs Fragen an Stefan Burghardt,<br />
Gründer der Anwaltskanzlei RKM medic<br />
Vor einem Jahr hat Stefan Burghardt die Göttinger Medizinkanzlei RKM medic gegründet.<br />
Gemeinsam mit der Burghardt Consulting GmbH und der RKM Data GmbH hat er damit<br />
einen Beratungsschwerpunkt in der <strong>Gesundheit</strong>sbranche etabliert.<br />
PROFIL<br />
Stefan Burghardt<br />
Sie haben sich vor gut einem Jahr für die<br />
Freiberuflichkeit entschieden, warum?<br />
Ich war viele Jahre in verschiedenen Fachund<br />
Führungspositionen im <strong>Gesundheit</strong>swesen<br />
tätig. So konnte ich jede Menge<br />
Berufserfahrung und Branchenexpertise<br />
sammeln, ein gutes Verständnis für Fragestellungen<br />
entwickeln, was es heißt, Beratungsleistungen<br />
optimal und kundenorientiert<br />
anzubieten. Das wollte ich nun in<br />
eigener Verantwortung umsetzen.<br />
Was meinen Sie damit?<br />
Bei der juristischen Beratung ist neben<br />
fundiertem juristischem Know-how auch<br />
ein gesunder Pragmatismus gefragt. Berate<br />
ich beispielsweise medizinische Unternehmen<br />
in arbeitsrechtlichen Fragen, weiß ich<br />
aufgrund meiner langjährigen Erfahrung<br />
als Personalleiter, was unternehmensintern<br />
tatsächlich umsetzbar ist und was nur<br />
rechtliche Theorie bleibt. Die rechtliche<br />
Theorie behalte ich dann für mich.<br />
Was sind die Beratungsschwerpunkte von<br />
RKM medic?<br />
Meine Beratungsschwerpunkte liegen im<br />
Medizinrecht, Gesellschaftsrecht und Arbeitsrecht.<br />
Dieses interdisziplinäre Verständnis<br />
hilft mir häufig bei der Gestaltung<br />
von Praxisübergaben oder Unternehmensverkäufen.<br />
Da bestehen mit allen genannten<br />
Rechtsgebieten Berührungspunkte. Das<br />
kann ich dann alles aus einer Hand bieten.<br />
Was waren die Herausforderungen in<br />
ihrem ersten Jahr?<br />
Eine große Herausforderung war die Bewältigung<br />
der Vielzahl von administrativen<br />
Themen, die ein Aufbau von Unternehmen<br />
mit sich bringt. Glücklicherweise hatte ich<br />
durch die Gemeinschaft mit der Anwaltskanzlei<br />
RKM hier große Unterstützung.<br />
Sie haben noch weitere Unternehmen?<br />
Mein Ansatz war es von Anfang an, einen<br />
ganzheitlichen Beratungsansatz anzubieten.<br />
Daher gibt es neben der Anwaltskanzlei<br />
RKM medic noch die RKM Data GmbH<br />
für den Datenschutz und die Burghardt<br />
Consulting GmbH als klassische Unternehmensberatung.<br />
Alle drei Unternehmen sind<br />
inhaltlich miteinander verzahnt.<br />
Bleibt eigentlich noch Zeit für private Dinge?<br />
Meine Familie ist mir sehr wichtig. Daher<br />
versuche ich, die verbleibende Zeit mit ihr<br />
zu verbringen. Ferner habe ich das Weitwandern<br />
für mich entdeckt und bereits die<br />
ersten 24-Stunden-Touren absolviert.<br />
KONTAKT<br />
RKM medic<br />
Anwaltskanzlei für<br />
medizinische Unternehmen und Berufe<br />
Bertha-von-Suttner-Str. 9<br />
37085 Göttingen<br />
Tel. 0551 70728-0<br />
www.rkm-medic.de
16<br />
GESUNDHEıT 2 | <strong>2019</strong>
Mehr als nur<br />
Schnipp-Schnapp<br />
Die vier beeindruckenden Leistungen der Plastischen Chirurgie<br />
TEXT CAROLIN SCHÄUFELE<br />
FOTOS STOCK.ADOBE.COM<br />
Der Trend ist ungebrochen –<br />
Schönheitsoperationen. Mit<br />
Argusaugen sitzen wir vor<br />
den Bildschirmen und Zeitungen,<br />
vergleichen Vorher- und Nachher-<br />
Bilder von Stars und Sternchen. Hat sie<br />
oder er was machen lassen? Und wenn ja,<br />
was? Ist es gut geworden? Ganz klammheimlich<br />
erwischen wir uns bei dem<br />
Gedanken, vielleicht selbst einmal Botox<br />
und Co. auszuprobieren. Aber natürlich<br />
nur ganz wenig, schließlich soll es ja<br />
keiner merken, man will nur ein bisschen<br />
frischer, jünger wirken.<br />
Weit über 77.000 ästhetisch-chirurgische<br />
Eingriffe zählte die Deutsche Gesellschaft<br />
der Plastischen, Rekonstruktiven<br />
und Ästhetischen Chirurgen allein im<br />
Jahr 2018 – nur von einem Trend zu sprechen,<br />
fällt dabei schwer. Die Eingriffe<br />
erfreuen sich wachsender Beliebtheit, bei<br />
Männern und Frauen.<br />
WER BEI PLASTISCHER CHIRURGIE<br />
allerdings ausschließlich an klassische<br />
Schönheitsoperationen wie Facelifting,<br />
Bauchdeckenstraffung, Brustvergrößerung<br />
oder -verkleinerung denkt, der liegt falsch.<br />
Denn tatsächlich umfasst die Plastische<br />
Chirurgie noch ganz andere Bereiche. Bereiche,<br />
die nicht in erster Linie der reinen<br />
Schönheit dienen, sondern medizinische<br />
Notwendigkeit besitzen. „Es geht um die<br />
Wiederherstellung der intakten äußeren<br />
Form des menschlichen Körpers, inklusive<br />
damit verbundener Funktionen“, definiert<br />
die Deutsche Gesellschaft für Ästhetisch-Plastische<br />
Chirurgie.<br />
Unfallverletzungen, Schäden nach Tumoroperationen,<br />
Verbrennungen oder<br />
angeborene Fehlbildungen sind solche<br />
Fälle, die durch chirurgische Eingriffe<br />
behandelt und behoben werden.<br />
Und so haben sich in den vergangenen<br />
Jahren die Bereiche Handchirurgie, Verbrennungschirurgie<br />
und Rekonstruktive<br />
und Ästhetische Chirurgie herausgebildet.<br />
Mit teils unglaublichen Auswüchsen ...<br />
GESUNDHEıT 2 | <strong>2019</strong> 17
PLASTISCHE CHIRURGIE<br />
REKONSTRUKTIVE CHIRURGIE<br />
stellt Funktionen des Körpers nach<br />
Verletzungen, Tumorentfernungen<br />
oder Fehlbildungen wieder her.<br />
HANDCHIRURGIE<br />
beschäftigt sich mit Verletzungen,<br />
Fehlbildungen und Erkrankungen von<br />
Hand und Unterarm.<br />
VERBRENNUNGSCHIRURGIE<br />
beschäftigt sich mit der Behandlung<br />
von Verbrennungen.<br />
ÄSTHETISCHE CHIRURGIE<br />
nimmt Eingriffe ohne medizinische<br />
Notwendigkeit vor, die auf Wunsch<br />
des Patienten erfolgen.<br />
Exkurs: Abstammung der<br />
Begrifflichkeiten<br />
Plastisch, ästhetisch, kosmetisch:<br />
Diese drei Begriffe tauchen im<br />
Bereich der Chirurgie immer wieder<br />
auf, können jedoch nicht immer klar<br />
voneinander abgegrenzt werden.<br />
Das Wort ,plastisch‘ stammt von dem<br />
griechischen Wort ,plastikos‘ ab, was so<br />
viel bedeutet wie ,zum Bilden, Formen,<br />
Gestalten‘. Heute steht der Begriff auch<br />
für ,modellierfähig, knetbar, formbar‘<br />
und wird im medizinischen Bereich<br />
für eine formende, bildende Operation<br />
genutzt. ,Ästhetisch‘ stammt ebenfalls<br />
aus dem Griechischen, von dem<br />
Wort ,aisthetikós‘, was ,wahrnehmen‘<br />
bedeutet. Heute steht der Begriff<br />
für ,stilvoll, schön, geschmackvoll,<br />
ansprechend‘. Auch ,kosmetisch‘ hat<br />
griechische Wurzeln, die Übersetzung<br />
lautet ,zum Schmücken, Putzen‘,<br />
was die tiefere Bedeutung des<br />
oberflächlichen, äußerlichen oder<br />
vordergründigen Vorgehens aufgreift.<br />
KLINGT NACH FRANKENSTEINS<br />
VERSUCHSLABOR?<br />
Die Rekonstruktive und die Ästhetische<br />
Chirurgie haben viele Berührungspunkte,<br />
im Ansatz jedoch verschiedene Hintergründe.<br />
Denn die Korrektur oder Rekonstruktion<br />
von Körperteilen oder -funktionen<br />
hat häufig auch eine ästhetische<br />
Komponente.<br />
So hat ein US-amerikanischer Chirurg<br />
einer Soldatin, die ihr linkes Ohr bei einem<br />
Unfall verloren hat, ein neues angenäht,<br />
das vorher unter der Haut ihres<br />
linken Arms gewachsen war. Er entnahm<br />
ihr dazu Rippenknorpelgewebe, formte<br />
daraus ein Ohr und pflanzte es unter die<br />
Haut ihres Unterarms, damit sich Haut,<br />
Nerven und neue Blutgefäße bildeten. Anschließend<br />
verpflanzte er das ,neue‘ Ohr,<br />
sodass sie neben dem Gefühl, einen vollständigen<br />
Körper zu haben, mit der Muschel<br />
auch wieder wesentlich besser hören<br />
konnte. (Mehr dieser spannenden Erkenntnisse<br />
zu den neuesten Fortschritten<br />
der Wissenschaft gibt es ab Seite 28.)<br />
Die Rekonstruktive Chirurgie setzt genau<br />
an diesen Punkten an: Sie korrigiert<br />
Haut, Weichteile, Muskeln, Sehnen und<br />
periphere Nerven sowie Knochen und<br />
Knorpel. Krebspatienten nach einer Tumoroperation,<br />
Unfallopfer, die Gliedmaßen<br />
verloren haben, Fehlbildungen seit Geburt<br />
wie eine Lippen-Kiefer-Gaumen-Spalte<br />
oder auch die Korrektur von Narben – die<br />
Liste der Einsatzgebiete ist lang.<br />
Durch die rasante Entwicklung der medizinischen<br />
Möglichkeiten sind die Ergebnisse<br />
unübersehbar besser. Gerade<br />
Krebspatienten profitieren davon. Bei der<br />
umfassenden Entfernung von Tumoren<br />
verliert der Patient oft ganze Bereiche von<br />
Körperteilen wie ein Auge oder die Nase,<br />
was mit der Wiederherstellungschirurgie<br />
aufgefangen werden kann. Für viele<br />
Brustkrebspatientinnen, bei denen eine<br />
umfassende Operation notwendig war,<br />
stellt die Brustrekonstruktion eine Möglichkeit<br />
dar, um das eigene Körpergefühl<br />
wieder zu verbessern.<br />
Wiederherstellungschirurgie hat also<br />
nicht nur eine physische Notwendigkeit,<br />
sondern auch eine psychische: sich vor<br />
Selbstzweifeln, depressiven Stimmungen,<br />
sozialer Ausgegrenztheit zu schützen.<br />
Etwas anders sieht es mit der Ästhetischen<br />
Chirurgie oder Schönheitschirurgie<br />
18<br />
GESUNDHEıT 2 | <strong>2019</strong>
aus. Sie dient ausschließlich der eigenen Schönheit. Selbstzweifel,<br />
der äußere Anspruch und mögliche soziale Ablehnung sind<br />
Gründe, um den eigenen Körper ,besser‘ machen zu wollen. Ob<br />
der Höcker an der Nase, Fettpolster an ungeeigneten Stellen<br />
oder Falten: Hier kann die Ästhetische Chirurgie helfen. Nasen<br />
werden begradigt, Fett abgesaugt und Falten mit Botox stillgelegt<br />
oder mit Hyaluron aufgefüllt. Und schon passt das Spiegelbild<br />
viel besser zu mir – ich fühle mich wohl.<br />
DIE WELT ,BEGREIFEN‘<br />
Ein weiteres Spezialgebiet der Chirurgie ist die Handchirurgie,<br />
entstanden durch eine Verschmelzung von Chirurgie<br />
und Orthopädie. Die Hand ist ein kleines, aber ungemein<br />
wichtiges Organ. Ihr wird sogar nachgesagt, dass<br />
sie eine wichtige Rolle im Evolutionsprozess hat.<br />
Hand und Gehirn – dieses Zusammenspiel und<br />
die Einmaligkeit ihres Aufbaus macht den Menschen<br />
aus. Umso wichtiger ist es, dass dieses<br />
,Werkzeug‘ durch das Zusammenspiel der<br />
anatomischen Struktur von Knochen, Gelenken,<br />
Muskeln und Sehnen, Nerven und Blutgefäßen<br />
auch seine Funktionen erfüllen<br />
kann: Greifen, Fassen, Malen, Tippen,<br />
Schreiben, Schneiden und vieles mehr.<br />
Wer sich an der Hand verletzt<br />
oder erkrankt, sollte einen Arzt<br />
mit umfangreichen Kenntnissen<br />
über deren Aufbau aufsuchen,<br />
der also genauestens über die<br />
Feinstrukturen Bescheid weiß.<br />
Durch die Entwicklung von<br />
mikrochirurgischen Techniken<br />
und OP-Material wie Mikroskopen<br />
und Instrumenten sind Ärzte<br />
mittlerweile in der Lage, feinste Nerven<br />
und Gefäße wieder zu rekonstruieren oder<br />
abgetrennte Finger wieder anzunähen. Doch nicht<br />
nur die Hand wird in der Hand chirurgie betreut,<br />
auch der Arm bis hinauf zur Schulter fällt in diesen<br />
medizinischen Bereich.<br />
1,5 BIS 4 MM SCHUTZSCHICHT – UNSERE HAUT<br />
Die Haut ist das größte und empfindlichste Sinnesorgan,<br />
das wir haben. Es ist nicht nur die Abgrenzung<br />
von innen und außen, es übernimmt auch Funktionen im<br />
Bereich Stoffwechsel und Wärmeregulation. Hautkontakte<br />
sind beispielsweise lebenswichtig für uns Menschen, nicht nur<br />
für Kinder.<br />
Umso wichtiger, dass unser Schutz vor der Umwelt auch funktioniert.<br />
Wird die Haut jedoch durch Verbrennungen, Verätzungen<br />
oder Verbrühungen verletzt, dann ist schnelle Hilfe angesagt.<br />
Und hier kommt die Verbrennungschirurgie ins Spiel, der<br />
vierte Teilbereich der Plastischen Chirurgie.<br />
GESUNDHEıT 2 | <strong>2019</strong> 19
Meist hat die Verbrennungschirurgie<br />
mit Notfällen zu tun. Als erste Maßnahmen<br />
bei der Behandlung gelten die Kreislaufstabilisierung<br />
und die Versorgung mit<br />
Schmerzmitteln sowie der Schutz vor Unterkühlung<br />
und Verkeimung der Wunde.<br />
Verbrennungen der Haut gehen mit einer<br />
aufwendigen Patientenversorgung einher,<br />
die sich zur Wiederherstellung der Bewegungsfunktionen<br />
auch um eine ästhetische<br />
Behandlung kümmert. Entstellende<br />
Narben werden beseitigt. Was viele nicht<br />
wissen: Seit den 1960er-Jahren wurde in<br />
der Bundesrepublik ein Netz von Verbrennungszentren<br />
aufgebaut, das Brandopfern<br />
schnelle und umfassende Hilfe<br />
bietet.<br />
SECHS JAHRE WEITERBILDUNG<br />
Wer Facharzt für Plastische, Rekonstruktive<br />
und Ästhetische Chirurgie werden<br />
möchte, hat als Mediziner einen langen<br />
Weg vor sich. Nach dem sechsjährigen<br />
Medizinstudium folgen weitere sechs<br />
Jahre der Weiterbildung mit unterschiedlichen<br />
Stationen in der Plastischen,<br />
Rekonstruktiven und Ästhetischen<br />
Chirurgie, der Notaufnahme und<br />
der Intensivmedizin.<br />
Der Begriff Schönheitschirurg<br />
ist übrigens nicht geschützt.<br />
Praxen und Kliniken, die den<br />
Begriff Schönheitschirurgie<br />
im Namen führen,<br />
brauchen nicht unbedingt<br />
eine Zulassung,<br />
die garantiert, dass sie durch staatliche<br />
Behörden kontrolliert werden. Anders<br />
bei niedergelassenen Ärzten, die<br />
plastische Operationen anbieten. Sie unterstehen<br />
der Berufsaufsicht durch die<br />
Ärztekammer und haften für die von ihnen<br />
durchgeführten Eingriffe. Sicher häufig<br />
gar nicht schlecht, eine Absicherung<br />
zu haben. Wer das nicht glaubt, sollte im<br />
Internet unter dem Begriff ,Plastic Surgery<br />
Gone Wrong‘ suchen. (Mehr zum<br />
Thema Schönheitschirurgie gibt es im Interview<br />
mit der Expertin ab Seite 40.)<br />
PLASTISCHE CHIRURGIE IST GAR NICHT<br />
SO NEU<br />
Die Anfänge der Plastischen Chirurgie<br />
liegen übrigens ziemlich weit zurück.<br />
Erstmals 1350 v. Chr. wurden plastische<br />
Chirur gen in Indien erwähnt, die eine<br />
menschliche Körperoberfläche rekonstruierten.<br />
Ägyptische Chirurgen entwickel ten<br />
bereits eine wiederherstellende Gesichtschirurgie<br />
– an Mumien fand man operativ<br />
wiederangebrachte Ohren. Zwischen<br />
1200 und 1700 v. Chr. tauchte in Indien<br />
das erste Mal der Begriff Nasen operation<br />
auf. Damals wurde Dieben und Ehebrechern<br />
als drakonische Strafe die Nase abgeschnitten.<br />
Die Wiederherstellung dieses<br />
Körperteils war für eine Rehabilitierung<br />
in die Gesellschaft Voraussetzung. (Mehr<br />
zur Geschichte finden Sie ab Seite 22.)<br />
Schon damals war die körperliche Unversehrtheit<br />
ein nicht zu unterschätzender<br />
gesellschaftlicher Faktor. So wie heute. ƒ<br />
20<br />
GESUNDHEıT 2 | <strong>2019</strong>
PROFIL<br />
ANZEIGE<br />
FOTO: R+MEDITRANSPORT<br />
Anders als die anderen R+ MediTransport setzt auf ein rundum gutes Arbeitsklima.<br />
R+ MediTransport<br />
Offene Türen, Transparenz und Potenzialentfaltung anstatt Micro-Controlling und starre Strukturen<br />
Es ist nicht so wie bei anderen Krankentransport-<br />
oder Rettungsdienstunternehmen.<br />
Wer die Räumlichkeiten<br />
von R+ MediTransport betritt, steht<br />
direkt in der Kaffeeküche, einer Art Zentrum<br />
der Gemeinschaft und Treffpunkt<br />
der Teammitglieder. Hier wird gemeinsam<br />
gekocht, gegessen, hier werden die Besprechungen<br />
abgehalten. Für Geschäftsführer<br />
Florian Reinhold ist das ein Baustein für<br />
ein gutes Arbeitsklima: „Die Umgestaltung<br />
unserer Räumlichkeiten am Hauptsitz<br />
war nur der Start eines großen Projektes.<br />
Vielmehr arbeiten wir an einer neuen Führungs-<br />
und Unternehmenskultur.“ Reinhold<br />
sind bei der Führung des Familienunternehmens<br />
mit Hauptsitz in Gieboldehausen<br />
Dinge wie Offenheit und Respekt wichtig.<br />
Führung will er bei R+ MediTransport als<br />
Coaching verstanden wissen. Für die Mitarbeiter<br />
muss der Weg bereitet werden, damit<br />
sie ihren Job gut machen können.<br />
BEREITS SEIT 1954 BIETET DER<br />
FAMILIEN BETRIEB Krankenbeförderung<br />
rund um die Uhr. Schon seit 1984 ist der<br />
qualifizierte Krankentransport – als Teil des<br />
Rettungswesens – das Kerngeschäft des<br />
südniedersächsischen Unternehmens.<br />
R+ MediTransport befindet sich noch<br />
mittendrin im Prozess der Leitbildfindung.<br />
„Wir haben nach dem Sinn unserer Arbeit<br />
gefragt und Werte für unsere Zusammenarbeit<br />
im Team gesucht“, erklärt Reinhold.<br />
Teamfähigkeit, Ehrlichkeit und Vertrauen<br />
sind drei der insgesamt sechs Werte, die<br />
der Zusammenarbeit einen Rahmen geben<br />
sollen. Ein weiteres Ergebnis aus den Kulturveranstaltungen<br />
sei, dass für das Team<br />
die Sinnstiftung insbesondere in einem<br />
Lächeln des Kunden liege. „Dafür arbeiten<br />
wir.“ Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter<br />
wollen sich zukünftig auch über die eigentliche<br />
Arbeit hinaus sozial engagieren<br />
können. Neben Persönlichkeitsentwicklung,<br />
dem Know-why, ist bei R+ MediTransport<br />
aber auch das medizinisch-fachliche Knowhow<br />
von größter Bedeutung, das in der eigenen<br />
Fortbildungsakademie vermittelt wird.<br />
REINHOLD HAT SICH IM RAHMEN seiner<br />
Tätigkeit im Vorstand des Landesverbandes<br />
privater Rettungsdienste in Norddeutschland<br />
e. V. für einen Tarifvertrag der<br />
privaten Rettungsdienste mit einem Tarifpartner<br />
eingesetzt. „Am 1. Juli dieses Jahres<br />
haben wir ihn erfolgreich abgeschlossen.“<br />
GANZ NACH DEM VORBILD in Gieboldehausen<br />
sollen auch die anderen Standorte<br />
in den Landkreisen Northeim und Goslar<br />
umgebaut werden. Im kommenden Jahr<br />
folgt ein Neubau in Northeim.<br />
KONTAKT<br />
R+ MediTransport<br />
Herzberger Landstraße 6<br />
37434 Gieboldehausen<br />
Tel. 05528 <strong>2019</strong>233<br />
www.rplus-gruppe.de<br />
TEXT: CAROLIN SCHÄUFELE
Ein blutiger Ritt<br />
durch die Geschichte<br />
Nase ab und Fett weg – der lange Weg der Plastischen Chirurgie<br />
von der Rekonstruktion zur Schönheit<br />
TEXT CLAUDIA KLAFT<br />
ILLUSTRATIONEN STOCK.ADOBE.COM<br />
Die indische Methode Als erster Nasenrekonstrukteur<br />
in der Geschichte entnimmt<br />
der Chirurg Sushruta für die Nasenformung<br />
ein blutversorgendes Gefäßteil aus der Stirn.<br />
Ehebruch – Nase ab! So ist das ten (Hasenscharten) beschreibt, darauf<br />
im alten, alten Indien viele Hundert<br />
Jahre vor Christus. Wie gut, kannt ist auch die weitere Rekonstruk-<br />
zurück? Wer weiß das schon. Recht unbe-<br />
dass Chirurg Sushruta Hilfe tionsgeschichte, bis im 15. Jahrhundert …<br />
bietet, indem er für die Nasenformung<br />
ein blutversorgendes Gefäßteil aus der … DUELLE, SYPHILIS UND KRIEGE<br />
Stirn entnimmt. Dokumentiert in der Abhandlung<br />
‚Sushruta Samita‘ geht er mit<br />
dieser ‚indischen Methode‘ als erster<br />
Nasenrekonstrukteur in die Geschichte<br />
ein. Ob alle Patienten aufatmen können,<br />
bleibt angesichts der fehlenden Anästhetika<br />
und Sterilität fraglich. In der Antike<br />
lindert man Schmerzen versuchsweise<br />
mit …<br />
ZUR VERMEHRTEN NASEN-NACHFRAGE<br />
FÜHREN. Ihrer nimmt sich der sizilianische<br />
Arzt Antonio Branca an, der die<br />
‚indische‘ zur ‚italienischen Methode‘<br />
weiterentwickelt. Oberarm statt Stirn: Er<br />
formt Nasen aus dem gestielten Armlappen<br />
(Distanzlappen) und fixiert den Arm<br />
des Patienten an dessen Nase, um die<br />
Durchblutung bis zum Anwachsen des<br />
… MOHN, OPIUM, ALRAUNE ODER<br />
Hautlappens sicherzustellen. Dieses Verfahren<br />
greift später der italienische Chirurg<br />
MANDRAGORA-WEIN. Vielleicht greifen<br />
auch der griechische Arzt Hippokrates, der<br />
400 Jahre v. Chr. Nasen korrigiert, oder<br />
der römische Mediziner Aulus Cornelius<br />
Celsus, der 50 Jahre n. Chr. Operationsmethoden<br />
von Lippen-Kiefer-Gaumen-Spalziert<br />
Gaspare Tagliacozzi auf und publi-<br />
es 1597 in seinem Werk ‚De cortorum<br />
chirurgica‘. Es ist der Grundstein<br />
der modernen Plastischen Chirurgie. Leider<br />
findet Tagliacozzi ein unrühmliches<br />
Ende, denn …<br />
22<br />
GESUNDHEıT 2 | <strong>2019</strong>
GESUNDHEıT 2 | <strong>2019</strong> 23
Der Nasen-Joseph: Als Pionier in Sachen Schönheits-OPs entwickelte der Berliner Chirurg Jacques Joseph (1865 – 1934) zahlreiche<br />
Spezialinstrumente wie kleine Sägen und Skalpelle, die teilweise heute noch in Operationssälen zu finden sind.<br />
… „GOTTGEWOLLT IST DAS AUSSEHEN<br />
DES MENSCHEN!“ schreit die katholische<br />
Kirche und verdammt seine Seele. Fortan<br />
hindern Religion, Pest und Krieg den medizinischen<br />
Fortschritt. In Schwung<br />
kommt die Rekonstruktions-Chirurgie<br />
wieder im 19. Jahrhundert, als Antiseptika<br />
sterile Operationen ermöglichen und<br />
ab 1847 Äther wie …<br />
… KOKAIN ZUR SCHMERZFREIEN BE-<br />
HANDLUNG EINGESETZT WERDEN.<br />
Na ja, der gut dosierte Einsatz muss geübt<br />
werden. Doch die Ärzte prägen Neues: So<br />
wird der Begriff Plastische Chirurgie 1838<br />
erstmals von Eduard Zeis formuliert.<br />
Und von Johann Friedrich Dieffenbach<br />
1845 als eigenständiges Gebiet in seinem<br />
Standardwerk ‚Die operative Chirurgie‘<br />
definiert. Neben der etablierten Rekonstruktionschirurgie<br />
nimmt eine weitere<br />
Säule ihren Anfang: Die …<br />
… VERBRENNUNGSCHIRURGIE: Der Genfer<br />
Chirurg Jacques Louis Reverdin ver-<br />
pflanzt 1869 Anteile der Epidermis auf gesunde<br />
Granulation, und Carl Thiersch, Direktor<br />
der Chirurgischen Universitätsklinik<br />
Leipzig, begründet 1886 die Spalthauttransplantation.<br />
Plastisch nimmt 1895 der<br />
Onkologe Vincenz Czerny die erste …<br />
… BRUSTVERGRÖSSERUNG MIT KÖRPER-<br />
EIGENEM FETTGESCHWULST (Lipom) an<br />
einer brustamputierten Krebspatientin<br />
vor. Doch die Durchblutung ist ungenügend,<br />
der Versuch scheitert wie auch<br />
weitere Experimente zu dieser Zeit mit<br />
Rinderknorpel oder Glaskugeln. Der<br />
Wunsch, ,normal‘ auszusehen, ist vorhanden.<br />
Und führt 1896 zur ‚Ästhetischen<br />
Chirurgie‘ als eigenständige Säule der<br />
‚Plastischen‘, als eine Mutter klagt …<br />
… „MOBBING! Mein Sohn wird gehänselt,<br />
weil er abstehende Ohren hat.“ Damit<br />
liegt sie Jacques Joseph in den Ohren,<br />
einem Assistenzarzt an der Berliner Charité.<br />
Er überlegt: Ein Eingriff in einen gesunden<br />
Körper, weil die Seele leidet? Und<br />
24<br />
GESUNDHEıT 2 | <strong>2019</strong>
Auf die Schnelle ohne Delle:<br />
Einer der ersten Anbieter für<br />
Nasenkorrekturen garantierte 1931 sogar<br />
den bleibenden Erfolg seiner Methode:<br />
schnell, sicher, schmerzfrei – und ganz ohne<br />
Operation. Für eine formschöne Nase sollte<br />
der Kunde sich nur ein paar Schnüre um den<br />
Kopf schnallen. Ob die Anzeige hielt, was sie<br />
versprach, ist nicht dokumentiert.<br />
lässt sich darauf ein. Die Ohren sind angelegt,<br />
der Junge glücklich. Dies gilt als<br />
Beginn der Schönheitsoperationen in<br />
Deutschland. Stolz präsentiert Joseph den<br />
Fall bei der Berliner Medizinischen Gesellschaft,<br />
erntet Ruhm …<br />
… UND DIE KÜNDIGUNG SEINES VER-<br />
ÄRGERTEN CHEFS. Der 31-Jährige eröffnet<br />
daraufhin seine eigene Praxis und<br />
setzt weitere Maßstäbe: 1904 operiert er<br />
intranasal (durch die Nasenlöcher) ohne<br />
sichtbare Narben, ersetzt Knorpel und<br />
Knochen durch Elfenbein und designt<br />
seine eigenen OP-Instrumente wie das<br />
Raspatorium, genannt ,der Joseph‘. Zwei<br />
Jahre später führt ,der Pionier der Ästhetischen<br />
Chirurgie‘ Erich Lexer die erste<br />
erfolgreiche Gesichtsstraffung durch.<br />
Doch die folgende Zeit stellt alle Ärzte<br />
vor besondere Herausforderungen: …<br />
… KRIEG! Schreckliche Verstümmelungen<br />
und Wunden, oft mit unvorstellbaren<br />
Ausmaßen. Während in Großbritannien<br />
Harold Gillies (,Vater der Plastischen<br />
Chirurgie‘) zum Pionier der Gesichtsrekonstruktionen<br />
wird, indem er neue<br />
Methoden für den Transplantationsprozess<br />
entwickelt, eröffnet die Berliner Charité<br />
unter der Leitung von Joseph 1916<br />
eine Abteilung für Gesichtsplastik, „um<br />
die Lebensqualität der Männer zu verbessern.“<br />
Schönheits-OPs …<br />
… WIE AM FLIESSBAND. Eine schwere,<br />
dennoch erkenntnisreiche Zeit. Obwohl<br />
er Jude ist, bekommt Joseph 1919 den<br />
Professorentitel und das Eiserne Kreuz<br />
verliehen. Auch nach Auflösung der Abteilung<br />
1922 behandelt der ,Vater der<br />
ästhetischen Nasenkorrektur‘ Patienten<br />
aus Europa, USA und Indien. 1931 erscheint<br />
sein Buch ‚Nasenplastik und sonstige<br />
Gesichtsplastiken nebst Mamma plastik‘.<br />
1933 muss er seine Karriere beenden,<br />
ein Jahr später verstirbt er. Es heißt, dass<br />
am Ende der Weimarer Republik die<br />
Schönheits-Chirurgie ein interessantes …<br />
… GRENZGEBIET ZWISCHEN KOSMETIK<br />
UND PSYCHOANALYSE sei, das – wenn<br />
wissenschaftlich erschlossen – reiche<br />
Früch te bringt. Zeit für die Ernte ist erst<br />
nach dem Zweiten Weltkrieg. Die Handchirurgie,<br />
begründet 1944 von Sterling<br />
Bunnell (USA), entwickelt sich zur eigenen<br />
Säule. Sein umfangreiches Werk ‚Surgery<br />
of the hand‘ wird zur ,Bibel der<br />
Handchirurgie‘. 20 Jahre später führen<br />
moderne Mikroskope nicht nur dieses<br />
Fachgebiet nach vorne. Auch die Mikrochirurgie,<br />
mithilfe derer Blutgefäße und<br />
Nervenzellen zusammengefügt werden,<br />
Nasen à la carte: In einem Album<br />
mit Vorher-Nachher-Fotos konnten<br />
sich die Patienten von Chirurg<br />
Jacques Joseph (o. l.) ihre Traumnase<br />
aus suchen. Auch die individuelle Persönlichkeit<br />
seiner Kunden hatte der Arzt damals<br />
bereits stets im Blick.<br />
GESUNDHEıT 2 | <strong>2019</strong> 25
FOTO/ILLUSTRATION: STOCK.ADOBE.COM<br />
Revolution in der Brust: Anfang der<br />
1960er-Jahre entwickelten die Chirurgen<br />
Frank Gerow und Thomas Cronin aus Houston,<br />
Texas, das erste mit Silikongel gefüllte<br />
Implantat für die Brust.<br />
bringt große Fortschritte. Ab den<br />
1950er-Jahren experimentieren Ärzte mit<br />
erneuten Möglichkeiten zur Brustvergrößerung,<br />
zum Beispiel mit Paraffin, …<br />
… BIENENWACHS ODER POLYETHYLEN.<br />
Schwere Komplikationen inklusive. Die<br />
ersten festen, dennoch unausgereiften<br />
Brust-Implantate werden 1951 eingesetzt.<br />
Was geht, was geht nicht? Ein Fachjournal<br />
für Plastische Chirurgie gründet sich.<br />
In den 1960er-Jahren transplantiert John<br />
Cobbett (UK) eine Fußzehe als Daumenersatz.<br />
1961 werden von Thomas Cronin<br />
und Frank Gerow (USA) Silikonimplantate<br />
entwickelt und eingesetzt – mit gesundheitsschädlichen<br />
Langzeitfolgen. Die<br />
Idee dazu lieferte ihnen ein Blutbeutel. Ich<br />
spanne einen Bogen: Was drin ist, muss<br />
raus, reden wir über …<br />
… FETT. Nach ersten Absaugversuchen in<br />
den 1960er-Jahren stellt sich 1980 endlich<br />
der Erfolg ein. Großes Aufsehen erregt<br />
2005 die erste Gesichtstransplantation<br />
an einem lebenden Menschen, die<br />
bisherige Grenzen sprengt. Immer schneller<br />
schreitet die Entwicklung voran, die<br />
OPs werden sicherer und – gefragter.<br />
Käufliche Schönheit wird …<br />
… ZUM MASSENPRODUKT. Für geprüfte<br />
Qualität führt die Bundesärztekammer<br />
1987 Zusatzausbildungen ein – Plastische<br />
Operationen für MKG-Chirurgen und<br />
HNO-Ärzte sowie Plastische Chirurgie<br />
für Fachärzte – und weitet diese 1992 auf<br />
drei Jahre aus und erkennt die Plastische<br />
Chirurgie als eigenständige Facharztausbildung<br />
an. Der Begriff Schönheitschirurg<br />
bleibt jedoch ungeschützt …<br />
… UND MANCHE OP HAT UNSCHÖNE<br />
FOLGEN. Dennoch erliegen viele dem täglich<br />
flüsternden Spiegel: „Aber hinter<br />
Insta gram und Co. sind Menschen, die<br />
viel schöner sind als Ihr.“ Meine Idee: Im<br />
besten Jungbrunnen-Moment lassen wir<br />
uns 3D-scannen und schicken unseren<br />
Avatar auf die Bussi-Partys, während wir<br />
zu Hause unser Gegenüber mit den Segelohren<br />
„einfach nur süß“ finden. ƒ<br />
26<br />
GESUNDHEıT 2 | <strong>2019</strong>
und deshalb für die Früherkennung von Brustkrebs<br />
Vertrauen Sie der langjährigen Erfahrung<br />
unseres Ärzteteams und sprechen Sie mit uns.<br />
Wir informieren Sie umfassend:<br />
• Dr. med. Ulla Ritter<br />
• Dr. med. Susanne Luftner-Nagel<br />
• Prof. Dr. med. Katharina Marten-Engelke<br />
• Dr. med. Friedemann Baum<br />
• Prof. Dr. med. Uwe Fischer<br />
Telefon 0551/820 740<br />
www.brustzentrum-goettingen.de<br />
info@brustzentrum-goettingen.de<br />
Bahnhofsallee 1d · 37081 Göttingen<br />
(Gegenüber Bahnhof Westausgang)<br />
Blackbit<br />
Selbst die Stärksten<br />
gehen zur Vorsorge.<br />
Seit über zehn Jahren stehen wir in<br />
Göttingen für Diagnostik auf höchstem<br />
Niveau. Dank langjähriger Erfahrung<br />
und modernster Diagnoseverfahren<br />
sind wir in der Lage pathologische Veränderungen<br />
im ganzen Körper frühzeitig<br />
zu erkennen. Wir nehmen uns<br />
genau die Zeit, die es baucht, um mit<br />
Ihnen sinnvolle Untersuchungsstrategien<br />
zu entwickeln und diese mittels<br />
Ganz- oder Teilkörperchecks durchzuführen.<br />
SELBST DIE STÄRKSTEN<br />
GEHEN ZUR VORSORGE.<br />
Wir sind für Sie da. Schon innerhalb<br />
von 24 Stunden.<br />
Mehr Informationen unter<br />
Seit über zehn Jahren stehen wir in Göttingen für Diagnostik auf höchstem Niveau. Dank www.diagnostik-goettingen.de<br />
langjähriger Erfahrung und modernster Diagnoseverfahren ist unser Team in der Lage pathologische<br />
Veränderungen im ganzen Körper frühzeitig zu erkennen. Wir nehmen uns genau die Zeit, die es<br />
braucht, um mit Ihnen sinnvolle Untersuchungsstrategien zu entwickeln und diese mittels Ganz- oder<br />
Teilkörperchecks durchzuführen. Mehr Informationen unter www.diagnostik-goettingen.de.<br />
Wir sind für Sie da. Mit Terminen innerhalb von 24 Stunden.<br />
Praxis für moderne Schnittbild Diagnostik ∙ Bahnhofsallee 1d ∙ 37081 Göttingen ∙ (0551) 82 074 22
„Das ist ein erfüllendes<br />
Gefühl, zu sehen, wenn<br />
man in einem großen<br />
Team das Wissen der<br />
Ästhetik einfließen<br />
lassen und so einem<br />
Unfall- oder Kriegsopfer<br />
Lebensqualität<br />
zurückgeben kann.“<br />
Gunther Felmerer<br />
28<br />
GESUNDHEıT 2 | <strong>2019</strong>
Reise in<br />
die Zukunft<br />
Ein Fortschritt jagt den nächsten. Hand in Hand setzen sich<br />
Ärzte und Wissenschaftler im Bereich der Plastischen Chirurgie<br />
für eine Verbesserung der Lebenssituation vieler Menschen ein –<br />
dabei geht es um weit mehr als nur um die Ästhetik.<br />
TEXT STEFAN LIEBIG<br />
WUSSTEN SIE SCHON, DASS …<br />
... ES MÖGLICH IST, EIN OHR IM ARM<br />
WACHSEN ZU LASSEN?<br />
FOTO: OTTOBOCK<br />
Hand aufs Herz: Woran denken<br />
Sie spontan, wenn Sie den Begriff<br />
„Plastische Chirur gie“<br />
hören? Brustvergrößerung,<br />
Facelifting, Nasen-OP, Fettabsaugung –<br />
waren die Umfrageergebnisse einer nicht<br />
ganz repräsentativen Umfrage des Autors<br />
dieses Beitrags. „Aber es geht in der Plastischen<br />
Chirurgie längst nicht nur um<br />
Schönheitseingriffe, sondern vielmehr<br />
auch um die Wiederherstellung nach<br />
Krankheiten oder Unfällen“, sagt Claudia<br />
Choi-Jacobshagen, Chefärztin der Klinik<br />
für Plastische, Ästhetische und Rekonstruktive<br />
Chirurgie am Evangelischen<br />
Krankenhaus Göttingen-Weende (EKW).<br />
Sie verweist auf die vielen Rekonstruktionen<br />
nach Verbrennungen, Unfällen oder<br />
Krebsoperationen.<br />
Mit modernsten Techniken setzen die<br />
Mediziner alles daran, den Patienten zu<br />
helfen und verletzte oder verlorene Funktionen<br />
und Gewebe möglichst originalgetreu<br />
wiederherzustellen. „Erst in den<br />
letzten Jahren erkennen die Menschen<br />
mehr und mehr, dass wir als spezialisierte<br />
Ärzte nicht nur menschliche Eitelkeiten<br />
befriedigen, sondern sehr oft Patienten in<br />
schlimmen Notlagen helfen“, sagt auch<br />
Gunther Felmerer von der Klinik für Unfallchirurgie,<br />
Orthopädie und Plastische<br />
Chirurgie bei der Universitätsmedizin<br />
Göttingen (UMG).<br />
FELMERER ÜBERTREIBT NICHT, wenn er<br />
von Patienten in Not spricht. Denn sehr<br />
häufig versorgt der Leiter des Schwerpunktbereichs<br />
Plastische Chirurgie mit<br />
seinem interdisziplinären Team Kriegsopfer,<br />
die einen Arm oder ein Bein verloren<br />
haben. Zu diesem Team gehören unter<br />
anderem Orthobioniker Frank Braatz<br />
und Assistenzärztin Jennifer Ernst. Sie<br />
behandeln die oft nur unzureichend versorgten<br />
Verstümmelungen der Patienten<br />
und bereiten diese für die Anpassung an<br />
eine hochmoderne Prothese vor.<br />
Doch längst sind diese kein lebloses<br />
Material mehr, das nur wenige Funktionen<br />
erfüllt. Vielmehr arbeiten Experten<br />
inzwischen an der Verbindung der durch<br />
den Unfall abgetrennten Nervenbahnen<br />
Plastische Chirurgen des<br />
Armeekrankenhauses El Paso<br />
haben einer Soldatin ein neues<br />
Ohr verpflanzt, das sie zuvor<br />
ein Jahr lang in deren Unterarm<br />
herangezüchtet haben. Dafür<br />
entnahmen sie Gewebe aus ihrem<br />
Rippenknorpel, vermehrten es im<br />
Labor und modellierten es. Dann<br />
verpflanzten sie das Imitat in den<br />
Arm – die Konturen waren unter<br />
der Haut deutlich zu erkennen. Das<br />
Ohr verfügt über frische Arterien,<br />
Venen und einen frischen Nerv,<br />
sodass es auch wieder Gespür hat.<br />
Ob alle Prognosen in Erfüllung<br />
gehen, lässt sich jedoch erst nach<br />
einigen Jahren mit Bestimmtheit<br />
sagen. Der richtige Mix ist auch mit<br />
modernster Labortechnik schwierig,<br />
denn Körpergewebe besteht immer<br />
aus mehreren verschiedenen<br />
Zelltypen, und die Versorgung mit<br />
Blut- und Nervenbahnen ist extrem<br />
kompliziert. Funktionsausfall oder<br />
Wucherungen können auftreten.<br />
GESUNDHEıT 2 | <strong>2019</strong> 29
WUSSTEN SIE SCHON, DASS …<br />
mit den Hightech-Prothesen. Sowohl bei<br />
dem neuen Körperendglied als auch bei<br />
dem künstlichen Ersatz kommt es auf<br />
Teamwork von Chirurgen, Orthobionikern<br />
und einer ganzen Reihe weiterer Experten<br />
an. Neben der reinen Funktionalität<br />
spielt in der heutigen Zeit auch die<br />
Optik eine immer wichtigere Rolle. Im<br />
Idealfall ist es kaum noch zu erkennen,<br />
dass der Patient eine neue Hand oder ein<br />
neues Bein trägt. „Das ist ein erfüllendes<br />
Gefühl, zu sehen, wenn man in einem<br />
großen Team das Wissen der Ästhetik<br />
einfließen lassen und so einem Unfalloder<br />
Kriegsopfer Lebensqualität zurückgeben<br />
kann“, so Felmerer über die<br />
motivierenden Momente als Plastischer<br />
Chirurg, wenn ein Mensch sich dank professioneller<br />
Versorgung wieder weitgehend<br />
schmerzfrei und natürlich bewegt.<br />
... es bereits Organe und Gewebe<br />
aus dem 3D-Drucker gibt?<br />
Was sich vor wenigen Jahren noch wie der Plot für einen Film anhörte,<br />
rückt immer näher an die Realität: Wissenschaftler entwickeln Methoden,<br />
Organe per 3D-Druck erzeugen zu können. Ist das ein Meilenstein für die<br />
Transplantationsmedizin oder überschreiten Mediziner damit ethische Grenzen?<br />
Diese Frage wird wohl zu heißen Diskussionen in Ethikräten führen. Aus<br />
wissenschaftlicher Sicht ist diese innovative Technik aber zweifellos eine große<br />
Chance, die Hoffnung für viele wartende Patienten bieten könnte. So konnten<br />
amerikanische Forscher bereits 2014 Gesichtsrekonstruktionen realisieren,<br />
2018 fand die erste Gesichtstransplantation statt, und kürzlich druckten die<br />
Forscher erstmals eine funktionsfähige linke Herzkammer aus Kollagen und<br />
Herzmuskelzellen. Nicht ganz so erfolgreich war ein israelischer Wissenschaftler,<br />
dessen ,Mini-Herz‘ noch nicht funktionstüchtig war. Formstabilität und<br />
Detailgenauigkeit sind die wesentlichen Aspekte des 3D-Drucks. Für die<br />
realitätsnahe Reproduktion von Organen und Geweben werden auch<br />
Biomaterialien wie Algenextrakte oder Kollagen getestet. Ihnen fehlt im<br />
Unterschied zu Kunststoff, Metall oder Epoxidharz noch die Dauerhaftigkeit.<br />
NATÜRLICH SIND SOLCHE ERFOLGE<br />
nicht alleine von der UMG zu erzielen.<br />
Denn wo die Chirurgie aufhört, setzt<br />
nahtlos ein anders Fachgebiet an: Zur optimalen<br />
Versorgung gehören auch die<br />
hochmodernen und individuellen Prothesen<br />
und Orthesen. Hier setzen die Mediziner<br />
auf die Zusammenarbeit mit dem<br />
Global Player Ottobock aus Duderstadt.<br />
In dessen Entwicklungsabteilung werden<br />
komplexe Komponenten von Hilfsmitteln<br />
erforscht und konstruiert, und es<br />
wird mit Hochdruck an Verbesserungen<br />
gearbeitet. Moderne myoelektrische<br />
Arm prothesen werden über verbliebene<br />
Muskelaktivität im Stumpf gesteuert.<br />
Über im Prothesenschaft integrierte Elektroden<br />
werden diese Anspannungen der<br />
Muskulatur an die Motoren der Komponenten<br />
weitergeleitet, und dies führt dann<br />
beispielsweise zum Schließen der Hand.<br />
Entwickler können bereits eine vereinfachte<br />
und intuitivere Steuerung von Prothesen<br />
zur Verfügung stellen, zum Teil<br />
können dadurch sogar Phantomschmerzen<br />
eingedämmt werden – und sie kommen<br />
dem Durchbruch im Bereich des<br />
Fühlens immer näher. So können die<br />
Patien ten hoffen, bald wieder Temperaturen<br />
oder Druck empfinden zu können.<br />
Daniela Wüstefeld, Ergotherapeutin bei<br />
Ottobock, arbeitet seit fünf Jahren regelmäßig<br />
mit dem Team um Felmerer zusammen.<br />
Im 14-tägigen Turnus findet<br />
eine gemeinsame interdisziplinäre Spezialsprechstunde<br />
für Amputationsmedizin in<br />
der UMG statt. Im Patient Care Center<br />
Duderstadt/Berlin kümmert sie sich in<br />
Zusammenarbeit mit ihren Kollegen der<br />
Orthopädietechnik um die Anpassung der<br />
Prothese. Vor und nach der Operation<br />
werden die Patienten auf die Prothese<br />
vorbereitet, und während der Anpassung<br />
finden Trainingseinheiten statt, in denen<br />
das Greifen, Halten und Loslassen von<br />
Gegenständen mit der Prothese geübt<br />
wird. „Wir leben dieses Teamwork und<br />
arbeiten hier ohne Hierarchien und interdisziplinär<br />
zum Wohl der Patienten“, sagt<br />
Wüstefeld und betont, wie intensiv die<br />
FOTO: OTTOBOCK<br />
30<br />
GESUNDHEıT 2 | <strong>2019</strong>
FOTOS: UMG<br />
Lebensqualität durch Fortschritt Bei einem Arbeitsunfall vor über 15 Jahren verlor der Patient seinen rechten Arm – heute lebt er dank<br />
modernster Technik und intensiver Betreuung durch die UMG endlich wieder schmerzfrei und kann eine Prothese nutzen.<br />
WUSSTEN SIE SCHON, DASS …<br />
... Instagram Sie unters Messer<br />
bringen kann?<br />
Rückmeldungen der Betroffenen in die<br />
weitere Therapie eingebunden werden.<br />
„Diese gegenseitige Befruchtung der Fachgebiete<br />
führt zu unglaublichen Fortschritten<br />
in der Therapie, von der auch künftige<br />
Patienten profitieren“, sagt Felmerer,<br />
der zudem eine immer vielfältigere Wahrnehmung<br />
seines Fachgebiets in den Medien<br />
und sogar bei den Kollegen – zum<br />
Beispiel in der Unfallchirurgie – feststellt.<br />
EIN ASPEKT, DER AUCH CLAUDIA<br />
CHOI-JACOBSHAGEN vom EKW sehr am<br />
Herzen liegt: „Es geht bei uns nicht nur<br />
um Schönheit, sondern oft um Lebensqualität.“<br />
Natürlich gebe es auch „reine<br />
Schönheitsbehandlungen“, aber die Eingriffe<br />
mit medizinischer Indikation, die<br />
häufig von der Krankenkasse übernommen<br />
würden, bildeten die Mehrzahl. Das<br />
breite Spektrum reicht von der Oberlidstraffung<br />
und Brustvergrößerung über<br />
Tumorentfernungen mit den entsprechenden<br />
Rekonstruktionen bis hin zur Fettabsaugung<br />
oder der Versorgung chronischer<br />
Wunden. Aufgrund der sich rasant<br />
entwickelnden Behandlungsmethoden und<br />
Hilfsmittel sieht Choi-Jacobshagen die<br />
Plastische Chirurgie als „innovatives<br />
Fachgebiet mit individuellen Lösungen“.<br />
Sie setzt am EKW auf vier Säulen der<br />
Plastischen Chirurgie zum Wohle der Patienten:<br />
Die Rekonstruktive, die Ästhetische,<br />
die Hand- und die Verbrennungschirurgie.<br />
Jede Säule stünde zwar für sich,<br />
doch alle griffen auch sehr eng ineinander.<br />
Sie erklärt dies am Beispiel einer schweren<br />
Verbrennung an der Hand, die ästhetisch<br />
und funktionell rekonstruiert werden<br />
müsse. Die Plastische Chirurgie habe sich<br />
in den letzten Jahrzehnten enorm weiterentwickelt.<br />
Verschiedene Transplantationstechniken,<br />
hierunter auch die Mikrochirurgie<br />
seien eine wichtige Methode,<br />
funktionsfähigen Haut- und Gewebeersatz<br />
von einem Körperbereich zum anderen zu<br />
verpflanzen. „Es ist auch beeindruckend,<br />
wie erfolgreich wir inzwischen angezüch-<br />
2,3 Prozent der befragten<br />
Patientinnen, die sich einer<br />
ästhetisch-plastischen Behandlung<br />
unterzogen hatten, gaben an,<br />
sie seien durch soziale Medien<br />
zu einer Schönheitsoperation<br />
motiviert worden. Jede Zehnte<br />
(10,8 Prozent) konsultierte bei der<br />
Suche nach Informationen zur<br />
Plastischen Chirurgie Instagram,<br />
Facebook oder andere soziale<br />
Plattformen. Das zeigen aktuelle<br />
Daten der Deutschen Gesellschaft<br />
für Ästhetisch-Plastische Chirurgie<br />
(DGÄPC). „Ein bisher nur subjektiv<br />
gefühlter Trend, wie der Selfie-<br />
Boom, lässt sich nun erstmalig durch<br />
valide Zahlen unserer jährlichen<br />
DGÄPC-Umfrage untermauern“,<br />
sagt Präsident Harald Kaisers. Da es<br />
sich bei den Betroffenen vor allem<br />
um junge Patientinnen handelt,<br />
sei eine eingehende Beratung vor<br />
dem Eingriff besonders wichtig.<br />
GESUNDHEıT 2 | <strong>2019</strong> 31
FOTOS: EKW<br />
Präsision gefragt EKW-Chefärztin Claudia Choi-Jacobshagen bei einer mikrochirurgischen Operation am OP-Mikroskop<br />
tetes Gewebe als Haut ersatz oder Zellspray<br />
zur Beseitigung von Pigmentstörungen<br />
einsetzen“, so Choi- Jacobshagen. Diese<br />
und andere futuristisch anmutende Methoden,<br />
wie der Einsatz von Siebplatten in<br />
Verbindung mit einem Vakuum, ermöglichen<br />
in Weende das schmerzfreie Ansaugen<br />
von Hautzellen. Diese wiederum sind<br />
dann die Grundlage für Transplantationen<br />
oder das oben genannte Zellspray. Auch<br />
der große Nutzen von Fetttransplantationen<br />
in der Wundheilung, Arthrosetherapie<br />
und Geweberekonstruktion wird erfolgreich<br />
angewendet.<br />
MODERNE METHODEN, die nur sogenannte<br />
minimalinvasive (= möglichst geringfügige)<br />
Eingriffe erfordern, dienen einer<br />
narben- und schmerzarmen Behandlung.<br />
„Unser sehr junges Fachgebiet entwickelt<br />
sich stetig weiter. Daher bin ich<br />
selbst gespannt, wohin die Reise geht“,<br />
sagt Choi-Jacobshagen und blickt voller<br />
Neugier in die Zukunft ihrer Disziplin. ƒ<br />
WUSSTEN SIE SCHON, DASS …<br />
... ROBOTER MITTLERWEILE AUCH OPERIEREN?<br />
Werden Lymphknoten entfernt, zum Beispiel wegen einer Brustkrebserkrankung,<br />
wird Gewebswasser nicht mehr richtig entsorgt: Ein Lymphödem kann<br />
entstehen, und der betroffene Körperteil schwillt an. Dank modernster<br />
Forschungsergebnisse können den Betroffenen Lymphknoten aus dem<br />
Bauchraum entnommen werden, um sie an die sogenannte Empfängerstelle<br />
zu transplantieren. Das Fettgewebe wird mittransplantiert, weil es neue<br />
Lymphgefäße ausbilden kann. Die Operationstechnik wurde in den 1980er-<br />
Jahren von einer belgischen Ärztin entwickelt, kommt aber bisher nur in<br />
wenigen Kliniken – unter anderem an der UMG – zum Einsatz. Möglich ist<br />
der Eingriff mithilfe mikrochirurgischer Techniken per OP-Roboter unter<br />
dem Mikroskop: Die Operation erfordert feinste Werkzeuge und eine ruhige<br />
Hand. Allgemeinchirurgen können die Vorarbeit leisten, doch die feinen<br />
Blutgefäße können nur sehr erfahrene plastische Chirurgen annähen.<br />
Nach der Transplantation stehen die Chancen der Betroffenen gut, ein<br />
Leben ohne oder mit relativ wenig Lymphdrainagen führen zu können.<br />
32<br />
GESUNDHEıT 2 | <strong>2019</strong>
www.DomesticCare.<br />
www.DomesticCare.de<br />
Domestic Care<br />
Haushaltsservice<br />
Wir stehen für<br />
qualitativ hochwertige<br />
Dienstleistungen im Bereich<br />
Hauswirtschaft.<br />
• Familien und Singles<br />
verhelfen wir zu mehr<br />
Freiraum<br />
• Betreuung<br />
hören, handeln, helfen<br />
• Dienstleistungsangebote<br />
für familienfreundliche<br />
Unternehmen<br />
Inhaberin:<br />
Dagmar Crzan<br />
Hauswirtschaftsmeisterin<br />
Domestic Care<br />
Haushaltsservice<br />
Lindenstr. 12, 37181 Hardegsen<br />
Telefon 05503 804870<br />
Mobil 0160 3515012<br />
Neu in Göttingen<br />
Besuchen Sie unseren Store<br />
Modische<br />
Berufsbekleidung<br />
DINO® GmbH<br />
Industriestraße 7<br />
37079 Göttingen<br />
Store<br />
E-Mail<br />
Web<br />
+49[0]551 30 712-55<br />
info@gewerbedino.de<br />
www.gewerbedino.de<br />
Zahlung auf Große Stick<br />
Rechnung Auswahl & Druck<br />
Arbeitsschuhe<br />
Workwear<br />
Werbeartikel<br />
Werbetechnik
Für ein stimmiges Bild<br />
Die Zahlen sprechen für sich: In einem weltweiten Ranking der meisten Schönheits-OPs<br />
pro Jahr hält sich Deutschland mit inzwischen über 77.500 durchgeführten Behandlungen seit<br />
Jahren unter den Top Ten – Tendenz steigend. Warum dies so ist und wo die wirklichen<br />
Vor- und Nachteile liegen, erklärt Facharzt und Schönheits-Experte Hafiez Said im Interview.<br />
INTERVIEW CAROLIN SCHÄUFELE<br />
FOTOGRAFIE ALCIRO THEODORO DA SILVA<br />
Brust, Bauch, Gesicht oder Beine, nichts<br />
wird ausgelassen. Hafiez Said, Facharzt<br />
für Plastische, Ästhetische und Rekonstruktive<br />
Chirurgie, ist leitender Arzt im<br />
Agaplesion Krankenhaus Neu Bethlehem<br />
und unter anderem für die klassischen<br />
Schönheitsoperationen zuständig.<br />
Schon mit Abschluss seines Medizinstudiums<br />
hatte er den klaren Wunsch, in<br />
die Ästhetische Chirurgie zu gehen. Seit<br />
2014 ist der gebürtige Syrer nun am<br />
Krankenhaus in Göttingen tätig. Im<br />
Interview verrät er, was für ihn wahre<br />
Schönheit ausmacht und was er vor diesem<br />
Hintergrund seinen Patienten rät.<br />
Wie wichtig ist Ihnen Schönheit?<br />
Ich liebe Perfektion! Denn in der Perfektion<br />
liegt für mich Schönheit. Auch im<br />
privaten Bereich. Ich schätze es, wenn alles<br />
wohl organisiert und sortiert ist. Das<br />
macht meiner Meinung nach auch einen<br />
guten Schönheitschirurgen aus. Es reicht<br />
nicht, nur Ahnung von Plastischer und<br />
Ästhetischer Chirurgie zu haben, man<br />
muss ein Talent dafür besitzen, die Dinge<br />
zu vervollständigen und künstlerisch zu<br />
betrachten.<br />
Was verbirgt sich denn eigentlich hinter<br />
dem Begriff Schönheitsoperation?<br />
Der Begriff Schönheitschirurgie ist weit<br />
verbreitet, er ist im Grunde ein Sammelbegriff<br />
für plastische und ästhetische Eingriffe.<br />
Die Plastische Chirurgie befasst<br />
sich mit dem äußeren Erscheinungsbild<br />
des Menschen und stellt sowohl fehlende<br />
normale Formen als auch verloren gegan<br />
34<br />
GESUNDHEıT 2 | <strong>2019</strong>
GESUNDHEıT 2 | <strong>2019</strong> 35
Gewissenhaft Schönheitschirurg Hafiez Said legt stets selbst Hand an und großen Wert auf die Zufriedenheit jedes einzelnen Patienten.<br />
KONTAKT<br />
Praxis Dr. Hafiez Said<br />
Waldweg 1<br />
37073 Göttingen<br />
Tel. 0551 494280<br />
plastische-chirurgie@neubethlehem.de<br />
gene Funktionen wieder her. Wir sprechen<br />
von einem rein plastischen Eingriff,<br />
wenn es eine medizinische Indikation gibt,<br />
wie zum Beispiel die Wiederherstellung<br />
der weiblichen Brust nach einer Brustkrebsoperation<br />
oder bei einer Fehlbildung die<br />
Korrektur der abstehenden Ohren oder<br />
auch die Korrektur einer Brust asymmetrie.<br />
Wohingegen die Ästhetische Chirurgie<br />
keine medizinische Notwendigkeit hat.<br />
Dieser rein ästhetische Eingriff wird nur<br />
aufgrund des Wunsches des Patienten<br />
vorgenommen. Ästhetische Eingriffe sind<br />
beispielsweise Fettabsaugungen, Brustund<br />
Lidstraffungen oder Facelifting.<br />
Was sind die Pros und Kontras solcher<br />
Eingriffe?<br />
Ganz einfach gesagt: Attraktive und gu t<br />
aussehende Menschen haben es im Leben<br />
leichter, die Attraktivität beziehungsweise<br />
das gute Aussehen verleiht ihnen Selbstbewusstsein<br />
und spielt für den beruflichen<br />
wie privaten Erfolg eine wichtige<br />
Rolle. Und das ist für mich das Ziel eines<br />
ästhe tischen Eingriffs: Akzeptanz, Selbstbewusstsein<br />
und eine Verbesserung der<br />
Lebensqualität.<br />
Viele Menschen leiden unter ihrem<br />
Aussehen, sie trauen sich nicht, ins<br />
Schwimmbad oder in die Sauna zu gehen,<br />
und stehen unter psychischem<br />
Druck von außen. Manche haben sogar<br />
Hemmungen, sich zu Hause bei ihrem<br />
Partner frei zu geben – und das wirkt<br />
sich extrem negativ auf ihre Lebensqualität<br />
aus. Durch eine Schönheitsoperation<br />
verbessert sich ihr körperliches<br />
Bewusstsein, ihr Selbstwertgefühl steigt,<br />
und dies unterstützt nicht nur die körperliche<br />
<strong>Gesundheit</strong>, sondern auch das seelische<br />
Wohl befinden.<br />
36<br />
GESUNDHEıT 2 | <strong>2019</strong>
» Ich bin ein konservativer Chirurg, der Wert darauf legt,<br />
dass das Erscheinungsbild des Patienten stimmig ist. «<br />
Das klingt gut. Aber gibt es auch<br />
Nachteile?<br />
Natürlich, da wären einmal die Kosten zu<br />
nennen und mögliche Komplikationen,<br />
die natürlich bei jeder Operation auftreten<br />
können. Deshalb ist es ungemein<br />
wichtig, dass jeder Schönheitschirurg seine<br />
Patienten ausführlich berät und mit<br />
ihnen über deren Erwartungen spricht.<br />
Sie haben das Thema Kosten angesprochen:<br />
Was muss man denn für<br />
eine Operation veranschlagen?<br />
Die Kosten einer rein ästhetischen Schönheitsoperation<br />
hängen von Art und Umfang<br />
der geplanten Maßnahmen ab. Wir<br />
rechnen nach Pauschalen ab. Sobald klar<br />
ist, was für ein Eingriff vorgenommen<br />
werden soll, kann ich anhand einer Tabelle<br />
nachschlagen, welche Kosten anfallen.<br />
Bei Fettabsaugungen bewegen sie sich<br />
beispielsweise zwischen 1.500 und 4.000<br />
Euro, eine BrustOP liegt zwischen 4.500<br />
und 6.500 Euro und eine Nasenkorrektur<br />
zwischen 2.000 und 5.000 Euro.<br />
Das Thema SchönheitsOP war lange<br />
eher ein Tabuthema, niemand hat<br />
gern öffentlich darüber gesprochen.<br />
Was hat sich geändert?<br />
Mittlerweile gehen die Menschen viel offener<br />
mit diesem Thema um als noch vor<br />
20 Jahren. Heute kommen die Patienten<br />
mit der ganzen Familie zu mir in die Praxis<br />
oder bringen ihre Freunde und Freundinnen<br />
mit, um sich über die Möglichkeiten<br />
zu informieren. Eine Schönheitsoperation<br />
wird nicht mehr versteckt, wie es noch<br />
vor einigen Jahren der Fall war.<br />
Mit welchen Vorstellungen kommen<br />
Ihre Patientinnen und Patienten zu<br />
ihnen?<br />
Das ist ganz unterschiedlich. Die meisten<br />
Patienten kommen mit realistischen Einschätzungen<br />
ihrer Wünsche zu uns, die<br />
wir gut umsetzen können. Aber nicht selten<br />
kommen Patienten auch mit überzogenen<br />
Vorstellungen. Sie wünschen sich<br />
beispielsweise übertrieben aufgespritzte<br />
Lippen oder auffällig vergrößerte Brüste.<br />
Das lehne ich ab. Ich bin ein konservativer<br />
Chirurg, der Wert darauf legt, dass<br />
das gesamte Erscheinungsbild des Patienten<br />
stimmig ist. In meinem Implantaten<br />
Lager finden Sie zum Beispiel auch keine<br />
Brustsilikonimplantate, die schwerer als<br />
500 Gramm sind. Oder auch keine sogenann<br />
ten ExtraHighProfileSilikonprothe<br />
sen.<br />
Die Patienten, die zu mir kommen, erhalten<br />
eine ausführliche Beratung über<br />
die Möglichkeiten, die ich ihnen anbiete.<br />
Wenn ihre Vorstellung sich mit meiner<br />
deckt, dann operiere ich. Falls wir keinen<br />
gemeinsamen Nenner finden und ich<br />
die Vorstellung der Patienten fachlich<br />
nicht vertreten kann, dann teile ich ihnen<br />
mit, dass ich nicht der richtige Arzt<br />
für sie bin.<br />
Wenn Sie Patienten, wie eben beschrie <br />
ben, auch wieder wegschicken, ist<br />
das Verhältnis von Arzt und Patient<br />
anscheinend für Sie sehr wichtig.<br />
Ja, das ist mir wirklich sehr wichtig. Für<br />
mich muss das Verhältnis zwischen Arzt<br />
und Patient stimmen. Tut es das nicht, ist<br />
das auch keine gute Voraussetzung für ein<br />
optimales Ergebnis nach der Operation.<br />
Ich gehe so weit, dass ich meine Patienten<br />
mögen und ich ihnen – so, wie sie mir –<br />
vertrauen können muss.<br />
Und was, wenn ein Eingriff nicht nach<br />
Vorstellung eines Patienten verläuft?<br />
Ich lege großen Wert darauf, dass meine<br />
Patienten zufrieden sind. Unzufriedenheit<br />
ist bei uns Ausnahme. Ist aber ein<br />
Patient allgemein nach einer Schönheitsoperation<br />
nicht zufrieden, dann<br />
muss sich der Arzt Zeit nehmen und genau<br />
zuhören, was den Patienten stört.<br />
Wenn der Arzt der Meinung ist, dass der<br />
Betroffene mit seiner Kritik fachlich<br />
richtig liegt, muss er das akzeptieren<br />
und eventuell eine Korrektur durchführen.<br />
Ist der Arzt aber der Meinung, dass<br />
die Kritik überzogen ist, muss er auch<br />
hier Zeit investieren und versuchen, mit<br />
dem Patienten zu reden und ihn mit<br />
Geduld und Diplomatie davon zu überzeugen,<br />
dass eine Korrektur nicht sinnvoll<br />
ist.<br />
Wenn man sich für eine Schönheitsoperation<br />
entschieden hat, wie finde<br />
ich einen guten Arzt?<br />
Informieren Sie sich, bei Freunden, Bekannten<br />
und im Internet. Suchen Sie nach<br />
guten Spezialisten in hoch spezialisierten<br />
Kliniken. Als Erstes sollte der Arzt eine<br />
professionelle fachliche Beratung anbieten,<br />
bei der er realistisch die bestehenden<br />
Möglichkeiten benennt und Vorher/<br />
NachherErgebnisse zeigt.<br />
Vielen Dank für das Gespräch!<br />
GESUNDHEıT 2 | <strong>2019</strong> 37
ANZEIGE<br />
Weniger Pfunde,<br />
mehr Lebensqualität<br />
Fettleibige Menschen begegnen in unserer Gesellschaft häufig Vorurteilen.<br />
Die Ernährungs- und Stoffwechselkrankheit Adipositas ist aber potenziell tödlich.<br />
Einzige Heilungschance ist eine Operation.<br />
Im Evangelischen Krankenhaus Göttingen-Weende verhilft die Adipositaschirurgie übergewich tigen<br />
Patienten durch einen minimalinvasiven Eingriff zu mehr <strong>Gesundheit</strong>. Und die Abteilung für<br />
Plastische, Ästhetische und Rekonstruktive Chirurgie entfernt erschlaffte Haut.<br />
Dr. Bernhard Schupfner,<br />
Leiter der Adipositas-Chirurgie am<br />
Ev. Krankenhaus Göttingen-Weende<br />
Andreas K. nahm nach der OP innerhalb<br />
von zwei Jahren 69 Kilo ab.<br />
Zwei Stunden dauerte die Operation,<br />
die aus ihm einen anderen Menschen<br />
gemacht hat. Dr. Bernhard Schupfner, Leiter<br />
der AdipositasChirurgie im EKW, legte<br />
dem hochgradig fettleibigen 47Jährigen<br />
bei dem minimalinvasiven Eingriff einen<br />
sogenannten Magenbypass an.<br />
„Gleich in den ersten zwei Wochen nach<br />
dem Eingriff verlor ich 20 Kilogramm“, sagt<br />
Andreas K. Danach verlief die Gewichtsabnahme<br />
etwas langsamer. Heute – nach<br />
zwei Jahren – wiegt er 81 Kilogramm, 69<br />
weniger als vor der Behandlung.<br />
Weniger körperliche Beschwerden<br />
Für den 1,80 Meter großen Südniedersachsen<br />
war die OP ein großer Erfolg. Die<br />
körperlichen Beschwerden, die ihn vorher<br />
geplagt hatten, sind weitgehend verschwunden.<br />
„Früher machte ich selbst im<br />
schönsten Anzug keine gute Figur mehr“,<br />
erzählt er. Um Sticheleien und abschätzigen<br />
Blicken zu entgehen, hielt er sich meist<br />
im Hintergrund. „Mein Leben wurde mit<br />
zunehmendem Körpergewicht immer beschwerlicher“,<br />
erinnert sich der Mann. Er<br />
hatte nachts Atemaussetzer, musste eine<br />
Atemmaske tragen. Auch bei körperlicher<br />
Anstrengung geriet der gelernte Tischler<br />
schnell außer Atem. „Kein Wunder“, meint<br />
Andreas K., „ich trug ja einen 69 Kilogramm<br />
schweren Rucksack mit mir herum.“<br />
Das Körpergewicht beanspruchte auch<br />
die Gelenke stark. Der Blutdruck stieg, das<br />
Risiko eines Herzinfarkts und Schlag anfalls<br />
nahm zu. Diabetes drohte. „Wenn Sie jetzt<br />
nichts ändern, sind Sie bald tot, sagte mein<br />
Hausarzt“, so K. Durch die extreme Gewichtszunahme<br />
gab er seine Hobbys auf<br />
und blieb fast nur noch zu Hause. Depressive<br />
Verstimmungen wurden zum Begleiter.<br />
„Das Einzige, was mir noch blieb, war das<br />
Essen“, erzählt er. Ein Teufelskreis.<br />
Ein halbes Jahr bereitete sich der 47Jährige<br />
auf den Eingriff vor. Zweimal in der Woche<br />
trieb er jeweils für eine Stunde Reha sport,<br />
machte Sitzballgymnastik, Dehn und Balanceübungen.<br />
Monatlich ging er zur Ernährungsberatung.<br />
Während der Vorbereitungszeit<br />
verlor er die ersten acht Kilo.<br />
„Kurz nachdem ich aus der Vollnarkose<br />
erwacht war, machte ich schon die ersten<br />
Schritte ums Bett herum“, erinnert sich<br />
Andreas K. Schmerzen hatte er kaum.<br />
Nachbetreuung ist sehr wichtig<br />
Bereits nach fünf Tagen wurde er aus dem<br />
Weender Krankenhaus entlassen. „Ganz<br />
wichtig ist die Nachbetreuung“, betont<br />
Dr. Schupfner. In den ersten beiden Jah
PROFIL<br />
ANZEIGE<br />
FOTO: EKW<br />
Dr. Bernhard Schupfner erklärt einem Patienten die Schritte einer Adipositas-Operation.<br />
ren sieht er seine Patienten alle drei bis<br />
sechs Monate zur Nachsorge. Auch sein<br />
Essverhalten hat sich geändert. „Nach der<br />
Operation ist man schon nach wenigen<br />
Bissen satt“, erklärt er. Damit es nicht zu<br />
Mangelerscheinungen kommt, nimmt er<br />
zusätzlich zu eiweißreicher Kost wie Fisch,<br />
Fleisch oder fettarmem Käse, Kautabletten<br />
mit Vitaminen sowie Mikronährstoffe und<br />
Eiweißpulver zu sich. Dazu gibt es viel Gemüse.<br />
Auf Kohlenhydrate verzichtet er weitgehend.<br />
Um in Form zu bleiben, geht er weiterhin<br />
zum Rehasport. Er ist froh, dass die starke<br />
Gewichtsabnahme bei ihm nicht zu unangenehmen<br />
Folgen geführt hat. „Es kann nach<br />
der Operation passieren, dass die erschlaffte<br />
Haut bzw. das Weichteil gewebe am<br />
Körper wie eine Schürze herunterhängt“,<br />
erklärt Dr. Lea Zachau, Fachärztin für Plastische<br />
und Ästhetische Chirurgie im Evangelischen<br />
Krankenhaus Göttingen Weende.<br />
„Die erschlaffte Haut lässt sich operativ sehr<br />
gut von uns entfernen.“ Die Krankenkassen<br />
übernehmen häufig auf Antrag die Kosten.<br />
„Bei mir war ein solcher Eingriff zum Glück<br />
nicht erforderlich“, sagt Andreas K., der für<br />
sein neues aktives Leben dankbar ist.<br />
Voraussetzungen für eine Magenbypass-OP<br />
Die Operation kann nur bei Patienten<br />
durchgeführt werden, bei denen die<br />
Adipositas nicht durch eine noch unbehandelte<br />
psychische Erkrankung – etwa<br />
eine Depres sion oder eine Essstörung –<br />
bedingt ist. Ein Psychiater klärt das ab.<br />
Krankenkassen übernehmen den Eingriff<br />
ab einem BodyMassIndex (BMI) von 30<br />
(kg/m 2 ), wenn es eine Begleiterkrankung,<br />
etwa einen insulinpflichtigen Diabetes,<br />
gibt. Im EKW sind die meisten der bisher<br />
in dieser hier noch jungen Disziplin operierten<br />
Patienten jünger als 60 Jahre, etwa<br />
die Hälfte sogar jünger als 30 Jahre gewesen.<br />
Der durchschnittliche BMI lag um die<br />
50 (kg/m 2 ).<br />
KONTAKT<br />
Ev. Krankenhaus Göttingen-Weende<br />
Allgemein, Viszeral, Thorax und<br />
Minimalinvasive Chirurgie,<br />
Sektion für Adipositas und Metabolische<br />
Chirurgie<br />
Dr. Bernhard Schupfner<br />
An der Lutter 24<br />
37075 Göttingen<br />
Tel. 0551 5034 1101<br />
ach-amb@ekweende.de<br />
www.ekweende.de
Macht Frauen Mut<br />
Die Amputation der Brust nach einer Brustkrebserkrankung ist physisch und psychisch<br />
belastend. Viele Frauen fühlen sich in ihrer weiblichen Identität verletzt. Ein Wiederaufbau der<br />
Brust kann helfen. Doch die meisten wissen gar nicht, was alles möglich ist – eine Tatsache,<br />
die Claudia Choi-Jacobshagen, Chefärztin der Abteilung für Plastische, Ästhetische und<br />
Rekonstruktive Chirurgie am Evangelischen Krankenhaus Weende, ändern möchte.<br />
TEXT CAROLIN SCHÄUFELE<br />
FOTOS ALCIRO THEODORO DA SILVA<br />
40<br />
GESUNDHEıT 2 | <strong>2019</strong>
GESUNDHEıT 2 | <strong>2019</strong> 41
» Es ist mir persönlich ein sehr wichtiges Anliegen:<br />
Die Frauen sollten mehr Mut haben, sich zu informieren,<br />
und mehr nachfragen, was möglich ist. «<br />
Dr. med. Claudia Y. Choi-Jacobshagen<br />
Chefärztin<br />
Klinik für Plastische, Ästhetische<br />
und Rekonstruktive Chirurgie /<br />
Operatives Brustzentrum<br />
Evangelisches Krankenhaus<br />
Göttingen-Weende<br />
An der Lutter 24<br />
37075 Göttingen<br />
Tel. 0551 50341302<br />
www.ekweende.de<br />
Viele Frauen wissen gar nicht,<br />
dass die Rekonstruktion der<br />
Brust nach einer Krebsoperation<br />
mit zum Behandlungsplan<br />
gehört“, erklärt Claudia<br />
ChoiJacobs hagen und sieht darin einen<br />
persönlichen Auftrag, der über ihre Arbeit<br />
hinausgeht. Die Chefärztin leitet seit sechs<br />
Jahren die Abteilung für Plastische, Ästhetische<br />
und Rekonstruktive Chirurgie am<br />
Evangelischen Krankenhaus Weende (EKW),<br />
die einen Arbeitsschwerpunkt in der Rekonstruktion<br />
nach einer Tumoroperation<br />
bei Brustkrebs hat. Viele Frauen würden<br />
sich nach einer Amputation einer oder<br />
beider Brüste eine Wiederherstellung<br />
zwar wünschen, „die meisten wissen jedoch<br />
gar nicht, was alles möglich ist“, so<br />
die Expertin. „Es gibt einfach noch zu<br />
wenig Aufklärungsarbeit.“ Dabei werden<br />
die Kosten dafür sogar von den Krankenkassen<br />
übernommen.<br />
KONTAKT<br />
SILIKON UND EIGENGEWEBE: Das sind<br />
die beiden Materialien, mit denen eine<br />
neue Brust aufgebaut wird. „Silikonkissen<br />
dürften den meisten bekannt sein.<br />
Das Fremdmaterial verursacht im späteren<br />
Verlauf allerdings häufig Probleme“,<br />
erläutert ChoiJacobs hagen. „Wesentlich<br />
schöner für eine Brustrekonstruktion ist<br />
natürlich Eigengewebe.“ Die Ergebnisse<br />
nach der OP sind meist ästhetisch besser<br />
und die wiederhergestellte Brust fühlt sich<br />
genauso weich und natürlich an wie eine<br />
echte. Die Chefärztin betont vor allem die<br />
Vorteile dieser Variante bei einer einseiti<br />
gen Amputation, denn mit der Verwendung<br />
von Eigengewebe sei es wesentlich<br />
einfacher, ein symmetrisches Ergebnis zu<br />
erzielen.<br />
FÜR DEN WIEDERAUFBAU mit Eigengewebe<br />
gibt es prinzipiell zwei Methoden:<br />
Für die erste werden Fettzellen abgesaugt,<br />
aufbereitet und in den Brustbereich<br />
gespritzt. Bei Tumorpatientinnen sei man<br />
mit dieser in anderen Bereichen gut etablierten<br />
Methode allerdings noch zurückhaltend,<br />
so ChoiJacobs hagen, da es noch<br />
nicht ausreichend Langzeitstudien bei<br />
diesem Patientenkollektiv gebe.<br />
Die zweite Methode sieht vor, Fettgewebe<br />
– also keine Fettzellen, sondern<br />
das komplette Gewebe – an Bauch oder<br />
Ober schenkel zu entnehmen und zu verpflanzen.<br />
Dazu werden die das Gewebe<br />
ver sorgenden Venen und Arterien mit freigelegt,<br />
die dann durch mikrochirurgische<br />
Gefäßnähte mit den entsprechenden Blutgefäßen<br />
im Brustbereich verbunden werden.<br />
Die Brust wird dann geformt, und da<br />
das Gewebe durchblutet ist, ergibt sich ein<br />
sehr natürliches Ergebnis. „Das Ganze hat<br />
zudem auch den positiven Effekt, dass man<br />
überschüssiges Fettgewebe an unlieb samen<br />
Stellen loswird“, sagt ChoiJacobs hagen.<br />
Das Verfahren der Eigengewebsverpflanzung<br />
sei internationaler Goldstandard<br />
in der Eigengewebsrekonstruktion.<br />
Was bleibt, sei eine versteckte Narbe in<br />
der Bikinizone oder am Bein.<br />
„Wir arbeiten mit minimalinvasiven<br />
und mikrochirurgischen Techniken, die<br />
42<br />
GESUNDHEıT 2 | <strong>2019</strong>
Im Einsatz Chefärztin Claudia Choi-Jacobs hagen liegt es persönlich am Herzen, ihren Patientinnen ein gutes Körpergefühl zu geben.<br />
gerade im Bereich der Transplantation ihren<br />
Einsatz finden“, erläutert die Ärztin.<br />
Die Transplantation von Eigengewebe sei<br />
ein hochkomplexer Eingriff, im EKW jedoch<br />
eine StandardOP, die einmal pro<br />
Woche durchgeführt werde. Das mache<br />
auch die Expertise ihrer Arbeit aus. „Natürlich<br />
gibt es wie bei jedem operativen<br />
Eingriff Risiken. Es könnte beispielsweise<br />
zu einer Thrombose kommen. Deshalb<br />
gibt es bei uns eine engmaschige Kontrolle.“<br />
Einmal pro Stunde werde in der kritischen<br />
Phase nach den Patientinnen geschaut<br />
und das Operationsergebnis überprüft,<br />
sodass man bei eventuellen Komplikationen<br />
sofort reagieren könnte.<br />
NICHT ALLE FRAUEN entscheiden sich<br />
nach einer Brustkrebsoperation für einen<br />
Wiederaufbau der abgenommenen Brust,<br />
erklärt ChoiJacobshagen, da gebe es verschiedenste<br />
Gründe, einen solchen Eingriff<br />
nicht vornehmen zu lassen. „Wichtig<br />
ist mir, dass die Menschen gut informiert<br />
sind. Ich kläre alle meine Patientinnen<br />
über die verschiedenen Möglichkeiten auf<br />
und bespreche dann ganz individuell mit<br />
ihnen, was meiner Meinung nach am<br />
sinnvollsten erscheint. Dann entscheiden<br />
die Frauen, was sie machen möchten.“<br />
MIT ALLEN INFORMATIONEN ÜBER die<br />
Möglichkeiten der Rekonstruktion einer<br />
Brust würden sich doch viele Frauen für<br />
einen Wiederaufbau entscheiden: „Sie<br />
fühlen sich nicht vollständig, denn die<br />
Brust ist für Frauen ein wichtiges Körperteil.“<br />
Durch das Fehlen einer oder<br />
beider Brüste würde die Integrität, das<br />
Wohlbefinden im eigenen Körper, häufig<br />
gestört. Viele der Frauen könnten auch<br />
durch den Wiederaufbau ihrer Brust mit<br />
dem Thema der Erkrankung besser abschließen.<br />
„Sie werden nicht jeden Morgen<br />
vor dem Spiegel durch das gestörte<br />
Körperbild an die Brustkrebserkrankung<br />
erinnert.“ Die meisten Frauen wählen<br />
die Eigengewebsrekonstruktion, manche<br />
würden sich für eine Interimslösung mit<br />
Prothesen entscheiden, die dann nach<br />
einiger Zeit durch Eigengewebe ausgetauscht<br />
werden würden.<br />
ChoiJacobshagen geht bei der Rekonstruktion<br />
der Brust ganz konkret auf die<br />
Wünsche der Frauen ein. Es gebe Frauen,<br />
die sich eher eine größere oder eine kleinere<br />
Brust wünschen. Bei einer einseitigen<br />
Erkrankung werde dann auch die Anpassung<br />
der zweiten Brust an die ,neue‘ Brust<br />
durchgeführt. „Es ist mir persönlich ein<br />
sehr wichtiges Anliegen: Die Frauen sollten<br />
mehr Mut haben, sich zu informieren,<br />
und mehr nachfragen, was möglich ist.“ ƒ<br />
GESUNDHEıT 2 | <strong>2019</strong>43
Wer hätte das gedacht...?<br />
Mit über 77.500 durchgeführten<br />
Behandlungen und Operationen – Tendenz steigend –<br />
hält sich Deutschland seit Jahren unter den<br />
Top Ten des weltweiten Rankings der<br />
meisten Schönheits-OPs.<br />
Wenn, dann richtig !<br />
Männer bevorzugen operative<br />
Eingriffe – <strong>2019</strong> ganz oben auf der<br />
Liste: Fettabsaugung.<br />
Frauen entscheiden sich<br />
sechsmal so häufig für<br />
einen ästhetischen<br />
Eingriff als Männer.<br />
Neben der Fettabsaugung am<br />
Knöchel, den Wadenimplantaten<br />
und Zehenverkürzungen sind vor<br />
allem die Nabelkorrektur und die<br />
Grübchenerstellung weitere weniger<br />
bekannte Schönheitsoperationen.<br />
Immer mehr Frauen kommen mit<br />
bildbearbeiteten Selfies in die Praxis – als<br />
Vorbild für ihre geplante Schönheits-OP.<br />
FOTO: STOCK.ADOBE.COM<br />
44<br />
GESUNDHEıT 2 | <strong>2019</strong>
Durchschnittsalter von Patienten in der<br />
Ästhetisch-Plastischen Chirurgie: 43,1 Jahre<br />
Nicht etwa in den USA legen sich<br />
die meisten im Pro-Kopf-Vergleich<br />
für die Schönheit unters Messer, die<br />
Schweiz ist mit 215,6 Operationen<br />
Jeder Arzt kann sich heute<br />
Schönheitschirurg nennen.<br />
Der Begriff ist nicht geschützt,<br />
ebenso wenig wie Journalist,<br />
Reiseleiter oder Volkswirt.<br />
pro 100.000 Personen führend.<br />
Nummer Eins<br />
der am häufigsten nach gefragten<br />
Behandlungen <strong>2019</strong> bei Frauen:<br />
die nicht invasive<br />
Faltenbehandlung.<br />
Und dies mit weitem Vorsprung vor den<br />
operativen Eingriffen auf Platz 2 und 3:<br />
der Brustvergrößerung und der<br />
Fettabsaugung.<br />
Doppelt so viele<br />
Männer wie Frauen erzählen<br />
niemanden von ihrem Eingriff,<br />
während Frauen häufig mit<br />
Freunden und Familie über die<br />
Schönheitsoperation sprechen.<br />
Laut aktueller Daten der Deutschen Gesellschaft für Ästhetisch-<br />
Plastische Chirurgie gaben 2,3 Prozent aller befragten Patientinnen,<br />
die sich einer ästhetisch-plastischen Behandlung unterzogen hatten, an,<br />
sie seien durch soziale Medien zu einer Schönheitsoperation motiviert<br />
worden. Jede Zehnte konsultierte bei der Suche nach Informationen zur<br />
Plastischen Chirurgie Instagram, Facebook oder andere<br />
soziale Plattformen.<br />
15,9 Prozent aller Patienten sehen sich durch<br />
ihre persönliche Umgebung zu einer ästhetischplastischen<br />
Behandlung motiviert.<br />
QUELLE: DGÄPC-STATISTIK 2018–<strong>2019</strong><br />
GESUNDHEıT 2 | <strong>2019</strong> 45
ANZEIGE<br />
Klinikum Werra-Meißner GmbH<br />
Eine hohe Qualität ist der Grundstein unseres täglichen Handelns<br />
Krankenhäuser in ländlichen Bereichen<br />
sehen sich heutzutage großen<br />
Herausforderungen gegenüber. Ein<br />
besonderer Aspekt ist die Anwerbung von<br />
Fachkräften, vor allem von Ärzten. Außerdem<br />
müssen diese Kliniken sehr breit aufgestellt<br />
sein, um auf alle möglichen und<br />
potenziellen Erkrankungen der Bevölkerung<br />
reagieren zu können. Das Klinikum Werra-<br />
Meißner GmbH mit den Standorten Eschwege<br />
und Witzenhausen ist das, wie die<br />
Geschäftsführerin Dr. Claudia Fremder im<br />
Interview erklärt.<br />
Frau Dr. Fremder, mit welchem Ziel tritt<br />
die <strong>Gesundheit</strong>sholding an?<br />
Wir bieten ein umfangreiches und differenziertes<br />
medizinisches Leistungsspektrum<br />
entsprechend den Bedürfnissen der Bevölkerung<br />
im Werra-Meißner-Kreis. Dabei<br />
orientieren wir uns stets an den Leitlinien<br />
und gesetzlichen Richtlinien für Medizin<br />
und Pflege. Unser Anliegen ist es, auch in<br />
Kooperation mit niedergelassenen Ärzten,<br />
eine sektorenübergreifende Versorgung für<br />
alle Patienten anzubieten.<br />
Was zeichnet das Krankenhaus aus?<br />
Das Klinikum Werra-Meißner stellt mit<br />
seinen Krankenhäusern in Witzenhausen<br />
und Eschwege die medizinische Grundund<br />
Regelversorgung in der Region Werra-<br />
Meißner und darüber hinaus sicher. Als<br />
kommunales Krankenhaus mit mehr als<br />
500 Betten beschäftigen wir an beiden<br />
Klinikstandorten über 1.000 Mitarbeitende<br />
und versorgen rund 19.000 stationäre<br />
und 36.000 ambulante Patienten pro Jahr.<br />
Das Klinikum Werra-Meißner ist Akademisches<br />
Lehrkrankenhaus der Georg- August-<br />
Universität Göttingen. Wir sind ein mittelgroßes<br />
Krankenhaus mit einem breiten<br />
Leistungsspektrum und können dabei<br />
eine familiäre und persönliche Versorgung<br />
anbieten.<br />
Ein wichtiges Thema für Patienten ist die<br />
Notfallversorgung: Welches Spektrum<br />
deckt Ihr Krankenhaus ab?<br />
Bezogen auf die gestufte Notfallversorgung<br />
decken wir in Witzenhausen die Basisnotfallversorgung<br />
ab, in Eschwege können wir<br />
ab 2020 die erweiterte Notfallversorgung<br />
anbieten, da wir hierfür alle Voraussetzungen<br />
erfüllen.<br />
Konkret bedeutet das, dass wir in Witzenhausen<br />
internistische und chirurgische<br />
Notfälle behandeln und auch eine Intensivstation<br />
vorhalten. In Eschwege behandeln<br />
wir ebenfalls internistische und chirurgische<br />
Notfälle, aber zusätzlich auch neurologische<br />
und gynäkologische Notfälle. In<br />
Eschwege haben wir 24/7 – also rund um<br />
die Uhr – ein Herz katheterlabor für akute<br />
Herzinfarkte und ab 2020 auch eine Intensivstation<br />
mit zehn Beatmungsbetten.<br />
Gibt es neben dem regulären Krankenhausbetrieb<br />
auch weitere gesundheitliche<br />
Angebote für Patienten?<br />
Wir arbeiten mit Partnern im <strong>Gesundheit</strong>swesen<br />
zusammen, um unseren Patienten<br />
an unseren Standorten eine Vielzahl medizinischer<br />
Leistungen anbieten zu können.<br />
Einige unserer Kooperationspartner sind in<br />
den Behandlungsprozess direkt eingebunden,<br />
wie zum Beispiel die PHV Dialysepartner<br />
oder die freiberuflichen, selbstständig<br />
tätigen Hebammen.
PROFIL<br />
ANZEIGE<br />
FOTO: KLINIKUM WERRA-MEISSNER<br />
Das Klinikum Werra-Meißner an der Elsa-Brandström-Straße in Eschwege<br />
In Witzenhausen betreiben wir eine<br />
stationäre Palliativmedizin in Kooperation<br />
mit niedergelassenen Ärzten. Und<br />
wir bieten über unsere PRN ergo- und<br />
physiotherapeu tische Leistungen für jedermann<br />
an. Außer dem gehört ein medizinisches<br />
Versorgungszentrum dazu.<br />
Sie kooperieren mit der Universitätsmedizin<br />
Göttingen. Warum und wie sieht<br />
diese Kooperation aus?<br />
Als Lehrkrankenhaus in Kooperation mit<br />
der Universitätsmedizin Göttingen bieten<br />
wir das Praktische Jahr für Medizinstudenten<br />
an. Wir beteiligen uns mit Engagement<br />
an der Ausbildung des ärztlichen Nachwuchses<br />
und fördern den Wissens- und<br />
Erfahrungstransfer zwischen Forschung,<br />
Lehre und Patientenorientierung.<br />
Wir sind auch in der medizinischen Leistungserbringung<br />
mit der Universitätsmedizin<br />
Göttingen verknüpft.<br />
Im Herbst 2018 haben Sie ein neues<br />
Zentrum für Herz- und Gefäßmedizin<br />
eröffnet. Wie sind die Erfahrungen?<br />
Patienten, die Gefäßerkrankungen haben,<br />
haben diese meist in mehreren Regionen<br />
ihres Körpers, sodass sie von verschiedenen<br />
medizinischen Fachabteilungen behandelt<br />
werden müssen. Um hier die Wege<br />
für die Behandlung zu verkürzen und die<br />
Abläufe zu vereinfachen (auch für niedergelassene<br />
Ärzte), arbeiten bei uns die erforderlichen<br />
Abteilungen eng zusammen.<br />
Fachkräftemangel ist vor allem im<br />
<strong>Gesundheit</strong>swesen ein Thema. Wie ist die<br />
personelle Situation?<br />
Wir schätzen uns glücklich, dass wir in<br />
der Pflege ausreichend Bewerbungen vorliegen<br />
haben und wir alle Vakanzen besetzen<br />
können. Dennoch freuen wir uns über<br />
zusätz liche Bewerbungen in der Pflege. Wir<br />
würden uns auch freuen, wenn wir weitere<br />
Ärzte anstellen könnten, die sich von der<br />
Arbeitsatmosphäre in unserem Klinikum<br />
und von der Lebensqualität im Werra-Meißner<br />
Kreis überzeugen lassen.<br />
Vielen Dank für das Gespräch!<br />
INTERVIEW: CAROLIN SCHÄUFELE<br />
KONTAKT<br />
Klinikum Werra-Meißner GmbH<br />
Elsa-Brändström-Str. 1<br />
37269 Eschwege<br />
Tel. 05651 82-0<br />
www.klinikum-werra-meissner.de
UMG SPEZIAL<br />
Universitätsmedizin Göttingen<br />
48<br />
SPEZIAL
Eine bewegte Zeit. Bis zum Jahr 2037 soll die Universitätsmedizin<br />
Göttingen eine vollständige Verwandlung erleben: Sämtliche alten<br />
Gebäude verschwinden und werden durch Neubauten ersetzt.<br />
Und die Führungsspitze, die diese enormen Vorhaben vorantreiben<br />
soll, ist seit jüngster Zeit auch noch neu besetzt. Grund genug,<br />
einmal den Status Quo ins rechte Licht zu setzen.<br />
FOTO ALCIRO THEODORO DA SILVA<br />
SPEZIAL 49
UMG Universitätsmedizin Göttingen<br />
„National sehe ich uns<br />
unter den Top 10“<br />
Im August <strong>2019</strong> hat Wolfgang Brück die Nachfolge von Heyo K. Kroemer als Sprecher des<br />
Vorstandes der Universitätsmedizin Göttingen (UMG) angetreten. Im Interview spricht er über<br />
die großen Fußstapfen seines Vorgängers, seine persönlichen Ziele für die zukünftige<br />
Personalpolitik und die wissenschaftliche Profilierung der UMG.<br />
INTERVIEW SVEN GRÜNEWALD FOTOGRAFIE ALCIRO THEODORO DA SILVA<br />
Herr Brück, mal Hand aufs Herz: Wie groß<br />
sind die Fußstapfen, die Heyo K. Kroemer als<br />
Ihr Vorgänger hinterlassen hat?<br />
Er hat die UMG extrem geprägt. Bevor<br />
Herr Kroemer nach Göttingen kam, waren<br />
wir ein wenig von der Landkarte der<br />
deutschen Universitätsmedizin verschwunden,<br />
und es ist sein Verdienst, die UMG<br />
wieder sichtbar gemacht zu haben, und<br />
zwar prominent – durch seine Art der<br />
Kommunikation, etwa als Präsident des<br />
deutschen Medizinischen Fakultätentages,<br />
aber auch durch die Besetzung bestimmter<br />
wissenschaftlicher Felder. Das gerade entstehende<br />
Heart-and-Brain-Gebäude geht<br />
auf seine Initiative zurück, weil er den Bereich<br />
der Organ-Organ-Interaktionen für<br />
zukunftsfähig erachtet hat. Diesen Weg<br />
will ich weitergehen. Im Moment hat<br />
Göttingen drei Forschungsschwerpunkte:<br />
Neurowissenschaft, Herz-Kreislauf-Medizin<br />
und Onkologie. Von den anderen 35<br />
deutschen Unikliniken haben 30 ebensolche<br />
Schwerpunkte. Mein Ziel ist, dass wir<br />
Gemeinsamkeiten in den drei Schwerpunkten<br />
suchen und daraus neue Alleinstellungsmerkmale<br />
für uns entwickeln.<br />
Die Universitätsmedizin hat immer viel Wert<br />
auf ihre Eigenständigkeit gelegt. Nun haben<br />
wir gerade zufällig die Situation, dass sowohl<br />
UMG-Vorstand als auch Uni-Präsidium<br />
neu besetzt werden – wie wollen Sie das<br />
Verhältnis zur Unileitung ausgestalten?<br />
Wir hatten in den letzten Jahren eine sehr<br />
gute Kooperation mit der Universität, die<br />
wir unbedingt fortsetzen müssen. Wir erstellen<br />
derzeit eine Strategie 2025. Wenn<br />
die Universität wieder in beruhigtem Fahrwasser<br />
ist und einen neuen Präsidenten<br />
oder eine neue Präsidentin gewählt hat,<br />
müssen wir uns gemeinsam so hervorragend<br />
aufstellen, dass wir 2026 eine Chance in<br />
einer möglichen neuen Exzellenzinitiative<br />
des Bundes haben. Wir müssen dafür aber<br />
auch sehr eng mit den Max-Planck-Instituten<br />
und dem Deutschen Primatenzentrum<br />
hier am Göttingen Campus<br />
zusammen arbeiten. Gleichzeitig sind wir<br />
auf die Eigenständigkeit der UMG auch<br />
stolz und kommunizieren sie so nach außen.<br />
Dass wir finanziell autonom sind und<br />
selbst berufen können, macht die UMG<br />
für Externe attraktiv.<br />
Können Sie schon etwas zu den Eckpunkten<br />
der Strategie 2025 sagen?<br />
Die strategischen Überlegungen werden<br />
nicht nur die Entwicklung neuer wissenschaftlicher<br />
Schwerpunkte betreffen, sondern<br />
auch die Krankenversorgung, die<br />
Internationalisierung, das Personal und<br />
den Nachwuchs, also insgesamt sehr umfassend<br />
sein. Im Bereich Wissenstransfer<br />
und Ausgründungen haben wir noch<br />
Nachholbedarf, da wollen wir uns deutlich<br />
weiterentwickeln.<br />
Personal ist ein gutes Stichwort. Die<br />
Universitätsmedizin hat im Laufe der Zeit<br />
verschiedene Tätigkeitsbereiche in Tochtergesellschaften<br />
ausgelagert. Dadurch gibt es<br />
50<br />
SPEZIAL
UMG Universitätsmedizin Göttingen<br />
etwa in der UMG Gastronomie das Problem<br />
einer Parallelgesellschaft aus alten und<br />
neuen Tarifverträgen und, so der Vorwurf,<br />
ungleicher Bezahlung für die gleiche Tätigkeit.<br />
Es gibt andere Kliniken, die solche<br />
Teilbereiche nicht ausgegliedert haben.<br />
Wie soll es mit den Tochtergesellschaften<br />
weitergehen?<br />
Auf der einen Seite unterliegt die UMG<br />
einem starken wirtschaftlichen Druck.<br />
Letztes Jahr haben wir Minuszahlen geschrieben<br />
– dieses Jahr wird es wahrscheinlich<br />
besser aussehen, aber wir werden<br />
trotzdem nicht auf eine „schwarze<br />
Null“ kommen. Wir müssen uns daher<br />
wirtschaftlich konsolidieren, um auch gegenüber<br />
der Landesregierung in Hannover<br />
das Vertrauen beizubehalten. Auf der<br />
anderen Seite hat es gerade bei der UMG<br />
Gastronomie durch den neuen Haustarif<br />
eine deutliche Angleichung gegeben, etwas<br />
Ähnliches erwarten wir dieses Jahr<br />
für die Klinikservice GmbH. Langfristig<br />
müssen wir uns grundsätzlich überlegen,<br />
wie wir damit umgehen. Es gibt allgemein<br />
die Tendenz, solche Tochtergesellschaften<br />
wieder einzugliedern. Das passiert derzeit<br />
etwa an der Charité. Ich habe in der Findungskommission<br />
betont, dass es für gleiche<br />
Arbeit auch gleiches Geld geben muss.<br />
In den kommenden Jahren werden wir<br />
dazu Pläne präsentieren.<br />
Wie steht die UMG im Vergleich zu anderen<br />
Unikliniken da?<br />
Es gibt zwei Vorteile, die die UMG hat.<br />
Einer ist unser Personal. Wir haben zum<br />
Beispiel inzwischen sehr viele Leitungspositionen<br />
in Kliniken und Instituten neu<br />
besetzt, und wenn die letzten Neuberufungen<br />
abgeschlossen sind, haben wir<br />
in den nächsten fünf Jahren keine Wechsel.<br />
Zudem gibt es innerhalb der Medizinischen<br />
Fakultät eine gute Kooperation<br />
ohne irgendwelche Grabenkämpfe. Der<br />
zweite Vorteil ist, dass wir ein komplett<br />
neues Klinikum bauen können. Das ist<br />
enorm wichtig für uns und unsere Zu-<br />
Zur Person<br />
Wolfgang Brück hat in Mainz Medizin<br />
studiert und anschließend in Göttingen<br />
seine Facharztweiterbildung zum Neuropathologen<br />
gemacht. Nach einem Aufenthalt<br />
in Wien wurde er als Professor an<br />
die CharitéUniversitätsmedizin nach<br />
Berlin gerufen, wo er von 1997 bis 2002<br />
tätig war. 2002 übernahm er die Leitung<br />
des Instituts für Neuropathologie an der<br />
Univer sitätsmedizin Göttingen (UMG),<br />
an der er den Forschungsschwerpunkt<br />
Multiple Sklerose etablierte.<br />
In seiner Göttinger Zeit war Brück schon<br />
öfter in Leitungsfunktionen der UMG tätig<br />
– sei es in Ämtern an der Fakultät, als<br />
Vertreter des Vorstandes Krankenversorgung,<br />
als kommissarischer Vorstand<br />
Forschung und Lehre oder dann als Vertreter<br />
von Heyo K. Kroemer. Seit August<br />
<strong>2019</strong> ist er der neue Sprecher des Vorstandes<br />
der UMG, Vorstand Forschung<br />
und Lehre und Dekan der Medizinischen<br />
Fakultät.<br />
SPEZIAL 51
UMG Universitätsmedizin Göttingen<br />
» Mit dem <strong>Gesundheit</strong>scampus Göttingen<br />
haben wir zumindest für Südniedersachsen eine<br />
kunftsfähigkeit. Damit sind wir nach wie<br />
vor sehr attraktiv, wie wir in den Berufungen<br />
sehen, und das, obwohl wir in Göttingen<br />
keine Exzellenzuniversität geworden<br />
sind.<br />
National sehe ich uns unter den Top 10<br />
der Universitätsmedizinen, bei den Drittmitteleinwerbungen<br />
sind wir noch weiter<br />
vorne, und mit dem gewonnenen Exzellenzcluster<br />
werden wir national und auch<br />
international als führender Standort in<br />
den Neuro- und Herz-Kreislauf-Wissenschaften<br />
sowie der hochauflösenden Mikroskopie<br />
wahrgenommen. Dies wird durch<br />
den neuen Schwerpunkt der Interaktion<br />
zwischen Herz und Hirn unterstützt.<br />
In Ihren Tätigkeitsbereich im Vorstand fällt<br />
auch die Zuständigkeit für die Lehre. Lassen<br />
Sie uns da über drei Aspekte sprechen.<br />
Zunächst das Thema Digitalisierung. Im<br />
Masterplan Medizinstudium 2020 taucht der<br />
Begriff gar nicht auf, und die Universitätsmedizin<br />
Mainz ist bislang die einzige, die ein<br />
Wahlbereichscurriculum für digitale Medizin<br />
hat. Wie wollen Sie das Thema besetzen?<br />
Digitalisierung vollzieht sich in verschiedenen<br />
Bereichen: In der Krankenversorgung<br />
rollen wir seit diesem Jahr ein<br />
neues Krankenhausinformationssystem<br />
mit einer komplett digitalisierten Patientenakte<br />
aus, das bis Ende 2020 in allen<br />
unseren Kliniken Einzug hält. Dann haben<br />
wir intern ein papierloses Krankenhaus.<br />
Die Digitalisierung des Studiums<br />
steckt leider noch in den Kinderschuhen.<br />
An der Eidgenössischen Technischen<br />
Vorreiterrolle in diese Richtung.<br />
Es wird zukünftig immer wichtiger werden, seinen<br />
eigenen Nachwuchs auszubilden. «<br />
Hochschule in Zürich gibt es jetzt einen<br />
ganz neuen Studiengang „Digitale Medizin“,<br />
der parallel zum normalen Medizinstudium<br />
läuft. Da sind wir im Vergleich<br />
noch sehr konventionell. Wir haben<br />
jetzt eine Medizininformatikerin gewinnen<br />
können, deren Schwerpunkt die<br />
Digitalisierung und auch der Umgang<br />
mit riesigen Datenmengen ist, die in der<br />
Patientenversorgung anfallen. Wir sind<br />
also am Thema dran.<br />
Und wie sieht es mit genderspezifischer<br />
Medizin aus? Hier ist die Charité mit einem<br />
eigenen Institut ein Vorreiter, in der breiten<br />
Masse der Universitätsmedizinen spielt das<br />
Thema aber oft kaum eine Rolle.<br />
Ich sehe auch da noch einen großen<br />
Bedarf in der Sensibilisierung der Studierenden.<br />
Frauen bekommen beispielsweise<br />
fünfmal häufiger Multiple Sklerose als<br />
Männer, und man weiß nicht, wieso. So<br />
etwas kommt im Studium zu kurz, weil<br />
wir ein sehr straffes Curriculum haben,<br />
das sich auf Kerndisziplinen beschränkt.<br />
Das ist ausbaufähig, und zwar sowohl im<br />
Studium als auch in der praktischen<br />
Medizinerausbildung.<br />
Der dritte Aspekt betrifft den <strong>Gesundheit</strong>scampus,<br />
der gemeinsam mit der Hochschule<br />
HAWK aufgebaut wurde. Damals war das<br />
eine bundesweit einzigartige Kooperation<br />
einer Uniklinik mit einer Fachhochschule.<br />
Wie soll der Campus weiterentwickelt werden?<br />
Nach einer gewissen Anlaufzeit stellen<br />
wir fest, dass die Studiengänge heute ausgebucht<br />
sind. An der Nachfrage erkennt<br />
man den erheblichen Bedarf, und ich<br />
glaube, dass die <strong>Gesundheit</strong>swirtschaft in<br />
Niedersachsen das Potenzial hat, neben<br />
den Themen Mobilität, Landwirtschaft<br />
und Tourismus zu einer der Schwerpunktbranchen<br />
zu werden. Mit dem <strong>Gesundheit</strong>scampus<br />
Göttingen haben wir zumindest<br />
für Südniedersachsen eine Vorreiterrolle<br />
in diese Richtung. Es wird zukünftig<br />
immer wichtiger werden, seinen eigenen<br />
Nachwuchs auszubilden. Niedersachsen<br />
und besonders diese Region brauchen<br />
diese Höherqualifizierten im <strong>Gesundheit</strong>sbereich,<br />
weil sie in die Peripherie<br />
hinausgehen und viele Versorgungsleistungen<br />
übernehmen müssen, die früher<br />
von Familien geleistet wurden. Dafür hat<br />
der <strong>Gesundheit</strong>scampus Göttingen eine<br />
ganz zentrale Bedeutung.<br />
Perspektivisch wird als Nächstes der<br />
Heb ammenstudiengang dazukommen,<br />
doch bislang sind das meist nur<br />
Bachelorstu diengänge. Hier müssen wir<br />
weiter akademisieren und auch Masterstudiengänge<br />
sowie Promotionen anbieten<br />
und die Arbeitsumgebung attraktiver<br />
für Professuren machen. Das heißt, dass<br />
Professoren an der HAWK zudem eine<br />
Zugehörigkeit zur UMG haben – und<br />
umgekehrt, also dass beide Einrichtungen<br />
gemeinsam Berufungen durchführen<br />
können. Hier können wir noch viel mehr<br />
gemeinsam tun. Dasselbe gilt für die Kooperation<br />
mit lokalen Unternehmen.<br />
Herr Brück, vielen Dank für das Gespräch!<br />
Übrigens<br />
Mehr zum Menschen Wolfgang Brück<br />
gibt es in der aktuellen <strong>faktor</strong>-<strong>Winter</strong> <br />
aus gabe zu lesen oder online unter:<br />
www.<strong>faktor</strong>-magazin.de/derroutinier<br />
52<br />
SPEZIAL
UMG Universitätsmedizin Göttingen<br />
UMG in Zahlen (Stand:<br />
2018)<br />
7.880 Mitarbeiterinnen und<br />
Mitarbeiter, davon 1.000 Ärztinnen und<br />
Ärzte sowie 2.000 Pflegekräfte<br />
727,9 Mio. €<br />
Betriebserträge<br />
größter Arbeitgeber und größte<br />
Ausbildungsstätte der Region<br />
3.700 Studierende und<br />
Absolvierende in Humanmedizin,<br />
Zahnmedizin, Molekularer Medizin,<br />
Cardiovascular Science<br />
54<br />
SPEZIAL
UMG Universitätsmedizin Göttingen<br />
63,7 Mio. €<br />
verausgabte Drittmittel<br />
118 Professorinnen<br />
und Professoren<br />
650 Schülerinnen, Schüler<br />
und Auszubildende<br />
8 Schulen für Fachberufe<br />
im <strong>Gesundheit</strong>swesen<br />
LEISTUNGSZAHLEN DER UMG<br />
• 1.440 aufgestellte Betten<br />
• rund 30 Kliniken und klinische Abteilungen<br />
• 65.440 stationäre und teilstationäre Patienten<br />
• 223.600 ambulante Fälle<br />
141,6 Mio. €<br />
Zuschuss des Bundeslandes<br />
Niedersachsen für Forschung<br />
und Lehre<br />
SPEZIAL 55
UMG Universitätsmedizin Göttingen<br />
Voll ins Schwarze getroffen<br />
Das Leuchtturmprojekt <strong>Gesundheit</strong>scampus Göttingen – eine Kooperation der<br />
HAWK Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst und der Universitätsmedizin<br />
Göttingen – ist erwachsen geworden. Die starke Nachfrage nach den Studienplätzen zeigt,<br />
dass das Projekt den Fachkräftebedarf im <strong>Gesundheit</strong>sbereich voll getroffen hat.<br />
TEXT SVEN GRÜNEWALD FOTOGRAFIE ALCIRO THEODORO DA SILVA & HAWK/MARIUS MAASEWERD<br />
Als zum <strong>Winter</strong>semester 2016/17<br />
der <strong>Gesundheit</strong>scampus Göttingen<br />
mit den ersten Studiengängen<br />
startete, war das Projekt<br />
bundesweit einmalig: Eine Kooperation<br />
einer Fachhochschule und einer Universitätsmedizin<br />
mit dem Ziel, neue, stärker<br />
akademisierte Studiengänge in <strong>Gesundheit</strong>sberufen<br />
aufzubauen, hatte es<br />
bis dahin nicht gegeben. Der Versuch<br />
wurde ein voller Erfolg – wie sich an der<br />
hohen Auslastung und Nachfrage nach<br />
den Studienplätzen ablesen lässt.<br />
„Wir haben mit der Gründung des<br />
Campus die Studiengänge sehr schnell<br />
aufgebaut, und alle sind ausgelastet“, so<br />
HAWK-Präsident Marc Hudy. „Wir sehen<br />
an den Zahlen, dass wir nicht am<br />
Markt vorbei entwickeln, sondern den<br />
Bedarf treffen.“ Der seit diesem <strong>Winter</strong>semester<br />
<strong>2019</strong>/20 neu angebotene Studien<br />
gang Soziale Arbeit im <strong>Gesundheit</strong>swesen<br />
ist beispielsweise gleich zu 100 Prozent<br />
ausgelastet gewesen. „Das hat man<br />
selten, wenn man neue Angebote schafft.“<br />
IN NUR DREI JAHREN ist die Gesamtstudierendenzahl<br />
auf dem <strong>Gesundheit</strong>scampus<br />
von null auf 300 gestiegen – die<br />
den Campus tragende HAWK-Fakultät<br />
Naturwissenschaften und Technik hat damit<br />
ihre Studierendenzahlen auf rund<br />
900 gesteigert. Es handelt sich dabei um<br />
Netto- Zugewinne an Studierenden. „Die<br />
Auslastung unserer anderen <strong>Gesundheit</strong>sstudiengänge<br />
in Hildesheim und Holzminden<br />
ist weiterhin stabil, eine Konkurrenz<br />
durch die neuen Studiengänge stellen<br />
wir nicht fest“, so Hudy.<br />
Offenbar trifft im <strong>Gesundheit</strong>scampus<br />
die veränderte Nachfrage seitens der <strong>Gesundheit</strong>swirtschaft<br />
auf eine ebenso stark<br />
ausgeprägte Nachfrage junger Menschen.<br />
Eine Gemengelage mit Perspektive,<br />
so sieht es Wolfgang Brück, Vorstandsvorsitzender<br />
der Universitätsmedizin<br />
56<br />
SPEZIAL
UMG Universitätsmedizin Göttingen<br />
Göttingen (UMG). Der <strong>Gesundheit</strong>scampus<br />
habe eine Vorreiterrolle in der Anpassung<br />
an die veränderten medizinischen<br />
Bedarfe der Zukunft – insbesondere für<br />
Südniedersachsen. „Es wird zukünftig<br />
immer wichtiger werden, seinen eigenen<br />
Nachwuchs auszubilden“, so Brück im<br />
<strong>faktor</strong>-Interview (siehe auch Seite 50).<br />
„Wir brauchen diese Höherqualifizierten<br />
im <strong>Gesundheit</strong>sbereich, weil sie in die Peripherie<br />
hinausgehen und viele Versorgungsleistungen<br />
übernehmen müssen, die früher<br />
von Familien geleistet wurden. Dafür ist<br />
der <strong>Gesundheit</strong>scampus ganz zentral.“<br />
DER CAMPUS IST INZWISCHEN auch<br />
seinen Kinderschuhen entwachsen. 2016<br />
wurde ein Gründungsdirektorium mit<br />
Mitgliedern aus UMG und HAWK eingerichtet,<br />
um sich zu koordinieren. „Inzwischen<br />
stimmen wir uns immer mehr auf<br />
einer operativen Ebene ab, während die<br />
präsidiale Ebene sich eher zurückzieht“,<br />
sagt Hudy feststellend. Die eigentliche<br />
Gründungsphase sei schon seit rund einem<br />
Jahr vorbei. „Wir brauchen das Gründungsdirektorium<br />
nicht mehr lange, weil<br />
wir ein gut laufendes gemeinsames Studien<br />
angebot haben. Daher erarbeiten wir<br />
gerade einen neuen Kooperationsvertrag.“<br />
Dabei war es ein intensiver, anspruchsvoller<br />
Prozess, so weit zu kommen. Die<br />
Routinen und Gepflogenheiten an der<br />
medizinischen Fakultät und der Fachhochschule<br />
waren unterschiedlich, mussten<br />
aber auf einen Nenner gebracht werden.<br />
So beginnt etwa die Ausbildung im<br />
dualen Studiengang Pflege an der UMG<br />
vor dem Lehrbeginn an der HAWK.<br />
„Dieses Jahr ist erstmals eine große<br />
Gruppe der Pflege-Bachelor zu unserer<br />
Erstsemesterbegrüßung auf den Zietenterrassen<br />
gefahren. Eine Kleinigkeit, aber<br />
auch wichtiges Signal, dass das zusammenwächst“,<br />
so Hudy. Oder das Beispiel<br />
Berufungsverfahren: Es wurden sehr<br />
BACHELOR-STUDIENGÄNGE DES<br />
GESUNDHEITSCAMPUS<br />
Pflege (dual) (seit WS 2016/2017)<br />
Therapiewissenschaften<br />
(Logo- und Physiotherapie; dual)<br />
(seit WS 2016/2017)<br />
Mediziningenieurwesen<br />
(seit WS 2017/2018)<br />
Soziale Arbeit im <strong>Gesundheit</strong>swesen<br />
(ab WS <strong>2019</strong>/2020)<br />
SPEZIAL 57
UMG Universitätsmedizin Göttingen<br />
Blick in die Zukunft<br />
HAWK-Präsident Marc Hudy<br />
verspricht sich vom neuen <strong>Gesundheit</strong>scampus<br />
einen potenziellen Problemlöser für regionale<br />
Herausforderungen im Medizinbereich.<br />
große Kommissionen gebildet, je zur<br />
Hälfte von der HAWK und UMG besetzt.<br />
„Es sind letztlich mehr Leute zu beteiligen.<br />
Aber es lohnt sich“, so Hudy.<br />
Der Lohn der Mühen ist ein – soweit<br />
bekannt – immer noch einzigartiges Projekt.<br />
In der Hochschulrektorenkonferenz<br />
werde vermehrt über solche Kooperationen<br />
gesprochen, so Hudy. Aber auf einer<br />
praktischen Ebene ist die Umsetzung wie<br />
in Göttingen immer noch einzigartig. Präsident<br />
Hudy beobachtet beispielsweise in<br />
den Berufungsverfahren, dass das Alleinstellungsmerkmal<br />
zieht. „So haben wir<br />
eine Professorin gewinnen können, die<br />
explizit gekommen ist, weil sie eine solche<br />
Kooperation mit einer Universitätsmedizin<br />
in Süddeutschland nicht gehabt<br />
hat.“<br />
DIE ENTWICKLUNG des <strong>Gesundheit</strong>scampus<br />
geht derweil ungebrochen mit<br />
dem Aufbau neuer Studiengänge weiter.<br />
Perspektivisch wird als Nächstes der<br />
Hebammenstudiengang dazukommen.<br />
Aber auch die Akademisierung mit entsprechenden<br />
Höherqualifizierungen wird<br />
weitergehen: In einem nächsten Schritt<br />
wird der erste Masterstudiengang Mediziningenieurwesen<br />
für den <strong>Gesundheit</strong>scampus<br />
Göttingen entwickelt. Auch über<br />
Promotionen denkt die UMG laut nach<br />
sowie über gemeinsame Berufungsverfahren<br />
mit der HAWK und eine stärkere Vernetzung<br />
der Professoren von HAWK und<br />
UMG. Zudem über eine stärkere Kooperation<br />
mit den starken Unternehmen der<br />
regionalen <strong>Gesundheit</strong>swirtschaft.<br />
MARC HUDY SIEHT im <strong>Gesundheit</strong>scampus<br />
ein enormes regionales Potenzial. „In<br />
fünf Jahren werden wir voraussichtlich<br />
nicht nur rund 700 Studierende haben,<br />
sondern auch gemeinsam mit der UMG<br />
aktiv Forschung betreiben.“ Der <strong>Gesundheit</strong>scampus<br />
kann sich zu einem Problemlöser<br />
im Medizinbereich entwickeln, der<br />
gezielt Lösungen entwickelt, die dann regional<br />
eingesetzt werden können. „Genau<br />
das versprechen wir uns davon: dass<br />
man gleich an den <strong>Gesundheit</strong>scampus<br />
denkt, wenn eine Lösung gesucht wird.“ƒ<br />
STUDIERENDENZAHLEN<br />
Studierende <strong>Gesundheit</strong>scampus:<br />
rund 300 (Stand: Oktober <strong>2019</strong>)<br />
Zielgröße Studierende <strong>Gesundheit</strong>scampus<br />
im ausgebauten Zustand:<br />
rund 725<br />
Studierende HAWK-Fakultät Naturwissenschaften<br />
und Technik<br />
(organisatorisches Dach des <strong>Gesundheit</strong>scampus<br />
Göttingen): rund 900<br />
Studierende medizinische Fakultät Uni<br />
Göttingen (Human-, Zahnmedizin,<br />
Molekulare Medizin): rund 3.100<br />
58<br />
SPEZIAL
UMG Universitätsmedizin Göttingen<br />
Ein steiniger Weg<br />
Die Universitätsmedizin Göttingen (UMG) und das Städtische Klinikum Braunschweig<br />
sind dabei, eine Lehrkooperation unter Dach und Fach zu bringen. Steht die Allianz, greift ein<br />
Rädchen ins andere – und es können an der UMG mehr Ärzte pro Jahr ausgebildet werden.<br />
TEXT SVEN GRÜNEWALD<br />
»Im Rahmen der<br />
Personalentwicklung<br />
sehen wir die Chance,<br />
besser neue Mitarbeiter<br />
zu gewinnen, indem<br />
wir unseren eigenen<br />
Nachwuchs ausbilden.“<br />
Der Ärztemangel ist ein seit vielen<br />
Jahren bekanntes Problem,<br />
das sich zukünftig noch<br />
verschärfen wird. Ein wesentlicher<br />
Grund ist der Umstand, dass rund<br />
drei Viertel aller Medizinstudierenden<br />
weiblich sind – von denen bekannt ist,<br />
dass viele später in Teilzeit arbeiten wollen.<br />
Gleichzeitig gibt es immer weniger<br />
Ärzte auf dem Land und differenzieren<br />
sich medizinische Berufsbilder stärker<br />
aus. Diese Entwicklung lässt sich beispielhaft<br />
am <strong>Gesundheit</strong>scampus Göttingen<br />
ablesen. Doch mit einem simplen Beschluss,<br />
die Zahl der Studienplätze für<br />
Medizin zu erhöhen, ist es nicht getan.<br />
DIE ZAHL DER STUDIENPLÄTZE, die<br />
eine medizinische Fakultät anbieten kann,<br />
hängt von zwei Faktoren ab: Im vorklinischen<br />
Bereich, das heißt den ersten vier<br />
Semestern, wird die Studienplatzkapazität<br />
von der Anzahl der Lehrenden bestimmt,<br />
während sie in den darauffolgenden<br />
sechs Semestern, dem sogenannten<br />
klinischen Bereich, ganz wesentlich von<br />
der Zahl der Patienten abhängt, die ein<br />
angehender Mediziner mindestens betreuen<br />
muss. Und bei den Patienten hat<br />
die Universitätsmedizin Göttingen ein<br />
Mengenproblem – es gibt schlicht zu wenige,<br />
um die volle Anzahl Medizinstudienanfänger<br />
angemessen auszubilden. Daher<br />
gibt es in Göttingen das Phänomen der<br />
sogenannten Teilstudienplätze – gegenwärtig<br />
sind es zwischen 30 und 60. Diesen<br />
Studierenden kann bislang nur ein<br />
Studienplatz bis zum Ende des vorklinischen<br />
Bereichs angeboten werden, dann<br />
müssen sie sehen, wo sie bleiben, sprich<br />
an andere Hochschulen wechseln.<br />
ÜBER DIE KOOPERATION MIT dem<br />
Städtischen Klinikum Braunschweig soll<br />
sich das bereits zum kommenden <strong>Winter</strong>semester<br />
2020/21 ändern, wenn dann in<br />
einem ersten Schritt die Teilstudierenden<br />
ab dem siebten Semester das Klinikum<br />
Braunschweig kennenlernen. Ab dem<br />
<strong>Winter</strong> semester 2021/22 sollen dann dieselben<br />
Teilstudierenden in Braunschweig<br />
weitermachen und ausgebildet werden –<br />
während sie formal weiterhin in Göttingen<br />
eingeschrieben sind. Niedersachsen<br />
verspricht sich von der Aufstockung der<br />
Medizinstudienplätze durch solche Ko<br />
60<br />
SPEZIAL
UMG Universitätsmedizin Göttingen<br />
FOTO: PETER SIERIGK<br />
Thomas Bartkiewicz, ärztlicher Direktor<br />
des Städtischen Klinikums Braunschweig<br />
ILLUSTRATIONEN: STOCK.ADOBE.COM<br />
operationen eine Verbesserung der<br />
Versorgungs situation, und auch in Braunschweig<br />
sieht man ein großes Potenzial in<br />
der Zusammenarbeit mit der UMG: „Im<br />
Rahmen der Personalentwicklung sehen<br />
wir die Chance, besser neue Mit arbeiter<br />
zu ge win nen, indem wir unseren eigenen<br />
Nachwuchs ausbilden“, so Thomas Bartkiewicz,<br />
ärztlicher Direktor des Städtischen<br />
Klinikums.<br />
ÄHNLICH WIE DIE UMG ist das Städtische<br />
Klinikum ein Maximalversorger mit<br />
dem Versorgungsgrad einer Universität<br />
und ebenfalls rund 65.000 Patienten pro<br />
Jahr. „Künftig sind wir nicht nur Maximalversorger,<br />
sondern unsere Leistungen<br />
in der Patientenversorgung werden auch<br />
mit dem Label einer universitären Institution<br />
veredelt. Das ist strategisch für uns<br />
wichtig“, so Bartkiewicz.<br />
Derzeit befinden sich das Klinikum und<br />
die UMG noch in der Feinabstimmung<br />
der Kooperationsvereinbarung. Unter anderem<br />
geht es um die Finanzen, die das<br />
Land über die UMG den Braunschweigern<br />
zusätzlich zur Verfügung stellen<br />
muss, damit dort die nötige Infrastruktur<br />
beispielsweise in Form von Unterrichtsräumen<br />
geschaffen und der zusätzliche<br />
Aufwand für die Ausbildung abgedeckt<br />
werden kann – von rund zehn Millionen<br />
Euro jährlich ist die Rede. „Der Weg ist<br />
steinig“, räumt Thomas Bartkiewicz ein,<br />
denn alle Aufwendungen für Lehre und<br />
Forschung müssen gegenfinanziert sein<br />
und dürfen nicht aus den Mitteln für die<br />
Patientenversorgung kommen. Bis Februar<br />
2020 soll die Vereinbarung stehen,<br />
dann kann der UMGCampus Braunschweig<br />
gegründet werden.<br />
AUCH IN DER INHALTLICHEN Ausgestaltung<br />
der Lehrkooperation gibt es<br />
noch offene Fragen. Insbesondere geht es<br />
darum, wie UMG und Städtisches Klinikum<br />
das hohe Niveau einer universitären<br />
Medizinerausbildung gewährleisten können,<br />
denn an solchen Kooperationen – so<br />
weit verbreitet sie inzwischen in Deutschland<br />
sind – regt sich auch Kritik. Befürchtet<br />
wird, dass in den kooperierenden Kliniken<br />
die Einheit aus Lehre, Forschung<br />
und Patientenversorgung nicht mehr gewährleistet<br />
werden kann und so eine Medizinerausbildung<br />
light entsteht.<br />
Sorgen, die Thomas Bartkiewicz nicht<br />
teilt. „Viele unserer Chef und Oberärzte<br />
sind habilitiert und lehren an Hochschulen.<br />
Darauf ruhen wir uns aber nicht aus,<br />
sondern werden bedarfsorientiert unser<br />
Personal didaktisch schulen.“ Eine Überlegung<br />
ist auch, die in Braunschweig dann<br />
in der Medizinerausbildung Lehrenden<br />
an der UMG anzustellen, so der neue<br />
Vorstandsvorsitzende der UMG, Wolfgang<br />
Brück.<br />
„AUFGRUND UNSERER SEHR guten<br />
Möglichkeiten als Maximalversorger und<br />
durch unser erfahrenes Personal können<br />
wir die Ausbildung auf einem qualitativen<br />
Niveau organisieren, mit dem wir uns hinter<br />
einer Universität nicht zu verstecken<br />
brauchen“, ist sich Bartkiewicz sicher.<br />
Zentral dafür sei jedoch die Klärung der<br />
Budgetfragen. Und noch einen Standortvorteil<br />
sieht der ärztliche Direktor in<br />
Braunschweig: die starke Braunschweiger<br />
Forschungslandschaft mit der TU Braunschweig<br />
und dem HelmholtzZentrum<br />
für Infektionsforschung. Beide sollen in<br />
die Kooperation mit eingebunden werden.<br />
ƒ<br />
SPEZIAL 61
UMG Universitätsmedizin Göttingen<br />
Die UMG von morgen<br />
Die Masterplanung bis 2037 für das Areal an der Robert-Koch-Straße<br />
FOTO UMG<br />
Lehre / Studium<br />
Ver- und<br />
Entsorgung<br />
Forschung<br />
Forschung<br />
62<br />
SPEZIAL
UMG Universitätsmedizin Göttingen<br />
Haupteingangsbereich<br />
Krankenversorgung<br />
ein neues<br />
Bettenhaus<br />
zentraler<br />
OP-Bereich /<br />
Notfallzentrum<br />
Administration<br />
drei Parkhäuser<br />
und eine<br />
Tiefgarage<br />
SPEZIAL 63
UMG Universitätsmedizin Göttingen<br />
Eine Landmarke<br />
verschwindet<br />
Bis zum Jahr 2037 durchläuft die Universitätsmedizin Göttingen eine vollständige<br />
Verwandlung: Die alten Gebäude verschwinden und werden für über eine Milliarde Euro<br />
durch Neubauten ersetzt – und das während des weiterhin laufenden Betriebs.<br />
TEXT SVEN GRÜNEWALD<br />
Die Göttinger Universitätsmedizin<br />
(UMG) ist eine weithin<br />
sichtbare Landmarke – ein<br />
schneeweißes, in den letzten<br />
knapp 50 Jahren seiner Existenz etwas<br />
angegrautes riesiges Gebäude, und darauf<br />
zahlreiche schwarze quaderförmige Hüte,<br />
die deutlich an die Steinhüte der Moai-<br />
Statuen der Osterinseln erinnern. Wo<br />
heute noch der eine zentrale huttragende<br />
Trumm die Universitätsklinik dominiert,<br />
soll es nach den gegenwärtigen Planungen<br />
in knapp 20 Jahren deutlich anders aussehen:<br />
Die Zufahrt von der Robert- Koch-<br />
Straße soll bestehen bleiben, sie führt aber<br />
zu einer langen Stichstraße, einer West-<br />
Ost-Achse, die von zahlreichen einzelnen<br />
Gebäuden gesäumt ist. Hier soll der neue<br />
UMG-Medizincampus entstehen.<br />
DER GRUND FÜR DEN KOMPLETTNEU-<br />
BAU mit einem Investitionsvolumen von<br />
geschätzten 1,1 Milliarden Euro: Weite<br />
Teile des Klinikums sind nach beinahe<br />
50 Jahren Betrieb aus technischen, wirtschaftlichen<br />
und organisatorischen Gründen<br />
dringend modernisierungsbedürftig.<br />
Eine Sanierung war aufgrund der Mehrkosten<br />
von geschätzten 300 Millionen<br />
Euro nicht infrage gekommen. Die UMG<br />
ist mit ihrem Sanierungsstau nicht allein<br />
– die Medizinische Hochschule Hannover<br />
(MHH) steht vor denselben Problemen,<br />
weshalb das Land Niedersachsen ein großes<br />
In vestitionsprogramm aufgelegt hat.<br />
Die Landesregierung schätzt den Investitionsbedarf<br />
beider Kliniken zusammen auf<br />
rund 2,1 Milliarden Euro. Auch, wenn es<br />
eine finanzielle Sonderbelastung des Haushalts<br />
darstellt: Das Land profitiert vom<br />
Niedrigzinsniveau – günstiger wird es nie<br />
neue Infrastruktur bauen können.<br />
FÜR DIE PLANUNGEN DES NEUEN Medizincampus<br />
der UMG und auch des Neubaus<br />
der MHH aus dem Sondervermögen<br />
hat das Land Niedersachsen inzwischen<br />
eine Bau-Dachgesellschaft ins Leben gerufen,<br />
die Aufsichts- und Kontrollfunktionen<br />
hat. An den beiden Standorten in<br />
Göttingen und in Hannover werden nun<br />
die Gründungen eigener Baugesellschaften<br />
vor bereitet, die jeweils die Planungen und<br />
Umsetzungen vor Ort durchführen sollen.<br />
Die Vorbereitungen für den Neubau des<br />
Bettenhauses samt Hubschrauberlandeplatz<br />
und gleichzeitig auch des neuen OP-<br />
Trakts und der Notaufnahme laufen derweil<br />
auf Hochtouren. Die Zufahrt zum<br />
Klinikum über die Robert-Koch-Straße<br />
ist inzwischen nicht mehr möglich, da das<br />
Pumpwerk und die Brücke zum Haupteingang<br />
abgerissen werden, um Platz für<br />
den Neubau zu schaffen. Die neue Zufahrt<br />
zur Notaufnahme ist über die Zimmermannstraße<br />
möglich. Der Spatenstich<br />
für den ersten Neubauabschnitt soll<br />
Anfang 2021 erfolgen, das Bettenhaus<br />
mit dem neuen OP-Trakt soll dann nach<br />
den gegenwärtigen Vorstellungen im Jahr<br />
2023/24 fertiggestellt sein.<br />
NACH UND NACH SOLLEN DANN weitere<br />
Gebäude auf dem UMG-Areal entstehen<br />
und im fertiggestellten Zustand<br />
den neuen UMG-Medizincampus bilden,<br />
der Patientenbetreuung, Medizinerausbildung<br />
und Forschung umfasst. ƒ<br />
64<br />
SPEZIAL
PROFIL<br />
ANZEIGE<br />
FOTO: UMG BGM<br />
Das BGM-Team der UMG<br />
(v.l.) Felicitas Horstmann,<br />
Leandro Buttaro, Sabrina<br />
Rudolph und Lia Biermann<br />
Für mich. Für dich. Für uns.<br />
Das Betriebliche <strong>Gesundheit</strong>smanagement an der Universitätsmedizin Göttingen stellt sich vor<br />
Seit zwei Jahren gibt es an der Universitätsmedizin<br />
Göttingen (UMG) den<br />
Bereich Betriebliches <strong>Gesundheit</strong>smanagement<br />
(BGM), der sich unter dem<br />
Slogan „Für mich. Für dich. Für uns.“ mit<br />
einer Vielzahl gesundheitsförderlicher Angebote<br />
für die <strong>Gesundheit</strong> und das Wohlbefinden<br />
der rund 8000 Mitarbeitenden<br />
an der UMG einsetzt. Neben zahlreichen<br />
Maßnahmen zur individuellen <strong>Gesundheit</strong>sförderung<br />
wie etwa Bewegungsangeboten<br />
(Gesund heitssport, bewegte Pause) und<br />
Workshops zu Ernährungsverhalten, Stressmanagement<br />
oder auch Resilienz fokus siert<br />
das BGM der UMG insbesondere auf die<br />
gesundheitsförder lichen Arbeits verhältnisse<br />
an der UMG. Die Ange bote erstrecken sich<br />
von Beratungen zur ergonomischen Arbeitsplatzgestaltung<br />
in Ko operation mit dem<br />
Betriebsärztlichen Dienst über Massage <br />
angebote bis hin zu BGMWillkommensbeuteln<br />
für neue Mit arbeitende. Besondere<br />
Aufmerksamkeit erhält zudem das<br />
soziale Miteinander der vielen Teams und<br />
Ab teilungen an der UMG. Ziele wie die<br />
Verbesserung der Kollegialität und der sozialen<br />
Unterstützung werden mit spezifischen<br />
Angeboten für Mitarbeitende und<br />
Führungskräfte verfolgt. Neben speziellen<br />
Angeboten zur Team entwicklung und Kollegialität<br />
werden vor allem gemeinsame Veranstaltungsteilnahmen<br />
– insbesondere bei<br />
den Göttinger Sport events (Tour d’Energie,<br />
Altstadtlauf etc.) – aktiv unterstützt. So werden<br />
zum Beispiel gemeinsame Vorbereitungskurse<br />
und Trainingsmöglichkeiten<br />
an ge bo ten. Vielfältige weitere Angebote im<br />
Bereich Freizeit und Sport (z. B. Nutzung<br />
des Hochschulsports und des FIZ, Eiswiese<br />
etc.) ergänzen die allgemeinen Angebote<br />
des BGM.<br />
DAS BGM VERFOLGT einen grundsätzlich<br />
partizipativen und mitarbeiterorientierten<br />
Ansatz, der die Vielfalt der verschiedenen<br />
Berufe und Arbeitsplätze mit ihren unterschiedlichen<br />
Anforderungen und Belastungen<br />
berücksichtigt. Sabrina Rudolph,<br />
Leiterin des BGM, stellt deshalb besonders<br />
heraus: „Um das Angebot im BGM<br />
möglichst zielgerichtet gestalten zu können,<br />
analysieren und evaluieren wir auf der<br />
Grundlage eines beteiligungsorientierten<br />
Ansatzes die spezifischen Belastungen<br />
und Anforderungen in einzelnen Bereichen<br />
gemeinsam mit den Mitarbeitenden. Dadurch<br />
können wir sicherstellen, dass wir<br />
gesundheitsförder liche Angebote passgenau<br />
auf die jeweiligen Bedürfnisse der<br />
einzelnen Abteilungen abstimmen.“<br />
Infos unter: http://go.umg.eu/bgm<br />
KONTAKT<br />
UNIVERSITÄTSMEDIZIN GÖTTINGEN<br />
Betriebliches <strong>Gesundheit</strong>smanagement<br />
Geschäftsbereich Personal<br />
VonBarStr. 2–4<br />
37075 Göttingen<br />
Tel. 0551 3965228<br />
sabrina.rudolph@med.uni-goettingen.de<br />
http://go.umg.eu/bgm
ANZEIGE<br />
Innovative Herzmedizin<br />
Dank individuell optimierter Therapien werden herzkranke Patienten<br />
bei guter Lebensqualität immer älter.<br />
„Sowohl operative als auch<br />
nicht operative Verfahren<br />
und präventive Maßnahmen<br />
gehören zu der modernen<br />
Herzmedizin, die von der<br />
interdisziplinären Zusammenarbeit<br />
aller beteiligten<br />
Spezialdisziplinen geprägt ist.“<br />
PROF. DR. GERD HASENFUSS<br />
Allein in Deutschland leiden zwischen<br />
zwei bis drei Millionen Menschen<br />
an einer Herzschwäche, jährlich<br />
kommen 300.000 neue Krankheitsfälle<br />
dazu. Der kontinuierliche Anstieg ist dabei<br />
nicht nur der demografischen Entwicklung<br />
geschuldet, sondern auch der verbesserten<br />
Notfallversorgung von Menschen mit<br />
akuten Herzerkrankungen wie dem Herzinfarkt.<br />
Dank individuell optimierter Therapien<br />
werden herzkranke Patienten bei guter<br />
Lebensqualität immer älter.<br />
Enormer technischer Fortschritt und<br />
zunehmende wissenschaftliche Expertise<br />
haben zu einer stetigen Weiterentwicklung<br />
der Herzmedizin geführt. Diese zeichnet<br />
sich durch interdisziplinäre Konzepte,<br />
minimalinvasive Techniken und eine<br />
individualisierte evidenzbasierte Medizin<br />
aus. Herzmedizin meint hierbei alle Diagnose<br />
und Behandlungsverfahren, die zu<br />
einer Verbesserung der Lebensqualität<br />
und Lebenserwartung von Patienten mit<br />
HerzKreislaufErkrankungen oder mit entsprechenden<br />
Risiko<strong>faktor</strong>en führen.<br />
„Sowohl operative als auch nicht operative<br />
Verfahren und präventive Maßnahmen<br />
gehören zu der modernen Herzmedizin,<br />
die von der interdisziplinären Zusammenarbeit<br />
aller beteiligten Spezialdisziplinen<br />
geprägt ist“, sagt Prof. Dr. Gerd Hasenfuß,<br />
Vorsitzender des Herzzentrums der Universitätsmedizin<br />
Göttingen.<br />
Im Herzzentrum der Universitätsmedizin<br />
Göttingen arbeiten vierzehn Kliniken und<br />
Institute sowie die Geschäftseinheit Pflegedienst<br />
der Universitätsmedizin Göttingen<br />
aus den Gebieten Herz, Gefäße, Lunge und<br />
Niere zusammen. Seit seiner Eröffnung am<br />
20. Dezember 2001 hat sich das HZG zu<br />
einem der führenden Spitzenzentren für<br />
HerzKreislaufMedizin in Euro pa entwickelt.<br />
In enger interdisziplinärer Zusammenarbeit<br />
bietet es seinen Patienten das gesamte<br />
Spektrum der modernen Diagnostikund<br />
Therapieverfahren.
PROFIL<br />
ANZEIGE<br />
FOTO: UMG/KIMMEL<br />
(Abb. 1) Seit Januar dieses Jahres verfügt das Herzzentrum Göttingen über den derzeit schnellsten und strahlungsärmsten<br />
HerzComputertomografen in Südniedersachsen und Nordhessen (v. l. Prof. Dr. Christian Ritter, Leitender Oberarzt des Instituts<br />
für Diagnostische und Interventionelle Radiologie der UMG, PD Dr. Tim Seidler, Leitender Oberarzt der Klinik für Kardiologie und<br />
Pneumologie der UMG, Prof. Dr. Joachim Lotz, Direktor des Instituts für Diagnostische und Interventionelle Radiologie der UMG).<br />
DIAGNOSTISCHE VERFAHREN<br />
Durch die stetige Weiterentwicklung der<br />
kardiovaskulären Bildgebung am Herzforschungsstandort<br />
Göttingen wurden die<br />
diagnostischen Möglichkeiten in der Praxis<br />
kontinuierlich verbessert. Inzwischen<br />
müssen immer weniger Untersuchungen<br />
invasiv per Herzkatheter erfolgen, bei<br />
gleichbleibender diagnostischer Präzision.<br />
Für den Patienten wird das passende Verfahren<br />
gewählt, um eine schnelle, genaue<br />
und schonende Diagnose zu gewährleisten.<br />
Stress-MRT<br />
Mithilfe der Magnetresonanztomografie<br />
können nicht nur Vorgänge des Herzens gut<br />
dargestellt werden, sondern auch eine Gewebedifferenzierung<br />
sowie eine Beurteilung<br />
der Herzfunktion strahlungsfrei erfolgen.<br />
Seit 2014 steht dem Herzzentrum Göttingen<br />
ein EchtzeitMRTGerät zur Verfügung.<br />
Die Göttinger Technologie ermöglicht eine<br />
bislang unerreichte zeitliche wie räumliche<br />
Auflösung der MRTBildgebung in Echtzeit.<br />
Anstatt einzelner Bilder kann die MRT das<br />
schlagende Herz mit einer zeitlichen Auflösung<br />
von 30 Millisekunden aufnehmen und<br />
daraus eine Bildserie oder einen MRTFilm<br />
mit 30 Bildern pro Sekunde erstellen. Dies<br />
kommt vor allem Patienten zugute, die wegen<br />
ihrer Erkrankung nicht mehr in der Lage<br />
sind, mehrere Sekunden den Atem anzuhalten,<br />
sowie Kindern, die bislang in Narkose<br />
versetzt werden mussten. Die Technologie<br />
ermöglicht darüber hinaus eine StressMRT<br />
mithilfe eines Fahrradergometers. Während<br />
der Untersuchung tritt der Patient liegend in<br />
die Pedale, um eine körperliche Belastungssituation<br />
hervorzurufen.<br />
Cardio-CT<br />
Die Computertomografie des Herzens (kurz<br />
CardioCT, Abb. 1) ist eine neue Methode,<br />
um Gefäßverkalkungen und verengungen<br />
des Herzens nachzuweisen, ohne einen<br />
direkten Eingriff in den Körper vorzu nehmen.<br />
Mithilfe der Röntgenröhre, die um den in<br />
Rückenlage liegenden Patienten rotiert,<br />
wird das Herz mit hoher Geschwindigkeit<br />
und in mehreren Schichten aufgenommen.<br />
Dies geschieht durch Röntgenstrahlen, die<br />
durch den Körper des Patienten geschickt<br />
und abgeschwächt in den Detektoren hinter<br />
dem Patienten aufgezeichnet werden. Aus<br />
den einzelnen Schnittbildern berechnet der<br />
Computer dreidimensionale Querschnittund<br />
Schichtaufnahmen des Herzens.<br />
Die Effizienz des CardioCTEinsatzes<br />
wurde 2018 in einer Studie aus Großbritannien<br />
bestätigt: Im FünfJahresVergleich<br />
führte die kombinierte Behandlung aus<br />
Standardtherapie und CardioCT zu einer<br />
deutlich höheren Überlebensrate der Patienten<br />
als die Standardtherapie alleine.<br />
„Schon seit neun Jahren arbeiten wir in der<br />
kardiovaskulären Bildgebung am Herzzentrum<br />
routinemäßig mit dem CardioCT. Das<br />
Verfahren erwies sich als wertvolle Ergänzung<br />
und sichere Methode für die Diagnostik<br />
der koronaren Herzkrankheit“, sagt<br />
Prof. Dr. Joachim Lotz, Direktor des Instituts<br />
für Diagnostische und Interventionelle<br />
Radiologie der UMG. „Seit Januar dieses<br />
Jahres verfügen wir zusätzlich über den<br />
derzeit schnellsten und strahlungsärmsten<br />
HerzComputertomografen in Südniedersachsen<br />
und Nordhessen.“<br />
Myokardszintigrafie<br />
Ein nuklearmedizinisches Untersuchungsverfahren<br />
zur Darstellung der Durchblutung<br />
des Herzmuskels ist die Myokardszintigrafie.<br />
Sie wird sowohl unter Ruhe als auch unter<br />
Belastungsbedingungen durchgeführt und<br />
erlaubt visuelle und quantitative Auswertungen<br />
der Herzmuskeldurchblutung, der
ANZEIGE<br />
(Abb. 3) CardioBand.<br />
Bild: Edwards Lifesciences Corporation<br />
FOTO: HZG/LANGE<br />
(Abb. 2) Führen den Eingriff gemeinsam durch: Prof. Dr. Ingo Kutschka (l.), Direktor der<br />
Klinik für Thorax, Herz und Gefäßchirurgie der UMG, und Prof. Dr. Claudius Jacobshagen (r.),<br />
Leitender Oberarzt und stellvertretender Direktor der Klinik für Kardiologie und Pneumologie der<br />
UMG, während des Einsetzens eines TrikuspidalklappenCardioBands.<br />
Herzwandbewegung und der Pumpfunktion.<br />
Zunächst wird der Patient durch eine Ergometrie<br />
oder durch ein Medikament belastet.<br />
Wenn die maximale Belastung erreicht ist,<br />
wird eine geringe Menge eines radioaktiven<br />
Arzneimittels (Thallium) in eine Vene injiziert.<br />
Dieses verteilt sich entsprechend der<br />
Durchblutung in den Herzmuskelzellen. Anschließend<br />
kann das Thallium mithilfe einer<br />
hochempfindlichen GammaKamera sichtbar<br />
gemacht werden. ›<br />
Während die kardiovaskuläre Bildgebung<br />
auf immer mehr Krankheitsbilder optimiert<br />
und die Diagnostik von Herz erkrankungen<br />
deutlich vereinfacht wird, werden die therapeutischen<br />
Maßnahmen stetig komplexer<br />
und spezifischer. Bestätigt sich der Verdacht<br />
einer Herzerkrankung, ist es besonders<br />
wichtig, für jedes Stadium und Krankheitsbild<br />
die passende Behandlung zu<br />
wählen. Am Herzzentrum Göttingen steht<br />
für jeden Patienten die richtige Therapieoption<br />
zur Verfügung.<br />
THERAPEUTISCHE VERFAHREN<br />
Minimalinvasive, katheter gestützte<br />
Verfahren<br />
Bei defekten Herzklappen<br />
Resultiert die Herzerkrankung aus einer<br />
Fehlfunktion einer Herzklappe, können minimalinvasive,<br />
kathetergestützte Verfahren<br />
helfen. Mithilfe der MitraClipTherapie wird<br />
eine Verbindung in der Mitte der beiden<br />
Mitralsegel geschaffen, um die Undichtigkeit<br />
der Herzklappe zu vermindern. Unter<br />
stetiger Echokontrolle wird der Clip mittels<br />
Herzkatheter exakt an der undichtesten<br />
Stelle zwischen den Segeln der Mitralklappe<br />
positioniert.<br />
Mit einem sogenannten CardioBand<br />
(Abb. 2+3) wird der krankhaft erweiterte<br />
Ring der Mitralklappe gerafft und so die<br />
Undichtigkeit beseitigt. Mithilfe eines präzisen<br />
Navigationskatheters werden bis zu<br />
15 einzelne Ankerschrauben halbmondförmig<br />
im Bindegewebe des Klappenrings im<br />
Herzen befestigt. Anschließend wird das<br />
Band so weit gerafft, bis die Klappensegel<br />
die Gefäßöffnung wieder abdecken können.<br />
Als erstes Universitätsklinikum in Niedersachsen<br />
versorgt die UMG seit diesem Jahr<br />
auch Patienten mit einer undichten Trikuspidalklappe<br />
durch das minimalinvasive<br />
CadioBandVerfahren. Bislang konnte die<br />
Erkrankung der Trikuspidalklappe nur chirurgisch<br />
behandelt werden.<br />
Ist die Aortenklappe betroffen und verkalkt,<br />
kann diese durch eine künstliche<br />
Klappe ersetzt werden. Die Trans katheter<br />
AortenklappenImplantation (TAVI) erfolgt<br />
am schlagenden Herzen. Dabei wird eine<br />
klein zusammengefaltete, biologische Aortenklappe<br />
mithilfe eines Katheters in die linke<br />
Herzkammer an die Stelle der Verkalkung<br />
geführt. Anschließend wird sie aufgespannt,<br />
sodass sie die alte, defekte Klappe an die<br />
Gefäßwand drückt und die Funktion der betroffenen<br />
Klappe übernimmt.<br />
Wenn der Druck zu hoch ist<br />
Während die genannten Verfahren nur bei<br />
einer systolischen Herzinsuffizienz infrage<br />
kommen, bei der sich das Herz nicht mehr<br />
vollständig zusammenziehen kann, gab es<br />
bislang nur wenige Möglichkeiten zur Therapie<br />
der diastolischen Herzinsuffizienz.<br />
Bei dieser verliert die linke Herzhälfte an<br />
Elastizität, sodass sie mit einem höheren<br />
Widerstand gefüllt werden muss, ehe das<br />
Blut in den Körperkreislauf weitergepumpt<br />
werden kann. Der dadurch entstehende<br />
Blutrückstau in die Lungen führt zur Entstehung<br />
von Luftnot. Zur Entlastung der<br />
Lungenstrombahn ist seit Neuestem das<br />
InterAtrial Shunt Device (IASD)System<br />
für die tägliche Praxis zugelassen. Bei einem<br />
minimalinvasiven Eingriff wird eine<br />
kleine Öffnung in der Vorhofscheidewand<br />
geschaffen, in der das IASD platziert wird<br />
und eine Verbindung zwischen linkem und<br />
rechtem Herzvorhof bildet. Dadurch wird<br />
ein Druckabfall des linken Vorhofs sowohl<br />
in Ruhe als auch bei Aktivität ermöglicht.
PROFIL<br />
ANZEIGE<br />
FOTO: HZG/SCHMIDT<br />
Chirurgische Verfahren<br />
Bei vielen Patienten bietet nur der chirurgisch<br />
korrigierende Eingriff an der Herzklappe<br />
Aussicht auf Heilung. Neben der<br />
Standardmethode, der Operation am<br />
offenen Herzen mit Durchtrennung des<br />
Brustbeins, haben sich in den letzten Jahren<br />
auch in der Herzchirurgie zunehmend<br />
minimalinvasive Verfahren etabliert. Hierdurch<br />
können die Eingriffe schonender<br />
durchgeführt werden.<br />
Minimalinvasive Herzklappen-OP<br />
Bei einer Operation an der Mitralklappe<br />
wird auf der rechten Seite des Brustkorbs<br />
ein kleiner Schnitt gemacht und die Operation<br />
zwischen zwei Rippen hindurch<br />
ausgeführt. Die Sicht auf das Operationsfeld<br />
wird durch modernste endoskopische<br />
3DVideotechnik gewährleistet. Wenn<br />
mög lich, versuchen die Ärzte, den Defekt<br />
an der Herzklappe zu beheben und diese<br />
zu erhalten. Ist die Rekonstruktion der<br />
Klappe nicht mehr möglich, wird eine mechanische<br />
oder biologische Herzklappenprothese<br />
eingesetzt.<br />
Unterstützung für das schwache Herz<br />
Trotz intensiver Behandlung kann eine Herzschwäche<br />
lebensbedrohlich werden, sodass<br />
eine Herztransplantation nötig ist. Eine<br />
Möglichkeit, die oft jahrelange Wartezeit<br />
bis zur Transplantation zu überbrücken, ist<br />
die chirurgische Implantation eines Linksherzunterstützungssystems<br />
(LVAD, Abb. 4),<br />
einer mechanischen Pumpe. Der LVADEinsatz<br />
kann auch als Dauer lösung dienen,<br />
wenn für den Patienten keine Herztransplantation<br />
infrage kommt. Das Gerät ist mit<br />
dem Herzen verbunden und entlastet es<br />
durch kontinuierliches Pumpen von Blut aus<br />
der linken Herzkammer in die Aorta, sodass<br />
sauerstoffreiches Blut in den Körper gelangt.<br />
„Die Entscheidung, welches Verfahren für<br />
den einzelnen Patienten am besten geeignet<br />
ist, wird am Herzzentrum der Universitätsmedizin<br />
Göttingen vom Herzteam<br />
aus Kardiologen und Herzchirurgen gemeinsam<br />
getroffen. Somit wird eine bestmögliche,<br />
individuelle Behandlung der<br />
verschiedenen Stadien der Herzschwäche<br />
gewährleistet – im Sinne einer individualisierten<br />
Herzmedizin“, sagt Prof. Dr. Ingo<br />
Kutschka, Direktor der Klinik für Thorax,<br />
Herz und Gefäßchirurgie der UMG.<br />
(Abb. 5) Interdisziplinäres Team: Visiten werden<br />
unter anderem gemeinsam von Kardiologen<br />
und Herzchirurgen durchgeführt. Welche<br />
Behandlung für den Patienten am besten ist,<br />
wird in enger Absprache mit allen beteiligten<br />
Abteilungen entschieden (Mitte: Prof. Dr. Gerd<br />
Hasenfuß, Direktor der Klinik für Kardiologie<br />
und Pneumologie und Vorsitzender des Herzzentrums<br />
der UMG; r.: Prof. Dr. Ingo Kutschka,<br />
Direktor der Klinik für Thorax, Herz und<br />
Gefäßchirurgie).<br />
KONTAKT<br />
Universitätsmedizin Göttingen<br />
Herzzentrum Göttingen<br />
Tel. 0551 3965044<br />
infocenter@med.uni-goettingen.de<br />
www.herzzentrum.umg.eu
ANZEIGE<br />
Starkes Netzwerk für<br />
den Patienten<br />
Thoraxchirurgie an der Universitätsmedizin Göttingen<br />
Der Bereich Thoraxchirurgie behandelt<br />
Patienten mit Erkrankungen<br />
der Lunge, des Mittelfells oder der<br />
Brustwand. Das gesamte OP-Spektrum der<br />
Thoraxchirurgie wird mit modernen Verfahren<br />
abgedeckt. Besondere Schwerpunkte<br />
unserer Klinik liegen in der Behandlung<br />
von Lungenkrebs, von Thymustumoren,<br />
von entzündlichen Erkrankungen der Lunge<br />
und des Brustfells.<br />
Neben dem Pflege- und Funktionsbereichspersonal<br />
gewährleisten fünf langjährig erfahrene<br />
und spezialisierte Ärzte eine hochwertige<br />
medizinisch-chirurgische Betreuung.<br />
LUNGENKREBS<br />
Nach wie vor ist unter den bösartigen Erkrankungen<br />
der Lungenkrebs bei Männern<br />
die häufigste, bei Frauen die zweithäufigste<br />
Todesursache. Die Operation ist trotz<br />
der immensen Fortschritte in der Krebsbehandlung<br />
bei der kurativen Behandlung<br />
des Lungenkrebses die wichtigste Säule. Damit<br />
in der Region Göttingen möglichst viele<br />
Menschen mit Lungenkrebs eine bestmögliche<br />
Behandlung bekommen können, wurde<br />
das Lungentumorzentrum Universität<br />
Göttingen gegründet, dessen chirurgischer<br />
Arm die Thoraxchirurgie darstellt. In diesem<br />
Zentrum werden die Kräfte der Universitätsmedizin<br />
Göttingen, der Lungenfachklinik<br />
Immenhausen und des Ev. Krankenhauses<br />
Göttingen-Weende inkl. der Lungenfachklinik<br />
in Lenglern gebündelt.<br />
Dieses Zentrum ist seit 2014 durch die<br />
Deutsche Krebsgesellschaft (DKG) zertifiziert.<br />
Für die Patienten besteht die Sicherheit,<br />
dass das ärztliche und pflegerische Personal<br />
eine gute Ausbildung und viel Erfahrung hat<br />
und sich kontinuierlich weiterbildet. Behandlungsempfehlungen<br />
werden hier grundsätzlich<br />
durch ein Team verschiedener Fachrichtungen<br />
ausgesprochen. Durch die jährlich<br />
neu zu bestätigende Zertifizierung werden<br />
die Strukturqualität und die Ergebnisse der<br />
Behandlung überprüft. Dazu werden zum<br />
Beispiel die Patientenzahl, Komplikationen,<br />
die Langzeitergebnisse und die Einhaltung<br />
der Entscheidungs- und Behandlungsregeln<br />
kontrolliert.<br />
INTERDISZIPLINARITÄT<br />
Ein großes Anliegen ist die Interdisziplinarität,<br />
die in der Thoraxchirurgie an vielen<br />
Stellen gepflegt wird. Die Patienten sind auf<br />
einer Station untergebracht, auf der auch<br />
Ärzte der Lungenheilkunde tätig sind. So<br />
können die Patienten chirurgisch und internistisch<br />
in gleicher Weise betreut werden.<br />
Bei ausgedehnten Lungenkrebserkrankungen,<br />
die auch Organe neben der Lunge<br />
betreffen, kommt die enge Zu sam menarbeit<br />
mit allen chirurgischen Fachabteilungen<br />
zum Tragen. Solche Operationen<br />
werden gemeinsam mit den Ärzten der Unfall-<br />
und plastischen Chirur gie, der Neurochirurgie,<br />
der Herz- und Gefäßchirur gie<br />
oder der Viszeralchirurgie durchgeführt. So<br />
ist gewährleistet, dass für jeden Teilaspekt<br />
der Operation ein Spezialist an der OP teilnimmt.<br />
Abgesehen von der Kooperation mit<br />
dem Lungentumorzentrum besteht eine<br />
enge Zusammenarbeit mit dem zertifizierten<br />
Zentrum für Neuromuskuläre Erkrankungen<br />
der UMG. Patienten mit einer<br />
Myasthenia gravis, bei der eine vermehrte<br />
Muskel ermüdung durch Antikörper vorliegt,<br />
werden unter anderem hier behandelt.<br />
Wenn eine Vergrößerung der Thymusdrüse<br />
oder eine Myasthenia gravis vorliegt, wird<br />
gemeinsam entschieden, ob eine Entfernung<br />
des Gewebes aus dem Mittelfell und<br />
der Thymusdrüse anzuraten ist.
PROFIL<br />
ANZEIGE<br />
FOTO: : UMG/KIMMEL<br />
Auch bei Patienten mit Unfällen, die den<br />
Brustkorb betreffen, wird gemeinsam mit<br />
den Ärzten der Unfallchirurgie in entsprechenden<br />
Fällen eine operative Behandlung<br />
durchgeführt.<br />
Wenn Erkrankungen der Luftröhre zu<br />
Operationen zwingen, besteht eine Kooperation<br />
mit der Klinik für Hals-Nasen-Ohrenheilkunde.<br />
INDIVIDUALISIERUNG<br />
Natürlich werden Patienten entsprechend<br />
der geltenden Leitlinien und der aktuellen<br />
Forschung behandelt. Trotzdem nimmt der<br />
Grad an Individualisierung zu – die zunehmende<br />
Anzahl an OP-Techniken und die<br />
Berücksichtigung der Lebenssituation, der<br />
Lebensqualität und die Erwartungen des<br />
Patienten führen dazu. Die chirurgische<br />
Behandlung wird speziell auf den einzelnen<br />
Patienten zugeschnitten. Im Vorfeld wird<br />
möglichst genau überlegt, wie viel Lungengewebe<br />
entfernt werden muss oder kann,<br />
und es werden möglichst schonende Techniken<br />
angewandt.<br />
Der Individualisierungsgrad ist bei den<br />
entzündungsbedingten Erkrankungen besonders<br />
hoch. Wenn sich im Rahmen ei-<br />
ner Lungenentzündung im Brustkorb zwischen<br />
Lunge und Brustwand Flüssigkeiten<br />
ansammeln, müssen eventuell operative<br />
Maßnahmen durchgeführt werden, wie<br />
etwa die Einlage eines Wundschlauches,<br />
eine Brusthöhlenspiegelung oder eine Operation<br />
mit der Befreiung der Lunge von entzündungsbedingten<br />
Narbenplatten, die die<br />
Lunge fesseln.<br />
Die Notwendigkeit, das eine oder andere<br />
zu tun, ist nach genauer Untersuchung mit<br />
Röntgenbildern, Ultraschall oder Computertomografien<br />
festzulegen. Entscheidend sind<br />
auch der Zustand des Patienten, die Entzündungsstärke<br />
und die Erkrankungsdauer.<br />
Wenn diese Dinge erfolgen, gibt es meist<br />
gute Aussichten, die Entzündung erfolgreich<br />
zu behandeln und auch die ursprüngliche<br />
Lungenfunktion weitestgehend zu erhalten.<br />
TECHNIK FÜR DAS PATIENTENWOHL<br />
In den letzten 20 Jahren hat die technische<br />
Miniaturisierung auch in der Chirur gie Einzug<br />
gehalten, und es sind – ohne Einbuße<br />
der Behandlungsqualität – immer mehr<br />
Eingriffe in der minimalinvasiven Methode<br />
durchführbar. Eingriffe können unter<br />
Kamera sicht mittels dünner Instrumente<br />
über mehrere 1 cm große Öffnungen in der<br />
Brustwand durchgeführt werden. Die daraus<br />
resultierende Gewebeschonung führt zu<br />
einer schnelleren Erholung und kürzeren<br />
Kranken hausaufenthalten. Noch präziser<br />
kann mit dem da-Vinci ® -OP-Robotersystem<br />
gearbeitet wer den, das auch an der UMG<br />
eingesetzt wird.<br />
KONTAKT<br />
Universitätsmedizin Göttingen<br />
Klinik für Thorax-, Herz- und Gefäßchirurgie<br />
Dr. Marc Hinterthaner<br />
Leiter Bereich Thoraxchirurgie<br />
Tel. 0551 39-66008<br />
www.thg.uni-goettingen.de
ANZEIGE<br />
Experten für kranke Gefäße<br />
Minimalinvasive Therapie bei Erkrankungen der Aorta (Hauptschlagader) und der arteriellen<br />
Gefäße an der Universitätsmedizin Göttingen<br />
Die Gefäßprothese (l.) wird der Anatomie der<br />
Aorta individuell angepasst. Hierzu werden<br />
die Gefäße der Patienten exakt vermessen und<br />
mithilfe von Simulationen zu einem 3D-Modell<br />
(r.) gefertigt.<br />
Im Oktober 2017 wurde in der Klinik<br />
für Thorax-, Herz- und Gefäßchirurgie<br />
der Universitätsmedizin Göttingen ein<br />
neuer Behandlungsschwerpunkt für die<br />
minimalinvasive Behandlung von komplexen<br />
Erkrankungen der Aorta und peripheren<br />
Gefäße etabliert. Das bestehende<br />
Angebot des gefäßchirurgischen Bereichs<br />
(Leitung: Florian Elger, Foto) wurde seither<br />
weiter ausgebaut.<br />
ETWA 40 VON 100.000 MENSCHEN erkranken<br />
jährlich an einem Aortenaneurysma,<br />
einer Aussackung der Hauptschlagader.<br />
Je größer der Durchmesser des Aneurysmas<br />
ist, desto größer ist auch die Gefahr<br />
eines Risses (Ruptur). Insofern sollte ab einer<br />
bestimmten Größe und spätestens bei<br />
deutlichen Beschwerden eine offene Operation<br />
oder ein minimalinvasiver Eingriff<br />
zur Implantation einer Gefäßstütze (Stent)<br />
dringend in Erwägung gezogen werden.<br />
Der Einriss der Gefäßwand (Ruptur) stellt<br />
in den meisten Fällen einen lebensbedrohlichen<br />
Notfall dar.<br />
Liegt das Aneurysma im unteren Teil der<br />
Aorta, unterhalb des Abgangs der Nierengefäße<br />
(infrarenales Aortenaneurysma), ist<br />
eine minimalinvasive Stent-Implantation<br />
über einen Zugang an den Leistenschlagadern<br />
in der Regel gut durchführbar. Der<br />
prothetische Ersatz der Aorta im Rahmen<br />
einer offenen Operation erfordert im Langzeitverlauf<br />
zwar weniger Nachkontrollen als<br />
ein Stent, ist aber körperlich deutlich belastender<br />
und daher für jüngere und gesündere<br />
Patienten die Therapie der Wahl.<br />
KOMPLIZIERTER WIRD ES, wenn das<br />
Aneurysma auch Abschnitte der Hauptschlagader<br />
im Brustraum oder im oberen<br />
Bauchraum betrifft (thorakales Aortenaneurysma),<br />
da hier zahlreiche lebenswichtige<br />
Arterien – zum Beispiel für den Darm,<br />
die Leber oder die Nieren – entspringen. In<br />
diesen Fällen ist die klassische offene Operation<br />
sehr kompliziert und mit erheblichen<br />
Risiken verbunden. Für die Behandlung des<br />
thorakalen Aortenaneurysmas stehen heutzutage<br />
sogenannte „fenestrierte Stents“ zur<br />
Verfügung, die individuell auf den jeweiligen<br />
Patienten angepasst sind. Die Stents<br />
verfügen über kleine Öffnungen, über die<br />
weitere Stents zur Versorgung der Darmund<br />
Nierendurchblutung eingesetzt werden<br />
können. Das Risiko und die körperliche<br />
Belastung für den Patienten liegen deutlich<br />
unter dem einer offenen Operation.<br />
Die Planung und Implantation der patientenindividuellen<br />
Stents erfordert eine<br />
sehr hohe Expertise und optimale technische<br />
Ausstattung der behandelnden Klinik.<br />
Die Eingriffe werden unter anderem mithilfe<br />
von 3D-Modellen und moderner Computersoftware<br />
millimetergenau geplant.<br />
AN DER UNIVERSITÄTSMEDIZIN GÖT-<br />
TINGEN werden die hochkomplexen Eingriffe<br />
in hoher Zahl und mit sehr guten<br />
Ergebnissen in enger Zusammenarbeit von<br />
Spezialisten der Klinik für Thorax-, Herzund<br />
Gefäßchirurgie (Direktor: Prof. Dr.<br />
Ingo Kutschka) und des Instituts für Diagnostische<br />
und Interventionelle Radiologie<br />
(Direktor: Prof. Dr. Joachim Lotz) durchge-
PROFIL<br />
ANZEIGE<br />
FOTOS : UMG/KIMMEL<br />
Die prä- und postoperative Untersuchung gefäßchirurgischer Patienten wird in der Poliklinik der Klinik für Thorax-, Herz- und<br />
Gefäßchirurgie der Universitätsmedizin Göttingen durchgeführt.<br />
führt. Dies gilt ebenfalls für die schwierige<br />
Therapie einer Aortendissektion (Einriss der<br />
inneren Wandschichten der Schlagadern)<br />
und andere Pathologien im Bereich des<br />
Aortenbogens. Um die bestehenden Möglichkeiten<br />
zu erweitern, wird im Dezember<br />
<strong>2019</strong> einer der modernsten Hybrid-Operationssäle<br />
Deutschlands in Betrieb genommen,<br />
der mit aktuellster Röntgen- und Computertechnik<br />
ausgestattet ist. Die Patien ten<br />
profitieren von noch mehr Sicherheit und<br />
verkürzten Eingriffszeiten. Zudem können<br />
schwierige Eingriffe, beispielsweise am<br />
Aortenbogen, im Rahmen einer Narkose<br />
als Hybrid-Operation durchgeführt werden.<br />
Hierbei wird ein Teil der Operation offen<br />
chirurgisch unter Einsatz der Herz-Lungen-<br />
Maschine durchgeführt, der zweite Teil anschließend<br />
endovaskulär mit Stentimplantation<br />
unter Röntgendurchleuchtung.<br />
SEIT 2017 PROFITIEREN DIE PATIENTEN<br />
von einer weiteren technischen Entwicklung:<br />
Schon jetzt werden nahezu alle Eingriffe<br />
an den Hauptschlagadern mittels<br />
eines etwa nur 1 cm langen Schnitts in der<br />
Leistenregion perkutan durchgeführt. Das<br />
weitere Freilegen der Leistenschlagadern<br />
mit anschließender längerer Wundheilung<br />
entfällt, da die Leistenschlagadern mithilfe<br />
eines sogenannten Verschlusssystems nach<br />
dem Einsetzen des Stents wieder verschlossen<br />
werden. Dieses Vorgehen sorgt<br />
für eine geringe Wundfläche mit schneller<br />
Heilung und zügiger Genesung nach dem<br />
Eingriff. Die notwendige Aufenthaltsdauer<br />
in der Klinik reduziert sich damit in der Regel<br />
deutlich.<br />
Auch die übrigen Erkrankungen der Gefäße<br />
(Arterien und Venen) werden im Bereich<br />
Gefäßchirurgie der Klinik für Thorax-, Herzund<br />
Gefäßchirurgie der UMG auf höchstem<br />
Niveau, nach aktuellem Stand der Wissenschaft<br />
und möglichst minimalinvasiv<br />
durchgeführt. Weitere Behandlungsschwerpunkte<br />
liegen in der Behandlung der Schaufensterkrankheit<br />
(pAVK), der hirnversorgenden<br />
Gefäße und der Shuntchirurgie.<br />
„NEBEN EINER OPTIMALEN operativen<br />
Versorgung setzen wir uns eine schnelle<br />
Genesung der Patientinnen und Patienten<br />
und das Vermeiden von langer Immobilität<br />
als Ziel. Herausragende Pflegekräfte,<br />
Wundmanager und Physiotherapeuten sorgen<br />
während des stationären Aufenthaltes<br />
für optimale Bedingungen. Es besteht eine<br />
exzellente Zusammenarbeit mit den assozi-<br />
ierten Fachabteilungen der UMG, um auch<br />
bei schwierigen Fällen oder komplizierten<br />
Begleiterkrankungen eine optimale Behandlung<br />
zu gewährleisten. Zudem gibt es<br />
eine regelmäßig stattfindende Gefäßkonferenz,<br />
in der alle Patienten interdisziplinär<br />
diskutiert werden und in der die jeweiligen<br />
Therapien festgelegt werden“, sagt Florian<br />
Elger, Bereichsleiter Gefäßchirurgie der Klinik<br />
für Thorax-, Herz- und Gefäßchirur gie<br />
der UMG.<br />
KONTAKT<br />
Universitätsmedizin Göttingen<br />
Klinik für Thorax-, Herz- und Gefäßchirurgie<br />
Florian Elger (Bereichsleiter Gefäßchirurgie)<br />
Tel. 0551 39-66004<br />
thgchir@med.uni-goettingen.de<br />
thg.uni-goettingen.d
ANZEIGE<br />
PROFIL<br />
Zum Wohl der Patienten<br />
Klinikdirektor Prof. Dr. Dirk<br />
Beutner behält bei der<br />
Aus- und Weiterbildung,<br />
Forschung und Krankenversorgung<br />
stets die<br />
Zukunft im Blick.<br />
FOTO: UMG (HNO KLINIK)<br />
Medizin mit Köpfchen<br />
Die Klinik für Hals-Nasen-Ohrenheilkunde der UMG ist breit aufgestellt.<br />
Die Klinik für Hals-Nasen-Ohrenheilkunde<br />
der Universitätsmedizin<br />
Göttingen (UMG) gilt als eine der<br />
deutschlandweit führenden spitzenmedizinischen<br />
Einrichtungen und ist von den<br />
drei eng ineinandergreifenden Bereichen<br />
Krankenversorgung, Forschung und Lehre<br />
geprägt.<br />
EIN TRADITIONELLER SCHWERPUNKT<br />
der Klinik liegt in der Erforschung und Behandlung<br />
von Krebserkrankungen des Kopf-<br />
Hals-Bereichs. Im zertifizierten Kopf- Hals-<br />
Tumorzentrum wird der Fokus nicht nur<br />
auf die Rolle des körpereigenen Immunsystems<br />
bei der Bekämpfung von Tumorerkrankungen<br />
gelegt, sondern auch auf einen<br />
chirurgischen Forschungsschwerpunkt:<br />
den Einsatz von Operationsrobotern wie<br />
dem da Vinci Xi. Mit diesem ist es möglich,<br />
auch in unzugänglichen, engen Regionen<br />
des Rachens extrem präzise und gleichzeitig<br />
schonend durch den Mund zu operieren.<br />
Bei komplexen Krebserkrankungen profitieren<br />
die Patienten von der Zusammenarbeit<br />
verschiedener Krebsexperten im interdisziplinären<br />
Universitäts-Krebszentrum G-CCC<br />
(Göttingen Comprehensive Cancer Center).<br />
EIN WEITERER SCHWERPUNKT der Klinik<br />
liegt in der Behandlung von Schwerhörigkeiten.<br />
Hier steht insbesondere die<br />
Wiederherstellung der Hörfähigkeit durch<br />
Cochlea-Implantate (CI) im Vordergrund.<br />
Mit einem CI werden die Fasern der Hörnerven<br />
elektrisch erregt und somit das Hören<br />
wiederhergestellt. Die Cochlea-Implantation<br />
ist aber nur eine Möglichkeit, mit<br />
denen die Spezialisten des Hörzentrums<br />
der UMG ihren Patienten verloren gegangenes<br />
Hören wiederherstellen können.<br />
DIE 29 ÄRZTINNEN UND ÄRZTE der<br />
auch überregional gefragten HNO-Klinik<br />
behandeln jährlich ca. 3.000 stationäre Patienten<br />
aller Altersgruppen und haben rund<br />
25.000 ambulante Patientenkontakte. Dabei<br />
besitzen die Medizinerinnen und Mediziner<br />
eine besondere Expertise bei der Versorgung<br />
schwerwiegender Erkrankungen sowie<br />
in medizinischen HNO-Notfällen jeder Art.<br />
Neben der Allergiebehandlung im Rahmen<br />
des zertifizierten Allergiezentrums Südniedersachsen<br />
gehören eine große Bandbreite<br />
von Spezialsprechstunden zum<br />
Konzept der Klinik. Hier informieren und<br />
beraten die HNO-Experten zu Themen wie<br />
Sprache und Stimme, kindlichen Hörstörungen,<br />
Hörimplantaten, Nasen und Nasennebenhöhlen<br />
sowie schlafbezogenen<br />
Atemstörungen ebenso wie zu plastischästhetischen<br />
Themen inklusive der Behandlung<br />
mit Botulinumtoxin.<br />
„Unsere Klinik richtet all ihre Kompetenzen<br />
in Aus- und Weiterbildung, Forschung<br />
und Krankenversorgung auf ein Ziel aus –<br />
unseren Patienten optimal zu helfen“, sagt<br />
der Klinikdirektor Prof. Dr. Dirk Beutner zusammenfassend.<br />
KONTAKT<br />
Klinik für Hals-Nasen-Ohrenheilkunde der<br />
Universitätsmedizin Göttingen<br />
Robert-Koch-Straße 40<br />
37075 Göttingen<br />
Tel. 0551 39-63771<br />
hno.umg.eu
ANZEIGE<br />
Abbildung: Von links nach rechts sieht man, wie<br />
die Sonde in den Tumorknoten im Wirbelkörper<br />
eingeführt wird (1). Durch die Erhöhung der<br />
Temperatur sieht man, wie der Tumorknoten<br />
zerstört wird (2 und 3; die Sonde ist auf<br />
Teil abbildung 3 wieder entfernt). Durch den<br />
gleichen Arbeitskanal kann der zerstörte Bereich<br />
dann mit Zement wieder aufgefüllt werden (4).<br />
(mit freundlicher Genehmigung durch T. Krüger)<br />
PROFIL<br />
Neuartige Methode hilft<br />
Die Klinik für Neurochirurgie der UMG bietet mittels gezielter Radiofrequenz-Ablation<br />
eine Behandlung von Wirbelsäulenmetastasen an.<br />
Bis zu 85 Prozent der Patienten mit<br />
Krebserkrankungen leiden an umschriebenen<br />
Rückenschmerzen. Die<br />
Schmerzen werden häufig durch sogenannte<br />
Skelettmetastasen verursacht, also regionale<br />
Absiedlungen der Krebserkrankung in<br />
den Knochenstrukturen der Wirbelsäule.<br />
Dadurch beginnt sich die Knochengrundstruktur<br />
der Wirbelkörper aufzulösen. Das<br />
kann neben Schmerzen auch dazu führen,<br />
dass sich die Form der Wirbelsäule<br />
verändert. Zudem beeinträchtigt eine zunehmend<br />
aufgelöste Knochenstruktur naturgemäß<br />
auch die Stabilitätsfunktion der<br />
Wirbelsäule.<br />
DIE SCHMERZEN BEI EINER WIRBEL-<br />
SÄULENMETASTASIERUNG sind häufig<br />
von solch starker Ausprägung, dass<br />
sie trotz Schmerzmitteleinnahme zu einer<br />
sehr deutlichen Einschränkung der<br />
Lebens qualität führen. Mittels Computeroder<br />
Magnetresonanztomografie kann<br />
man herausfinden, ob und wie stark die<br />
Krebserkrankung die Knochenstrukturen<br />
der Wirbelsäule zerstört hat. Leider wird<br />
bei Krebsbefall der Wirbelsäule oft entschieden,<br />
dass die Patienten eine Bett ruhe<br />
einhalten sollten, um bewegungsabhängige<br />
Schmerzen, aber auch ein Einbrechen<br />
der befallenen Wirbel mit etwaigen neurologischen<br />
Ausfällen zu vermeiden. Diese<br />
Vorsichtsmaßnahme ist heute allerdings<br />
nur bedingt empfehlenswert, da sie mit einer<br />
weiteren Verschlechterung der Lebensqualität<br />
verbunden ist, ohne die Schmerzen<br />
grundlegend zu verbessern.<br />
IN SOLCHEN SITUATIONEN KANN DIE<br />
NEUARTIGE METHODE der sogenannten<br />
Radiofrequenzablation den Patienten<br />
schnell und ohne großen Aufwand zu einer<br />
deutlichen Verbesserung der Lebensqualität<br />
verhelfen. Unter Radiofrequenzabla tion<br />
ist die Hitzezerstörung des Tumor befalls<br />
zu verstehen (Abbildung). Die Daten, die<br />
in den letzten Jahren zur Überprüfung<br />
des Behandlungs erfolgs dieser Methode<br />
erhoben wurden, haben gezeigt, dass<br />
diese Eingriffe sehr sicher, hilfreich und<br />
gut verträglich sind. Daher schlagen neue,<br />
internationale Behandlungsleitlinien nun<br />
vor, eine solche Radiofrequenzablation<br />
bei schmerzhaften Wirbelsäulenmetastasen<br />
zu einer schnellen und andauernden<br />
Schmerzlinderung einzusetzen. Zumeist<br />
ist infolge der Schmerzreduktion bereits<br />
direkt nach dem Eingriff eine bessere<br />
Beweglichkeit möglich. Wird die Radiofrequenzablation<br />
mit der Einspritzung von<br />
Knochenzement in den befallenen Wirbel<br />
kombiniert, lässt sich zudem die Stabilität<br />
der Wirbelsäule verbessern und das Risiko<br />
einer Rückenmarkschädigung durch ein<br />
Zusammenbrechen des tumorbefallenen<br />
Wirbels reduzieren.<br />
DIESER MINIMALINVASIVE EINGRIFF<br />
zur zielgerichteten Zerstörung der oft<br />
knotig befallenen Regionen in den einzelnen<br />
Wirbeln wird seit <strong>2019</strong> in der Neurochirurgischen<br />
Klinik der Universitätsmedizin<br />
Göttingen als einzigem Zentrum<br />
in Südniedersachsen und Nordhessen<br />
durchgeführt.<br />
KONTAKT<br />
Klinik für Neurochirurgie<br />
Universitätsmedizin Göttingen<br />
Prof. Dr. med. V. Rohde<br />
RobertKochStraße 40<br />
37075 Göttingen<br />
Tel. 0551 3966033<br />
nchisekr@med.uni-goettingen.de<br />
www.neurochirurgie-uni-goettingen.de
Schwarmintelligenz<br />
Moderne Medizin braucht Neugier, Forschergene, Teamgeist.<br />
Wo viele denken, kommt viel heraus.<br />
Universitäre Medizin in Göttingen ist innovativ.<br />
Hightech-Medizin, modernste Labore, genaueste Bildgebung,<br />
internationale Forschungsverbünde.<br />
Und Menschen, die das alles können.<br />
Dafür sind wir da.<br />
Universitätsmedizin Göttingen, Georg-August-Universität<br />
Robert-Koch-Straße 40, 37075 Göttingen, Telefon 05 51 / 39 - 0<br />
www.universitaetsmedizin-goettingen.de