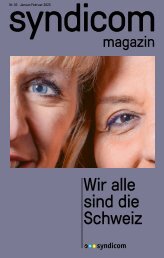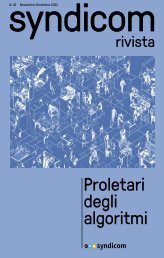syndicom magazin Nr. 16
Das syndicom-Magazin bietet Informationen aus Gewerkschaft und Politik: Die Zeitschrift beleuchtet Hintergründe, ordnet ein und hat auch Platz für Kultur und Unterhaltendes. Das Magazin pflegt den Dialog über Social Media und informiert über die wichtigsten Dienstleistungen, Veranstaltungen und Bildungsangebote der Gewerkschaft und nahestehender Organisationen.
Das syndicom-Magazin bietet Informationen aus Gewerkschaft und Politik: Die Zeitschrift beleuchtet Hintergründe, ordnet ein und hat auch Platz für Kultur und Unterhaltendes. Das Magazin pflegt den Dialog über Social Media und informiert über die wichtigsten Dienstleistungen, Veranstaltungen und Bildungsangebote der Gewerkschaft und nahestehender Organisationen.
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
<strong>syndicom</strong><br />
<strong>Nr</strong>. <strong>16</strong> April–Mai 2020<br />
<strong>magazin</strong><br />
Arbeiten<br />
im Zeichen<br />
von<br />
Covid-19
Anzeige<br />
Schenken Sie Kindern<br />
Zukunftsperspektiven<br />
und tragen Sie zum Aufbau einer gerechteren Welt bei!<br />
Möchten Sie Comundo-Fachperson werden oder mit Ihrer<br />
Spende ein Projekt finanzieren? Kontaktieren Sie uns!<br />
Spenden aus der Schweiz<br />
PostFinance, PC 60-394-4<br />
IBAN CH53 0900 0000 6000 0394 4<br />
Spenden aus Deutschland<br />
IBAN DE14 6001 0070 0011 5877 00<br />
Comundo<br />
im RomeroHaus, Kreuzbuchstrasse 44<br />
CH-6006 Luzern | Tel. +41 58 854 12 13<br />
spenden@comundo.org<br />
comundo.org/spenden<br />
Fachleute im Entwicklungseinsatz
Inhalt<br />
4 Teamporträt<br />
5 Kurz und bündig<br />
6 Die andere Seite<br />
7 Gastautorin<br />
8 Dossier: Arbeit in Zeiten<br />
von Corona<br />
<strong>16</strong> Arbeitswelt<br />
21 Logistik: Neue GAV<br />
22 Home-Office regulieren<br />
25 Recht so!<br />
26 Freizeit<br />
27 1000 Worte<br />
28 Bisch im Bild<br />
30 Aus dem Leben von ...<br />
31 Kreuzworträtsel<br />
32 Inter-aktiv<br />
Eine neoliberale Pandemie<br />
Die rasante weltweite Ausbreitung von Covid-19<br />
ist nicht nur der Globalisierung zuzuschreiben.<br />
Schwerer wiegt, dass die westlichen Staaten<br />
ihre Fürsorgepflicht gegenüber der Bevölkerung<br />
nicht wahrnehmen. Sie wurde dem Primat der<br />
Wirtschaft untergeordnet. Obschon Pandemien<br />
in allen Regierungsszenarien stehen, ist heute<br />
die Gesundheitsversorgung überfordert. Das ist<br />
die direkte Folge des neoliberalen Abbaus des<br />
Service public.<br />
Um die Wirtschaft am Laufen zu halten,<br />
haben manche Regierungen lange mit Massnahmen<br />
gewartet – und damit eine hohe Zahl<br />
von Opfern in Kauf genommen. Auch wirtschaftlich<br />
und sozial haben sie damit die Folgen<br />
erst recht verschlimmert. Nun musste vielerorts<br />
der Notstand ausgerufen werden, starke<br />
Teile der Wirtschaft stehen still.<br />
Vierzig Jahre Neoliberalismus haben zu einem<br />
kollektiven Versagen der Politik geführt. Privatisierung<br />
des Gesundheitswesens, Reduktion der<br />
Intensiv- und Notfallinfrastruktur zugunsten<br />
von VIP-Abteilungen, Auslagerung der Produktion<br />
medizintechnischer Geräte, von Schutzausrüstungen<br />
und Pharmawirkstoffen nach Asien,<br />
verhaltene Investitionen in die Telekomnetze,<br />
Reduktion von Pflichtlagern an Medikamenten<br />
und weiteren elementaren Gütern – alles geschah<br />
im Namen eines schlanken Staates.<br />
Daraus können wir nur einen Schluss ziehen:<br />
Die öffentliche Hand muss wieder das Primat<br />
über die Wirtschaft übernehmen. Denn die<br />
nächste Krise kommt bestimmt.<br />
4<br />
8<br />
22<br />
Giorgio Pardini (Mitglied der GL <strong>syndicom</strong>)
4<br />
Teamporträt<br />
«Jetzt bekommen wir eine Gegenleistung<br />
für unsere Flexibilität»<br />
Patrick Pflumm (47 Jahre)<br />
Chauffeur bei PostAuto, <strong>syndicom</strong>-Mitglied<br />
seit sieben Jahren, Präsident der<br />
PeKo der Region Lugano. In den letzten<br />
drei Monaten hat er für <strong>syndicom</strong> ein<br />
«Mapping» des öffentlichen Verkehrs<br />
im Tessin vorgenommen. Dazu hat er<br />
mit möglichst vielen Chauffeurinnen<br />
und Chauffeuren über ihre Arbeitsbedingungen<br />
gesprochen. Patrick ist<br />
auch in der Verhandlungsdelegation<br />
GAV PostAuto 2021.<br />
Giuseppe Magisano (45 Jahre)<br />
Nach der Schule arbeitete er im<br />
Maschinenbau betrieb seiner Familie<br />
in Italien, ab 2010 in der Schweiz: zunächst<br />
im Erdbau, dann im Fahrzeugtransport<br />
im Kanton Graubünden und<br />
schliesslich als Reisebus-Chauffeur.<br />
Ab Dezember 2014 war er als Chauffeur<br />
bei einem PostAuto-Unternehmen<br />
tätig. Heute arbeitet er bei PostAuto.<br />
Giuseppe war zunächst Vertrauensmann<br />
von <strong>syndicom</strong> und ist heute Präsident<br />
der PeKo in Bellinzona.<br />
Text: Giovanni Valerio<br />
Bild: Sandro Mahler<br />
«Die Resultate gelten<br />
schweizweit!»<br />
In den vergangenen Jahren hat Post<br />
Auto die PeKos (oder ersatzweise uns<br />
Chauffeur*innen direkt) zur Unterzeichnung<br />
einer Vereinbarung aufgefordert,<br />
damit der Arbeitgeber uns<br />
noch flexibler als nach Arbeitszeitgesetz<br />
einsetzen konnte. Die Angst<br />
vor einem Stellenverlust hat diese<br />
Vereinbarung zu einer gängigen<br />
Praxis gemacht, obwohl wir genau<br />
wussten, dass sich unsere Arbeitsbedingungen<br />
verschlechterten und<br />
es keine Gegenleistung gab.<br />
Da wir uns kein Gehör verschaffen<br />
konnten und der Einsatz nicht<br />
honoriert wurde, hat die PeKo von<br />
PostAuto in Lugano als Zeichen des<br />
Protestes sogar demissioniert. Sie<br />
wurde dann mit neuen Mitgliedern<br />
schrittweise wieder eingesetzt und<br />
begann eine Zusammenarbeit mit<br />
der PeKo von Bellinzona. Wir haben<br />
mit allen gesprochen und versucht,<br />
ihre Würde als Arbeitnehmende<br />
wiederher zustellen.<br />
Mit Hilfe von <strong>syndicom</strong> haben wir<br />
eine neue Vereinbarung verfasst, in<br />
der auch eine Anerkennung der<br />
Flexibili tät vorgesehen ist. Den Kolleginnen<br />
und Kollegen musste vermittelt<br />
werden, wie wichtig es war,<br />
die Vereinbarung von <strong>syndicom</strong> zu<br />
unterschreiben und für unsere Flexibilität<br />
eine Gegenleistung zu verlangen.<br />
Die Gewerkschaft hat uns die<br />
Rechtsgrundlagen erklärt, bis wir<br />
mit den verschiedenen Artikeln des<br />
GAV und des Arbeitszeit gesetzes<br />
jonglieren konnten.<br />
Trotz anfänglichem Druck hat<br />
der Zusammenhalt des Personals<br />
schweiz weit dazu geführt, dass Post<br />
Auto beschloss, die Ausnahmen für<br />
die Dienste zu verhandeln. Als Gegenleistung<br />
für die Flexibilität konnten<br />
wir eine zusätzliche Ferienwoche<br />
für die Leute bei PostAuto erlangen<br />
und eine Zahlung von 1000 Franken<br />
für die Chauffeur*innen der PU.<br />
Hinzu kommen Entschädigungen<br />
für Dienst ausserhalb des üblichen<br />
Dienstortes und ein Ausgleich für<br />
Pausen ausserhalb des Arbeitsortes.<br />
Die Resultate gelten schweizweit und<br />
haben den Zusammenhalt und das<br />
Bewusstsein der Arbeitnehmenden<br />
gestärkt!<br />
Die PeKo stellen die Anliegen der<br />
Mitarbeiter gegenüber der Geschäftsleitung<br />
klar und sind, wie die Gewerkschaften,<br />
ein wichtiger Katalysator,<br />
um kleine oder auch grosse<br />
Probleme besser zu lösen.
Kurz und<br />
bündig<br />
80 000 Unterschriften für das Spitalpersonal \ Parlament tagt in<br />
Bernexpo \ Fairlog wehrt sich gegen weniger Schutz für die<br />
Chauffeure \ TX Group zahlt keine Dividende für 2020 \ Hilfsfonds<br />
für die Medien jetzt! \ USV appelliert an Staatsrat \<br />
5<br />
80 000 Unterschriften für das<br />
Spitalpersonal<br />
In kurzer Zeit hat die Gewerkschaft<br />
VPOD-SSP in der Deutsch- und Westschweiz<br />
80 000 Unterschriften gesammelt.<br />
Die Petition «Das Spitalpersonal<br />
muss geschützt werden und verdient<br />
eine Gefahrenzulage» will, dass der<br />
Bundesrat seinen Entscheid zur Aussetzung<br />
des Arbeitsgesetzes für das Spitalpersonal<br />
zurücknimmt. Gerade weil<br />
wir uns in einer Notlage befinden, muss<br />
der rechtliche Rahmen der Arbeits- und<br />
Ruhezeiten weiterbestehen. Erfahrungen<br />
aus dem Ausland zeigen, dass sich<br />
das Erkrankungsrisiko für das Pflegepersonal<br />
leider enorm erhöht, wenn es<br />
dem Virus länger ausgesetzt ist.<br />
Parlament tagt in Bernexpo<br />
Ab 4. Mai kommt das Parlament in einer<br />
einwöchigen ausserordentlichen Session<br />
in der Bernexpo zusammen. Aufgrund<br />
der Pandemie kann es nicht im Bundeshaus<br />
tagen. In der ausserordentlichen<br />
Session sollen Kredite in Höhe von 30,7<br />
Milliarden Franken genehmigt werden.<br />
TX zahlt keine Dividende<br />
für das laufende Jahr<br />
Noch nach der Beantragung von Kurzarbeit<br />
hat die TX-Gruppe 37 Millionen an<br />
die Aktionäre ausgeschüttet (s. S. 19).<br />
<strong>syndicom</strong> hatte den Verwaltungsrat aufgefordert,<br />
auf die Dividende 2019 zu<br />
verzichten und diese Mittel zur langfristigen<br />
Sicherung von Arbeitsplätzen und<br />
zur Gewährleistung von Qualitätsjournalismus<br />
einzusetzen. Ohne Ergebnisse.<br />
Während der Jahresversammlung kündigte<br />
Präsident Pietro Supino (Foto) an,<br />
dass «für das laufende Jahr aufgrund<br />
der krisenbedingten negativen Gewinne<br />
keine Dividende erwartet wird». Aber die<br />
Dividenden des letzten Jahres sind bereits<br />
in seiner Tasche.<br />
Chauffeure in prekärer Lage<br />
Fairlog, die Allianz von SEV, <strong>syndicom</strong><br />
und Unia für die Branche Logistik und<br />
Strassengütertransport, ist beunruhigt<br />
über die prekäre Situation der Chauffeurinnen<br />
und Chauffeure nach dem<br />
Beschluss des Bundesrats, die Schutzvorschriften<br />
für die Verkehrsbranche<br />
zu lockern und den Kurier fahrerinnen<br />
und -fahrern Sonntagsarbeit zu verordnen.<br />
Solche Massnahmen ohne<br />
Gegen leistung und ohne Einbezug der<br />
betroffenen Arbeitnehmenden und ihrer<br />
Gewerkschaften sind inakzeptabel.<br />
Ein Hilfsfonds für die Medien<br />
Die Pandemie treibt die Schweizer<br />
Medien in eine der schlimmsten Krisen<br />
ihrer Geschichte, da die Werbeeinnahmen<br />
zusammenbrechen. <strong>syndicom</strong>,<br />
Impressum, SSM und mehrere Organisationen<br />
für den Journalismus verlangen<br />
vom Bund einen Hilfsfonds für die<br />
Medien. Dieser soll die Unterstützung<br />
an die Zustellung der Zeitungen erhöhen<br />
und das Überleben von Druckereien<br />
und Medien aller Art sicherstellen.<br />
Auch die Finanzierung von Recherchen<br />
und Reportagen durch einen Unterstützungsfonds<br />
gehört dazu.<br />
Verschleierte Werbung<br />
Der Presserat hat Tamedia (TX Group)<br />
mehrfach gerügt, da bezahlte Beiträge<br />
von Pro viande, Swiss com, Mazda und<br />
Genève Invest im Tages-Anzeiger und<br />
in der SonntagsZeitung erschienen, die<br />
von der Leserschaft für redaktionelle<br />
Artikel gehalten werden konnten.<br />
Shutdown in der Waadt?<br />
Der Waadtländer Gewerkschaftsbund<br />
USV fordert den Staatsrat auf, die Einstellung<br />
sämtlicher nicht-wesentlichen<br />
wirtschaftlichen Aktivitäten zu beschliessen,<br />
wie es das Tessin bereits<br />
getan hat. Diese Kantone sind am<br />
stärksten von der Epidemie betroffen.<br />
Die Schutzvorschriften gegen die Ausbreitung<br />
des Virus an den Arbeitsplätzen<br />
werden nicht eingehalten.<br />
Agenda<br />
April<br />
ganzer Monat<br />
Musealer Livestream<br />
in die Stube<br />
Das Museum für Kommunikation Bern<br />
macht Online-Führungen: Dienstag bis<br />
Freitag um 13.30 Uhr. So kommt die<br />
Kultur nach Hause in die isolierte Stube<br />
oder ins Home-Office. Das wird nun<br />
per Livestream über die Facebook-<br />
Seite des Museums ausprobiert. Alle<br />
sind eingeladen, aktiv mitzudiskutieren.<br />
ganzer Monat<br />
Kinderkanäle freigeschaltet<br />
Für die Kleinsten unter uns: UPC schaltet<br />
vom 25. März bis 6. Mai 2020 alle<br />
Kinderkanäle frei – und zwar kostenlos.<br />
Die Freischaltung erfolgt automatisch<br />
für alle Digital-TV-Kunden. Die Sender<br />
können neben der UPC TV Box auch mit<br />
älteren Geräten (z. B. Horizon oder Mediabox)<br />
empfangen werden.<br />
Mai<br />
1.<br />
1.-Mai-Demos abgesagt<br />
Unter den aktuellen Umständen müssen<br />
die Demonstrationen und Versammlungen<br />
zum 1. Mai 2020 –<br />
schweizweit über 50 – abgesagt<br />
werden. Dieser historisch beispiellose<br />
Schritt ist schmerzhaft, aber angesichts<br />
der Pandemie unausweichlich,<br />
schreibt der SGB. Alternative Ideen<br />
werden geprüft.<br />
Juni<br />
20.<br />
Delegiertenversammlung<br />
<strong>syndicom</strong><br />
Bierhübeli, Bern<br />
Die jährliche nationale Delegiertenversammlung<br />
von <strong>syndicom</strong> wird sich mit<br />
der Zukunft des Service public in einer<br />
digitalen Gesellschaft sowie mit Ökologie<br />
und Arbeitsbedingungen befassen.<br />
<strong>syndicom</strong>.ch/agenda
6 Die andere<br />
Dr. Hans C. Werner ist seit 2011 Chief Personnel Officer und<br />
Seite<br />
Mitglied der Konzernleitung der Swisscom. Ursprünglich Rektor<br />
eines Wirtschaftsgymnasiums, ging er 1999 zur Swiss Re, wo er<br />
nach mehreren Stationen Head Global Human Resources wurde.<br />
Danach war er bei Schindler, ebenfalls im HR.<br />
1<br />
Ab Sommer 2020 können die Swisscom-Mitarbeitenden<br />
ab 58 ihre<br />
Arbeitszeit reduzieren. Wie läuft das<br />
genau ab?<br />
Das Modell ist für Mitarbeitende ab<br />
58 gedacht, die sich in zwei Jahren<br />
pensionieren lassen möchten, ihre<br />
Arbeitszeit jedoch vorher schrittweise<br />
reduzieren wollen, damit mehr Zeit<br />
für private Dinge bleibt.<br />
2<br />
Welche anderen Beiträge nebst der<br />
AHV-Überbrückungsrente enthält das<br />
Swisscom-Modell?<br />
Swisscom finanziert einen Teil der<br />
finanziellen Auswirkungen der Beschäftigungsgrad-Reduktion,<br />
der sich<br />
je nach gewählter Modellvariante unterschiedlich<br />
zusammensetzt. Bei der<br />
Variante mit Teilpensionierung erfolgt<br />
eine Teilkompensation der Renteneinbusse.<br />
Bei der Variante ohne<br />
Teilpensionierung übernimmt Swisscom<br />
die Pensionskassenbeiträge der<br />
Lohndifferenz sowie eine einmalige<br />
Ausgleichszahlung für die reduzierte<br />
AHV-Überbrückungsrente.<br />
3<br />
Welche Beschäftigungsgarantie gibt<br />
es beim vereinbarten Altersteilzeit-<br />
Modell?<br />
Teilnehmende am Modell profitieren<br />
von einer Beschäftigungsgarantie von<br />
zwei Jahren.<br />
4<br />
Wie viele Mitarbeitende werden nach<br />
Ihren Annahmen daran teilnehmen<br />
oder haben sich schon angemeldet?<br />
Die Anmeldung wird erst ab Frühjahr<br />
möglich sein. Zum jetzigen Zeitpunkt<br />
haben wir keine Anhaltspunkte über<br />
die möglichen Teilnehmerzahlen.<br />
(Red.: <strong>syndicom</strong> schätzt, dass die<br />
Zahl der Angestellten, die profitieren<br />
können, bei ca. 1500 liegt.)<br />
5<br />
In einer Umfrage von <strong>syndicom</strong> bei<br />
Swisscom hatten 41 % der Antwortenden<br />
von 55+ gesagt, dass sie sich aufgrund<br />
des Alters unter Druck fühlen.<br />
Was tun Sie dagegen?<br />
Es ist uns sehr wichtig, auch für Kolleginnen<br />
und Kollegen über 55 Jahre<br />
ein attraktiver Arbeitgeber zu sein.<br />
Gerade bezüglich Drucksituationen<br />
bieten wir neben steigenden Ferientagen<br />
mit zunehmendem Alter auch<br />
verschiedenste Module zum Umgang<br />
mit Stress an, zudem Schulungen, um<br />
die neuen Technologien und Zusammenarbeitsformen<br />
zu erlernen, und<br />
nicht zuletzt auch Standortbestimmungen,<br />
um den weiteren Verlauf<br />
der Karriere aktiv zu planen.<br />
6<br />
Werden Sie das Personal über die<br />
neuen Pensionierungsmöglichkeiten<br />
informieren?<br />
Ja, wir werden die Mitarbeitenden<br />
rechtzeitig und detailliert über die<br />
neuen Formen der Altersteilzeit<br />
informieren und ihnen auch Zeit<br />
einräumen, um sich mit der Entscheidung<br />
auseinanderzusetzen.<br />
Text: Sylvie Fischer<br />
Bild: Swisscom
Gastautorin<br />
Eigentlich könnte man meinen, die<br />
Coronakrise sei ein einziger Glücksfall für den<br />
Journalismus – kaum je war das Informationsbedürfnis<br />
in der Gesellschaft so hoch, selten<br />
veränderte sich die Nachrichtenlage so rasant,<br />
noch nie war ein Thema so ressortübergreifend.<br />
Das Virus interessiert alle, weil es alle treffen<br />
kann. Leider auch die Medien, insbesondere freischaffende<br />
Journalist*innen: Veranstaltungen<br />
werden abgesagt, Recherchereisen auf Eis gelegt,<br />
Gesprächspartner*innen stehen für persönliche<br />
Treffen nicht mehr zur Verfügung, Behörden<br />
oder Einrichtungen sind geschlossen.<br />
Zwar habe ich ein Thema gefunden, das sich<br />
trotz all dem realisieren liesse, doch ein Redaktionsleiter<br />
lehnte meinen Artikelvorschlag ab<br />
mit der Begründung, es wäre zwar interessant,<br />
aber im Moment wollten sie nur Coronathemen.<br />
Gleichzeitig ist es schwierig, einen neuen Aspekt<br />
der Krise zu finden, da sich ohnehin fast<br />
alle Redaktionen hauptsächlich mit Corona befassen.<br />
Mehrere Male dachte ich an einen möglichen<br />
Ansatz, den ich beleuchten könnte, nur<br />
um ihn wenig später in einer Zeitung zu entdecken.<br />
Als freie Medienschaffende nehme ich<br />
an keiner Redaktionssitzung teil und habe somit<br />
keine Einsicht in Diskussionen, Planung, Entscheide.<br />
Hinzu kommt, dass paradoxerweise<br />
trotz des hohen Informationsbedürfnisses die<br />
privaten Medien selbst um das Überleben kämpfen:<br />
Die Werbung bricht grösstenteils weg, das<br />
Pensum muss gekürzt oder gar Kurzarbeit beantragt<br />
werden. Die teilweise steigende Anzahl<br />
Abonnements vermag den Verlust nicht wettzumachen.<br />
Kein Wunder, wird auch mit Aufträgen<br />
an Freie gespart. Ob oder wie hohe Entschädigungen<br />
für den Erwerbsausfall selbständige<br />
Medienschaffende vom Bund erhalten werden,<br />
ist noch unklar. Sicher ist: Die gesamte Branche<br />
wird die Konsequenzen von Corona bitter spüren.<br />
Vielleicht realisiert die Gesellschaft durch<br />
diese Krise aber endlich, wie wichtig qualitativer<br />
Journalismus ist. Und dass er einen Preis hat.<br />
Das Dilemma der<br />
Medienschaffenden<br />
Eva Hirschi (29) ist freie Journalistin<br />
und schreibt für diverse Medien in<br />
der Deutsch- und Westschweiz, hauptsächlich<br />
aus dem Ausland. Zurzeit<br />
steckt die Bernerin aufgrund der<br />
Corona krise in der Schweiz fest.<br />
Sie hat Internationale Beziehungen<br />
sowie Medien und Kommunikation in<br />
Genf und Stockholm studiert und ist<br />
Mitglied der Kommission der freien<br />
Medienschaffenden bei <strong>syndicom</strong>.<br />
7
Grafische Industrie, Buchhandlungen: Kurzarbeit angesagt<br />
Velokuriere: neue Ideen und schwarze Schafe<br />
Post wird mit Paketen überschwemmt<br />
Dünne Zeitungen und kleine Schritte eines grossen Konzerns<br />
Dossier 9<br />
Brot<br />
verdienen<br />
in Zeiten<br />
von Corona
10 Dossier<br />
«Lokal einkaufen, sonst wird die Krise eine<br />
Lizenz zum Gelddrucken für Amazon»<br />
Bei <strong>syndicom</strong> sind alle Branchen von den Corona-Massnahmen<br />
betroffen. Hier erzählen Freischaffende,<br />
Angestellte und Selbständige von<br />
den Veränderungen.<br />
Text: Philippe Wenger<br />
Bilder: Markus Forte<br />
Erhan (Name geändert) sitzt auf dem Balkon und macht<br />
eine Pause – Home-Office, wie so viele in der grafischen<br />
Industrie. Er zieht an einer Zigarette, während er per Video-Chat<br />
sein Dilemma schildert: «Ich habe gestern die<br />
Zusage für den neuen Job gekriegt. Ich weiss aber nicht,<br />
ob ich ihn annehmen soll.» Dieser neue Job ist die eigentlich<br />
lang ersehnte Möglichkeit für Erhan, seine unfairen<br />
Arbeitsbedingungen hinter sich zu lassen. Aber nicht nur<br />
sein jetziger Arbeitgeber hat «wegen Corona» Kurzarbeit<br />
(s. Kasten) beantragt, auch «der Neue» tat dies. In diesem<br />
Umfeld eine neue Stelle anzutreten, ist riskant.<br />
Als der Bundesrat am 13. März die «ausserordentliche<br />
Lage» ausrief, ging ein Ruck durch das Land, als hätte der<br />
Fahrer eines Reisecars scharf gebremst. Um im Bild zu<br />
bleiben: Jene, die ungesichert im Mittelgang Getränke<br />
servierten, flogen sofort auf die Nase; die Nicht-Angeschnallten<br />
mussten sich an der Vorderlehne festhalten,<br />
bei den Angegurteten weiss man noch nicht, was dieser<br />
Gurt an Druckstellen auf dem Körper hinterlassen wird.<br />
In den Branchen von <strong>syndicom</strong> findet man alle Beispiele.<br />
Kurierbranche: Verluste und ganz neue Kundschaft<br />
«Ich gehe zwar wie immer zur Arbeit, aber gleichzeitig stellen<br />
wir gerade unser Geschäftsmodell auf den Kopf», sagt<br />
Marc Herter, Co-Geschäftsleiter der Genossenschaft Velokurier<br />
Winterthur. Die üblichen Botenaufträge von Büro<br />
Was für<br />
Verhältnisse<br />
herrschen,<br />
wenn Corona<br />
vorbei ist?<br />
Die TX-Aktionäre sollen mithelfen<br />
Corona-Erwerbsersatz<br />
Die Massnahmen des Bundesrats zur Eindämmung der Corona-Pandemie<br />
zerrütten die Schweizer Wirtschaft. Im «Kreisschreiben<br />
Corona-Erwerbsersatz» (KS CE) beschreibt das<br />
Bundesamt für Sozialversicherung, wie selbständig Erwerbende<br />
und bestimmte Angestellte an Geld kommen können.<br />
Zentral ist, dass man einen Nachweis für den Ausfall des<br />
Einkommens erbringen muss – das können Flyer, Verträge<br />
oder andere Dokumente sein. Den Antrag muss man bei der<br />
AHV-Ausgleichskasse stellen, bei der man Beiträge bezahlt.<br />
Anspruch haben auch Eltern, die wegen eines Ausfalls der<br />
Fremdbetreuung ihre Kinder selbst betreuen müssen und<br />
deswegen nicht arbeiten können, und Menschen, die in Quarantäne<br />
verbleiben müssen. Die Leistungen des KS CE kommen<br />
nur zum Tragen, wenn nicht anderswo Geld beschafft<br />
werden kann. Dazu gehört auch die erweiterte Kurzarbeit.<br />
Kurzarbeit<br />
Kurzarbeit ist die vorübergehende Reduzierung der Arbeit,<br />
etwa aufgrund einer behördlichen Anweisung wie jetzt. Die<br />
Entschädigung kann von den Unternehmen beantragt werden,<br />
um Arbeitsplätze zu sichern, und wird normalerweise<br />
ebenfalls von den AHV-Ausgleichskassen koordiniert. In manchen<br />
Kantonen übernimmt das aber eine andere Stelle. Das<br />
Antragsverfahren wurde stark vereinfacht. Informationen<br />
dazu finden sich auf der Website des Seco: arbeit.swiss.<br />
In 5 Jahren 230 Millionen Dividende ausgeschüttet<br />
<strong>syndicom</strong> fordert: Die Aktionäre der grossen Firmen sollen bei<br />
der Bewältigung der Krise mithelfen. Stephanie Vonarburg,<br />
Vizepräsidentin von <strong>syndicom</strong>, nennt die TX Group (früher<br />
Tamedia) als Beispiel: Dort wurde – auf Druck von Personal<br />
und <strong>syndicom</strong> – die Kurzarbeit auch für regelmässige Freie<br />
beantragt, und der Lohnausgleich auf 100 % wird bis Juni<br />
vom Konzern übernommen. Zudem verzichtet die Unternehmensleitung<br />
2020 auf ihre Bonus-Zahlungen. Allerdings sei<br />
das nur ein kleiner Schritt für einen Konzern, der in den letzten<br />
fünf Jahren insgesamt über 230 Millionen an Dividenden<br />
ausbezahlt hat. Die Aktionäre seien aufgefordert, auf die Dividenden<br />
der Jahre 2019 und 2020 zu verzichten (passiert ist<br />
dies nur für das laufende Jahr), geplante Sparmassnahmen<br />
sind zu stoppen. Es sei undenkbar, dass der Verlag von einer<br />
höheren Medienförderung profitieren kann, wenn er die Redaktionen<br />
von Bund und Berner Zeitung sowie der Zürcher<br />
Regionalzeitungen und des Tages-Anzeigers noch enger<br />
zusammenführt. <br />
(Ph. W.)<br />
Die Lösung von Basel-Stadt<br />
<strong>syndicom</strong> möchte, dass der Bund sich an der Lösung von<br />
Basel-Stadt ein Beispiel nimmt, um den Selbständigen und<br />
Freischaffenden eine Art Existenz minimum zu geben. Mit<br />
einem Anmeldeformular, das in 30 Minuten ausgefüllt werden<br />
kann, verspricht der Kanton eine Unterstützung, die auch<br />
tatsächlich zum Überleben reicht. Anders als die meisten<br />
anderen Stellen garantiert Basel-Stadt einen Mindestsatz<br />
von 98 Franken pro Tag und beschränkt die Taggelder nicht<br />
auf abgesagte Veranstaltungen. So erhalten Selbständige<br />
mit einem 100-Prozent-Ausfall zumindest knapp 3000 Franken<br />
pro Monat. <br />
(Red.)
«Man muss für<br />
abgesagte Lesungen<br />
Beweise liefern –<br />
die gibt es nicht<br />
und wird es nie geben»<br />
zu Büro sind verschwunden, weil: «niemand arbeitet mehr<br />
im Büro». Dafür entstehen neue Beziehungen zu Floristen<br />
und Apotheken, die ihre Kundschaft neuerdings nach<br />
Hause beliefern. Was das «umgestellte Geschäftsmodell»<br />
für den Umsatz bedeutet, könne man noch nicht abschätzen,<br />
sagt Herter, Arbeit gebe es zumindest genug. Für den<br />
Fall der Fälle habe man sich schon einmal über das Prozedere<br />
informiert, wie Kurzarbeit beantragt werden kann.<br />
Erfreulich sei, dass die Kundschaft Verständnis habe,<br />
dass man kein Bargeld annehme und die Waren im Milchkasten<br />
oder vor der Türe deponiere, statt sie zu übergeben.<br />
«Wir fühlen uns auch nicht zurückgewiesen, wenn<br />
man uns die Türe nicht öffnet, sondern sind froh, wenn<br />
die Kunden sich selbst und uns schützen», sagt Herter.<br />
Die Situation in der Kurierbranche ist nicht überall<br />
gleich. So gebe es Kurierdienste in Genf, deren Umsatz<br />
halbiert wurde, sagt <strong>syndicom</strong>-Zentralsekretär David<br />
Roth. Gleichzeitig hat der Genfer Staatsrat 100 000 Franken<br />
gesprochen, damit Restaurants ihre Menükarten für<br />
Online-Lieferplattformen aufbereiten können. Die einzigen<br />
Plattformen, die sich gemeldet haben, sind Smood<br />
und Foodective. Smood ist ein rotes Tuch für Gewerkschaften:<br />
«Ich kenne keine Kurierfirma, die tiefere Löhne<br />
bezahlt. Smood verweigert sich dem GAV, Angestellte<br />
berich ten von nicht ausbezahlten Spesen, falschen Lohnabrechnungen<br />
oder gesetzeswidrigen Schichtplänen»,<br />
sagt Roth. Die Frage ist: Was für Verhältnisse bestehen,<br />
wenn die Corona-Krise vorbei ist? Verschafft Genf unfairen<br />
Arbeitgebern einen Vorteil für danach? Smood<br />
reagierte nicht auf eine Anfrage. Genf antwortete, noch<br />
seien keine Partnerbetriebe «ausgewählt», und verwies<br />
auf den Gastroverband SCRHG, der das Verfahren leite.<br />
Buchhandlungen: der Wert des lokalen Einkaufens<br />
Ähnliche Fragen hat Nicole Hof vom Basler Bücherladen<br />
Ganzoni: «Jetzt geht es darum, den Leuten den Wert des<br />
lokalen Einkaufens zu vermitteln. Die Krise ist sonst eine<br />
Lizenz zum Gelddrucken für Amazon und Zalando, die<br />
hier keine Steuern bezahlen.» Ganzoni ist Mitglied des wegen<br />
der Corona-Krise gegründeten Vereins Buy-Local.ch,<br />
ein Zusammenschluss von persönlich geführten Unternehmen,<br />
mit guter Beratung und fairen Arbeitsbedingungen.<br />
Kurzarbeit habe man vorsorglich beantragt – wie fast<br />
jeder kleine Buchladen: «Das System ist toll: Man kann<br />
trotz der Anmeldung weiterarbeiten und am Schluss abrechnen,<br />
wie viel Arbeit weggefallen ist.» Das Ganzoni-<br />
Team verarbeitet Bestellungen per Telefon und Mail und<br />
fährt sie mit dem Velo aus oder verschickt sie per Post.<br />
Paketmengen wie vor Weihnachten<br />
Ebendiese Post spürt den Paketzuwachs. «Im Moment verteilen<br />
wir so viel wie zur Vorweihnachtszeit», sagt der Paketzusteller<br />
Beat Haldimann. Am Anfang hätte vieles<br />
noch nicht geklappt: So fehlte wochenlang Desinfektions-
12 Dossier<br />
mittel – eine Rückmeldung, die man auch vom Schalterpersonal<br />
der Post erhält. Mittlerweile hätten sich die<br />
Abläufe aber eingependelt und auch «die Kundschaft respektiert,<br />
dass man Abstand halten muss», sagt Haldimann.<br />
Für die kommenden Wochen müsse man aber «unbedingt<br />
darauf achten, dass die Arbeitsbelastung nicht<br />
weiter steigt. Notfalls durch eine Begrenzung der Zustellmenge<br />
oder indem man mehr Leute einstellt».<br />
Dünnere Zeitungen und sparende Redaktionen<br />
Derweilen werden die Zeitungen dünner und die Redaktionen<br />
sparen bei den Ausgaben. Sie greifen bei den Fotos<br />
auf Archivmaterial zurück und die Freien erhalten weniger<br />
Schreibaufträge. Die Baselbieterin Barbara Saladin ist<br />
genau so eine freie Journalistin, die normalerweise von –<br />
nun abgesagten – Veranstaltungen berichtet oder Porträts<br />
schreibt. Und als Buchautorin trifft die Situation gleich<br />
mehrere ihrer beruflichen Standbeine. «Das Problem bei<br />
der Bundeshilfe ist, dass man die ausgefallenen Veranstaltungen<br />
zum Beispiel mit Flyern beweisen muss. Mehrere<br />
Lesungen im Mai sind bereits abgesagt. Dafür gibt es<br />
keine Flyer, die ich als Beweismaterial einreichen könnte<br />
– und wird es natürlich auch nie geben», sagt Saladin,<br />
und fügt an: «Die Wirtschaft ist nicht so schön kategorisiert,<br />
wie man sich das am Anfang der Krise vielleicht vorgestellt<br />
hat.»<br />
Fotostrecke<br />
Der Zürcher Fotograf Markus Forte sagt zur Reportage: «Das<br />
Coronavirus betrifft die Druckerei Stämpfli in Bern, die Buchhandlung<br />
Nievergelt in Zürich Oerlikon und die Schweizerische<br />
Post wirtschaftlich in sehr unterschiedlichem Mass.<br />
In allen von mir dokumentierten Betrieben haben die Verhaltensempfehlungen<br />
und Massnahmen des Bundes zur Eindämmung<br />
der Pandemie aber sehr konkrete Auswirkungen<br />
auf den Arbeitsalltag der Menschen. Abläufe wurden angepasst,<br />
umgestellt oder komplett neu aufgebaut, Pausen verbringt<br />
man mit viel Abstand zum Arbeitskollegen, und Oberflächen<br />
werden noch regelmässiger gereinigt als bis anhin.<br />
Berührt hat mich bei den Begegnungen mit den Menschen,<br />
mit welchem Elan und mit welcher Unverdrossenheit sie die<br />
Verrücktheit der Situation trotz allem meistern.»<br />
Nach dem Grundstudium in Ethnologie und Geschichte an der<br />
Universität in Zürich besuchte Markus Forte in Luzern am<br />
Medienausbildungszentrum den Lehrgang Pressefotografie.<br />
Seit 2005 arbeitet er als freischaffender Fotograf für Kunden<br />
aus dem Medien- und Kommunikationsbereich.<br />
Das Dossier zum Thema:<br />
<strong>syndicom</strong>.ch/coronavirus
Dossier<br />
Das Corona-Virus ist neoliberal<br />
13<br />
Hinter Shutdown und Wirtschaftskrise<br />
tritt jetzt eine andere, noch mächtigere<br />
Krise hervor.<br />
Text: Oliver Fahrni<br />
Bilder: Markus Forte<br />
Er hat auf die globale Corona-Seuche spekuliert. Am<br />
20. März war der amerikanische Hedgefonds-Manager<br />
Bill Ackman damit um 2,6 Milliarden Dollar reicher. Das<br />
entspricht dem Monatslohn von 1 200 000 US-Pöstlern.<br />
Wenn sie denn noch Arbeit hätten. Im Raubtierkapitalismus<br />
trifft eine Epidemie nicht alle gleich.<br />
Wir wissen von Ackman, weil er mit seinem Gewinn<br />
geprotzt hat. Doch viele andere Banker und Spekulanten,<br />
auch in der Schweiz, haben es ihm gleichgetan. Das zeigen<br />
die Finanzmarktstatistiken, Rubrik «Kreditderivate». Mit<br />
Massensterben, Seuchen und wirtschaftlichen Zusammenbrüchen<br />
lässt sich 2020 fettes Geld machen.<br />
Derweil sterben Pfleger und Ärztinnen, Lieferboten<br />
und Polizistinnen, Reinigungsleute, Verkäuferinnen und<br />
Industriearbeiter, weil sie schlecht geschützt gegen Corona<br />
kämpfen oder die Bevölkerung versorgen müssen. In<br />
New York, Bergamo, Lille, Zürich. Überall fehlen Masken,<br />
Beatmungsgeräte, Tests, Intensivpflege-Betten, Schutzkleidung.<br />
Und medizinisches Personal. Ende März wurden<br />
sogar Schmerz- und Anästhesiemittel knapp. Nun<br />
wird in Triage-Zelten vor Krankenhäusern entschieden,<br />
wessen Leben eine Behandlung lohnt. In den armen Quartieren<br />
von Marseille, immerhin die zweitgrösste Stadt der<br />
fünften Volkswirtschaft der Welt, ist eine kleine Hungersnot<br />
ausgebrochen: Weil die Schulkantinen geschlossen<br />
bleiben, kommen viele Kinder nicht mehr zu ihrer einzigen<br />
warmen Mahlzeit täglich.<br />
Wegschauen funktioniert nicht mehr. Die Lage in Gefängnissen,<br />
Altersheimen und Flüchtlingslagern mögen<br />
viele weiter ignorieren. Aber spätestens seit jene Kolonne<br />
von Militärlastwagen in der Nacht Särge aus Bergamo<br />
heraus fuhr, fühlen sich alle in Gefahr.<br />
Covid-19 öffnet uns die Augen. Heute ist für alle einsehbar,<br />
klarer noch als in der Krise 2007/08, wie mörderisch<br />
der neoliberale Kapitalismus und neoliberales<br />
Regie ren sind. Medikamente, Tests und Beatmungsgeräte<br />
sind knapp, weil die Konzerne «lean» produzieren, wie<br />
Betriebswirtschaftler sagen, also ohne Lagerhaltung.<br />
Manche Mittel und Impfstoffe werden gar nicht mehr hergestellt<br />
– Krebs ist rentabler. Spitalbetten fehlen, weil die<br />
Gesundheitsversorgung, wie der gesamte öffentliche<br />
Dienst, krankgespart, privatisiert und konzentriert wird.<br />
Uns bleibt die Angst vor der Krankheit – und vor der absehbaren<br />
Explosion der Krankenkassenprämien.<br />
Eigentlich wüssten Regierungen, wie man Epidemien<br />
bekämpft. Man hat aus Schweinegrippe, Ebola, Sars etc.<br />
im Prinzip gelernt. Grundregel: Massenweise testen, isolieren,<br />
behandeln. So hätte man auch das Corona-Virus<br />
klein halten können. Doch erstens fehlten die Tests. Und<br />
Mit 10 000 Milliarden<br />
Geldspritze gegen<br />
die Seuche?<br />
zweitens haben die Regierungen viel zu lange gezögert,<br />
weil sie unter dem Druck der Konzerne standen. Ärzte<br />
warnten schon Ende Januar vor Covid-19. Doch Mitte Februar<br />
2020 gab es noch immer täglich 14 Flugverbindungen<br />
von Paris nach Wuhan. Denn dort liegt das Zentrum für<br />
Asien der französischen Autoindustrie. Nur ein Beispiel<br />
unter anderen.<br />
Kommentatoren lesen darin ein «Versagen» der Regierungen.<br />
Der Wahrheit näher kommt, dass Regierende die<br />
Fürsorgepflicht für die Bevölkerungen geringer wägen als<br />
die wirtschaftlichen Interessen. Das ist Teil ihrer neoliberalen<br />
Programmierung. Paradoxerweise hat diese<br />
Unterwerfung der Politik durch die Aktionäre das brutale<br />
Herunterfahren der Wirtschaft und die globale Quarantäne<br />
für 3 Milliarden Menschen erst notwendig gemacht.<br />
So haben die Neoliberalen die grösste Wirtschaftskrise<br />
seit 1929 provoziert. Mit allen politischen und gesellschaftlichen<br />
Verwerfungen, die in den kommenden<br />
Monaten und Jahren die Welt, wie wir sie kennen, erschüttern<br />
werden.<br />
Bis vor ein paar Wochen galt fast weltweit: Es gibt kein<br />
Geld für gar nichts, nicht für die Altersvorsorge, nicht für<br />
die Sozialversicherungen, nicht für den Service public<br />
oder öffentliche Investitionen. Doch nun haben allein<br />
Deutschland, Frankreich und Grossbritannien auf einen<br />
Schlag 1,2 Billionen Euro (1350 Milliarden Franken) für<br />
den Kampf gegen die Folgen des Shutdowns lockergemacht.<br />
Kein Wort mehr von der 3-Prozent-Neuverschul-
14<br />
Dossier<br />
Was wir jetzt bräuchten, wären maximale sanitäre Massnahmen,<br />
Lohngarantie, existenzielle Sicherung für alle und eine starke<br />
öffentliche Hand.<br />
Wieder sollen die<br />
Banken gerettet werden,<br />
Corona machts möglich<br />
dungsgrenze in der EU. Und sie werden, bis dieses Magazin<br />
erscheint, wohl noch stark nachlegen. US-Präsident<br />
Trump schnürte ein Paket mit 2 Billionen Dollar (ausgeschrieben:<br />
2 000 000 000 000 Dollar, etwa 1,9 Billionen<br />
Franken). «Wird nicht reichen», sagt kurzum der Finanzexperte<br />
Mohamed El-Erian (ex-IWF, Chefökonom der<br />
Allianz-Versicherung). Weltweit summierten sich die Rettungsmassnahmen<br />
Ende März auf mehr als 5 Billionen<br />
Dollar. Vorläufig.<br />
Und dabei ist das irrsinnige Geld, das die Zentralbanken<br />
in die Wirtschaft pumpen, noch gar nicht eingerechnet.<br />
Die EZB kündigte innerhalb von zwei Wochen zuerst<br />
125, dann 750, schliesslich 1000 Milliarden Euro an (Stand<br />
29. 3.). Schlicht «alles kaufen» will die US-Notenbank Fed,<br />
also vor allem notleidende Schulden und Wertlospapiere<br />
der Banken. Japans Zentralbank kauft sogar schon Aktien.<br />
Unter dem Strich werden es mindestens noch einmal<br />
5000 Milliarden sein. Zusammen, von Staaten und Zentralbanken:<br />
10 Billionen Dollar. Für den Anfang.<br />
Hier bricht mit ganzer Wucht eine andere Krise durch,<br />
welche die Banken hinter der Corona-Panik zu verstecken<br />
suchten. Sie haben spekulative Papiere in Umlauf gebracht,<br />
die 8,5-mal das Welt-BIP (die gesamte Weltwirtschaftsleistung)<br />
ausmachen. Diese Papiere werden gerade<br />
wertlos. Das System steht schon wieder auf der Kippe.<br />
Und wieder sollen die Banken gerettet werden – Corona<br />
macht es möglich.<br />
Der Schweizer Bundesrat hat per Notrecht 60 Milliarden<br />
Franken bereitgestellt, etwa für Billigkredite an<br />
Unternehmen in Schwierigkeiten. Fast so viel wie für die<br />
Rettung der Grossbank UBS im Oktober 2008. Plus Massnahmen<br />
für die Arbeitslosenversicherung, zusätzliche<br />
Taggelder, erleichterte Kurzarbeit. Etliche Kantone legten<br />
weitere Programme auf.<br />
Das wird als Tat gefeiert, im Namen einer fiktiven nationalen<br />
Einheit gegen den grossen Feind Corona, besonders<br />
das von den Banken angestossene Kreditpaket. Bei<br />
näherem Hinsehen aber tut der Bundesrat zu wenig, zu<br />
spät und das Falsche. Die mächtigen Schweizer Pharmakonzerne<br />
werden nicht dazu verpflichtet, schnell Tests<br />
und Impfstoffe bereitzustellen. Viele Arbeitnehmende,<br />
die weiterarbeiten müssen, sind noch immer schlecht geschützt,<br />
und die Massnahmen werden nicht konsequent<br />
kontrolliert. Ein Viertel der KMU, so lauten konservative<br />
Prognosen, werden nicht überleben, eine enorme Konzentrationswelle<br />
kündigt sich an. Arbeitende mit prekären<br />
Arbeitsverträgen verlieren bereits reihum ihre Jobs.<br />
Hohe Arbeitslosigkeit droht. Das schürt noch mehr Angst.<br />
Und es ist Irrsinn, die Vergabe der Kredite, welche die<br />
öffentliche Hand garantiert, allein den Banken zu überlassen.<br />
Was wir jetzt bräuchten, wären maximale sanitäre<br />
Massnahmen, Lohngarantie, existenzielle Sicherung für<br />
alle und eine starke öffentliche Hand. Denn rechte Politiker,<br />
die Exponenten der Banken und der Unternehmerverbände<br />
drängen darauf, die Bürgerinnen und Bürger<br />
möglichst schnell wieder an den Arbeitsplatz zu zwingen.<br />
Als Kanonenfutter.<br />
Corona funktioniert wie eine Lupe. Das Virus legt die<br />
Brüche des Wirtschaftssystems offen. Es wirft ein Schlaglicht<br />
auf horrende Ungleichheiten. Und es zeigt, wie wichtig<br />
ein gestärkter Service public für das Allgemeininteresse<br />
wäre. Nach Corona kann nicht vor Corona sein.<br />
sgb.ch/corona-virus
Statistiken<br />
in Zeiten der Seuche<br />
Auf dieser Seite bemühen wir uns, in gedrängter statistischer<br />
Form zentrale Fakten eines Themas zu beleuchten. In Zeiten des<br />
Coronavirus richtet sich das Interesse auf die Verbreitung der Lungenkrankheit.<br />
Also die Zahl der Infizierten, der im Krankenhaus<br />
um ihr Leben ringenden und der Opfer. Und der räumlichen<br />
Verbreitung. Zum Redaktionsschluss, Ende März, weisen die USA,<br />
Italien, Spanien und China die höchsten Zahlen der Infizierten auf.<br />
Aber die Realität verändert sich rasch, in der Schweiz beobachteten<br />
wir in der dritten Märzwoche eine rasch um sich greifende<br />
Epidemie. Doch sämtliche Statistiken sind mit äusserster Vorsicht<br />
zu lesen, sie sind lückenhaft, hängen zeitlich hinterher und werden<br />
manchmal aus politischen Gründen gemildert. Die Prognosen<br />
sind kaum zuverlässiger. Eine lautet etwa: In der Schweiz könnten<br />
sich «20 bis 60 Prozent» der Menschen mit dem Virus anstecken.<br />
Eine «Information» mit einer solchen Spanne ist absurd. Wir<br />
erhellen hier einige Grundfakten und Hintergründe der Epidemie.<br />
10<br />
Billionen<br />
Dollar<br />
Das ist die Summe, die bis Ende März von<br />
den Staaten und Zentralbanken bereitgestellt<br />
wurde, um die Folgen einer doppelten Krise<br />
zu meistern: der Corona-Epidemie und des erneuten<br />
globalen Bankencrashs (siehe folgende<br />
Doppelseite). Eine Krise kaschiert eine andere.<br />
Wahrscheinlich wird sie diese riesige Summe in<br />
den nächsten Wochen auf mehr als 20 Billionen<br />
verdoppeln, wenn die Interventionen aller<br />
Zentralbanken mit eingerechnet werden. Das<br />
entspricht fast einem Drittel des Welt-BIP, der<br />
gesamten globalen Wirtschaftsleistung.<br />
Corona ist hoch ansteckend<br />
Das Problem mit dem Faktor 3.<br />
Hoch ansteckend bedeutet: Wenn eine Person<br />
den Virus in sich trägt und sich normal in<br />
der Gesellschaft bewegt, steckt sie im Schnitt<br />
3 Personen an. Jede dieser Personen wiederum<br />
drei andere. Etc. Nach der 10. Weitergabe hat<br />
dieser eine Virusträger Null in kurzer Zeit<br />
59 000 Personen angesteckt. Darum besteht<br />
heute die einzige wirksame Methode darin,<br />
Träger des Virus zu isolieren. Und weil zu<br />
wenig getestet wird und viele Erkrankte nur<br />
leichte Symptome haben, greifen die Behörden<br />
zum Shutdown, zum mehr oder weniger<br />
strengen Ausgangsverbot, resp. zur sozialen<br />
Distanzierung.<br />
Die Epidemie zeitlich strecken<br />
Anzahl der Corona-Fälle<br />
Ohne Schutzmassnahmen<br />
Mit Schutzmassnahmen<br />
Kapazität Gesundheitssystem<br />
Seit dem ersten Fall<br />
Quelle: WHO, Siouxsview<br />
Quelle: CDC / The Economist<br />
Internationaler Flugverkehr<br />
2018 wurden auf 38 Millionen Flügen 4,3 Milliarden<br />
Passagiere befördert.<br />
Die Zentren der Epidemie<br />
Stand: 25. März 2020<br />
Quelle: IATA, 2019<br />
Quelle: WHO
<strong>16</strong><br />
Eine bessere<br />
Arbeitswelt<br />
Etappensieg auf dem Weg<br />
zum Vollzeit-Vertrag<br />
Viele neue PostAuto-Chauffeurinnen und -Chauffeure<br />
in der Romandie werden mit Teilzeitarbeitsverträgen<br />
(80 %) eingestellt, obwohl ihre Arbeitszeit<br />
eigentlich einer 100 %-Stelle entspricht.<br />
So beispielsweise die Kollegen der Region<br />
Waadt-Freiburg (Garagen Sédeilles-Corcelles,<br />
Echallens und Thierrens), die 2019 enorm viele<br />
Überstunden geleistet haben (50 bis 180 Überstunden).<br />
Zuerst hatte PostAuto den Kollegen der<br />
Garage Sédeilles-Corcelles eine Erhöhung des<br />
Beschäftigungs grads um 5 Prozent angeboten<br />
(also einen 85 %-Vertrag). Dies entsprach aber<br />
nicht den tatsächlich regelmässig geleisteten Arbeitsstunden.<br />
Dank der Intervention von <strong>syndicom</strong><br />
und der Solidarität der Kolleginnen und Kollegen,<br />
die sich mobilisiert haben und eine<br />
stärkere Aufstockung forderten, konnte mit der<br />
Westschweizer PostAuto- Direktion ein Gespräch<br />
geführt werden.<br />
Ergebnis: Die Verträge wurden um 10 Prozent<br />
auf 90 Prozent angehoben. Zudem wurden mit der<br />
Direktion zwei weitere Gespräche vereinbart, um<br />
über eine zusätzliche Aufstockung zu diskutieren.<br />
Dies ist nur ein Etappensieg auf dem Weg zu<br />
einem 100 %-Vertrag. Er zeigt aber beispielhaft,<br />
wie Verbesserungen erzielt werden können, wenn<br />
wir gemeinsam handeln.<br />
Dominique Gigon<br />
Die Postautofahrer von Sédeilles-Corcelles haben schon mal erreicht, dass ihre<br />
Beschäftigungsgrade auf 90 Prozent angehoben wurden. (© Daniel Terrapon)<br />
Home-Office ist jetzt<br />
salonfähig<br />
Franz Schori, Zentralsekretär ICT<br />
<strong>syndicom</strong> fordert seit Jahren, dass die<br />
Arbeitgeber den Angestellten in einem<br />
geregelten Rahmen Home-Office<br />
ermöglichen sollen. Die Swisscom<br />
ging noch einen Schritt weiter, sie reduzierte<br />
die Büroflächen und prägte<br />
den Begriff Mobile-Office: arbeiten,<br />
wo man gerade ist, sei es im Zug, im<br />
Bergrestaurant, daheim oder im Büro.<br />
Bei vielen anderen Arbeitgebern<br />
hingegen geisterten vor der Corona-<br />
Krise noch altbackene Haltungen herum.<br />
So galt nur die physische Präsenz<br />
vor Ort als Arbeit, Home-Office war<br />
verpönt und für viele nicht erlaubt.<br />
Die Krise hat nun die alten Geister<br />
vertrieben; viele haben neue Tools erlernt,<br />
auch Vorgesetzte. Vor allem<br />
haben sie gelernt, den Mitarbeitenden<br />
auch dann zu vertrauen, wenn sie im<br />
Home-Office arbeiten. Deshalb bin<br />
ich überzeugt davon, dass die Krise<br />
dem Home-Office zum Durchbruch<br />
verhilft.<br />
Durch die langjährige Erfahrung<br />
mit dem Thema kennen wir aber auch<br />
die Nachteile, vorab die fehlenden informellen<br />
Kontakte und Informationen,<br />
die Gefahren der Entgrenzung<br />
der Arbeit. Deshalb sollten wöchentliche<br />
Präsenztage sichergestellt und<br />
ein Recht auf Nicht-Erreichbarkeit<br />
festgelegt werden. Um diese Forderung<br />
werden alle froh sein, die jetzt<br />
zum ersten Mal den Home-Office-<br />
Koller bekommen.
«Es gibt ein Problem mit der Informationsvielfalt,<br />
der Meinungsfreiheit und der Gewerkschaftsfreiheit.» Nicola Morellato<br />
17<br />
<strong>syndicom</strong> gründet Komitee für<br />
unabhängigen Journalismus<br />
Die Entlassung eines gewerkschaftlich tätigen Redaktors des<br />
Corriere del Ticino ist nur der jüngste umstrittene Vorfall im<br />
Tessin. Um ihre Funktion wahrnehmen zu können, braucht die<br />
Presse den Schutz für Journalist*innen durch einen Gesamtarbeitsvertrag<br />
und Unter stützung von der Politik.<br />
2018 ging das Giornale del Popolo in<br />
Konkurs, gefolgt von der Entlassung<br />
von etwa einem Dutzend Tessiner Arbeitnehmern<br />
im letzten Jahr. Das Bröckeln<br />
der RSI, mit Personalabbau und<br />
Vorpensionierungen ohne Ersatz der<br />
ausscheidenden Mitarbeiter, die Krise<br />
auf dem Inseratemarkt, die alle Zeitungen<br />
betrifft: Die Lage der Medien<br />
wird auch in der italienischen Schweiz<br />
immer schwieriger. Es besteht Sorge<br />
um die Beschäftigten in der Branche,<br />
aber auch um das Wohlergehen der<br />
Demokratie, die wesentliche und verlässliche<br />
Stimmen verliert, während<br />
Fake News blühen (wie jüngst wieder<br />
zum Thema Coronavirus).<br />
Für die Arbeitnehmer war der letzte<br />
Affront die Entlassung eines Redaktors<br />
des Corriere del Ticino wegen ...<br />
eines Kinderliedes!<br />
Wegen eines Reims gefeuert<br />
Um seine Versetzung in ein anderes<br />
Ressort der Zeitung anzukündigen,<br />
verabschiedete sich der Leiter von<br />
Extra sette (die wöchentliche Kulturbeilage<br />
der Zeitung) von den Leser*innen<br />
mit einem Reim. Was der Leitung<br />
des Corriere del Ticino offensichtlich<br />
nicht gefiel. Ohne sich auch nur auf<br />
Die CdT-Gruppe kontrolliert einen Fernseh- und einen Radiosender, mehrere Zeitungen<br />
(Papier und online) und besitzt ein Druckzentrum. (© Sandro Mahler)<br />
ein klärendes Gespräch einzulassen,<br />
schickte sie die Kündigung an den<br />
verantwortlichen Redaktor der Zeitschrift<br />
– der 58 Jahre alt ist, zwei Kinder<br />
im Schulalter hat und seit 24 Jahren<br />
für das Unternehmen arbeitet.<br />
Leider ist diese Haltung für den Corriere<br />
del Ticino nicht neu. Im letzten<br />
Jahr hatte das Unternehmen bereits<br />
junge Mütter, Väter und Mitarbeitende<br />
mit gesundheitlichen Problemen<br />
nach Hause geschickt, ohne auch nur<br />
einen Dialog mit dem Personal und<br />
den Gewerkschaften zu suchen. Obendrein<br />
waren vor und sogar nach den<br />
Entlassungen neue Mitarbeitende<br />
eingestellt worden.<br />
Im Fall des Chefredaktors von<br />
Extra sette wird die Entlassung als null<br />
und nichtig betrachtet, da sie zu einem<br />
unangemessenen Zeitpunkt ausgesprochen<br />
wurde. Zudem sind die<br />
von der Unternehmensleitung angegebenen<br />
Gründe unwahr und unbegründet,<br />
wie <strong>syndicom</strong> in einer Mitteilung<br />
an die Beschäftigten des CdT<br />
erklärte. Diese erhielten sogar die<br />
Nachricht von der Entlassung des Kollegen,<br />
bevor sie ihm selbst mitgeteilt<br />
worden war. <strong>syndicom</strong> hat bei mehreren<br />
Gelegenheiten wiederholt nach einer<br />
Lösung mit der Geschäftsleitung<br />
gesucht, sah sich aber mit einer totalen<br />
Abschottung seitens der Direktion<br />
konfrontiert.<br />
Die Spitze des Eisbergs<br />
Der Fall des Kinderliedes hat in der<br />
italienischen Schweiz Aufsehen erregt,<br />
nicht zuletzt, weil der Redaktor<br />
ziemlich bekannt ist, nachdem er jahrelang<br />
als Gewerkschaftsdelegierter<br />
und Leiter der Branche Presse und<br />
elektronische Medien von <strong>syndicom</strong><br />
Ticino gekämpft hat. Offensichtlich<br />
haben die Medien der CdT-Gruppe die<br />
Nachricht in keiner Weise weitergegeben.<br />
Die Geschehnisse bestätigen,<br />
dass es ein Problem mit der Informationsvielfalt,<br />
der Meinungsfreiheit und<br />
der gewerkschaftlichen Freiheit gibt,<br />
Aspekte, die <strong>syndicom</strong> mehrfach angeprangert<br />
hat.<br />
Daher ergreift <strong>syndicom</strong> alle notwendigen<br />
Massnahmen zum Schutz<br />
des Redaktors. Diese Entlassung ist<br />
nur ein Symptom dafür, dass es mit<br />
den Medien den Bach hinuntergeht,<br />
wenn es nun die Manager sind, die<br />
filtern, was veröffentlicht werden soll,<br />
und nicht die professionellen Nachrichtenleute.<br />
Dies ist nur die Spitze eines<br />
Eisbergs, unter der bedeutende<br />
Probleme liegen, die alle, die an eine<br />
wirklich freie und pluralistische Presse<br />
als Säule der Demokratie glauben,<br />
nur beunruhigen können.<br />
Journalismus-Komitee bei <strong>syndicom</strong><br />
Aufgrund der mangelnden Bereitschaft<br />
der Verleger gibt es im Tessin<br />
seit <strong>16</strong> Jahren keinen Gesamtarbeitsvertrag,<br />
der den Informationsfachleuten<br />
nicht nur eine angemessene Vergütung,<br />
sondern auch Würde und<br />
einen besseren Schutz zuerkennen<br />
würde. Sogar die Tessiner Politik, die<br />
sich bisher nur zögerlich mit dem<br />
Thema auseinandergesetzt hat, reagiert<br />
jetzt. Die überparteiliche Bewegung<br />
zur Unterstützung der lokalen<br />
Medien, nach dem Vorbild der Kantone<br />
Waadt und Bern, geht in diese Richtung.<br />
Aber <strong>syndicom</strong> will mehr tun.<br />
Deshalb beabsichtigt die Gewerkschaft,<br />
zur Sensibilisierung der Öffentlichkeit<br />
und zur Beschleunigung<br />
der politischen Agenda ein Komitee<br />
zu lancieren, um einen unabhängigen,<br />
freien und öffentlichkeitswirksamen<br />
Journalismus zu gewährleisten.<br />
Den gibt es nur, wenn die Journalisten<br />
mehr Schutz und bessere Arbeitsbedingungen<br />
geniessen.<br />
Nicola Morellato<br />
Zum Fall der Entlassung wegen eines Reims:<br />
Bit.ly/39gUY9Z
18<br />
Arbeitswelt<br />
«Gleiche Arbeit hat in der Schweiz immer den gleichen Wert,<br />
auch im Druck und in der Grafikbranche.» Michael Moser<br />
Die Flankierenden<br />
weiterdenken<br />
Die Flankierenden Massnahmen<br />
(FlaM) schützen Schweizer Löhne, indem<br />
sie für alle Arbeitenden in der<br />
Michael Moser<br />
Zentralsekretär Medien<br />
Schweiz gleich lange Spiesse schaffen<br />
– egal woher sie kommen oder was für<br />
einen Pass sie besitzen. Die gleiche Arbeit<br />
in der Schweiz hat den gleichen<br />
Wert, egal wer sie ausführt. Das ist<br />
nicht nur richtig, sondern auch wichtig.<br />
Ohne die FlaM würden die Löhne<br />
innert kürzester Zeit auf das Niveau<br />
der Nachbarländer sinken. Dass im<br />
gleichen Zug auch alle Preise, die<br />
Krankenkassenprämien und die Mieten<br />
sinken würden – das glauben wohl<br />
selbst die überzeugtesten Marktgläubigen<br />
nicht ernsthaft.<br />
Dass dies nicht nur Schwarzmalerei<br />
ist, zeigt ein Blick in die Druck- und<br />
die Grafikbranche. Visitenkarten und<br />
Flyer können ohne Probleme im Ausland<br />
gedruckt werden. Unzählige Anbieter<br />
haben mit entsprechenden<br />
Angeboten den Druckmarkt in den<br />
letzten Jahren auf den Kopf gestellt.<br />
In der Folge sind die Marktpreise für<br />
diese Produkte auch in der Schweiz<br />
auf das Niveau des umliegenden Auslandes<br />
gesunken. Mit der Konsequenz,<br />
dass viele Druckereien kaum<br />
noch rentabel produzieren können<br />
und verzweifelt versuchen, bei den<br />
Kosten zu sparen.<br />
Den Preis für die verzerrten Preise<br />
zahlen also die Arbeitenden mit den<br />
sich verschlechternden Arbeitskonditionen<br />
oder der Verlagerung ihres Arbeitsplatzes<br />
ins Ausland. Flankierende<br />
Massnahmen sind also nicht nur<br />
wichtig, sondern sie müssten sogar<br />
noch ausgebaut respektive weiterentwickelt<br />
werden. Nicht nur in der Politik,<br />
sondern auch in unserem Alltag<br />
als Konsumentinnen und Konsumenten.<br />
Poststellen-Kampagne: Jetzt<br />
kommt die entscheidende Runde<br />
Der Abbau der Poststellen seit 2017 hat vielfache Proteste hervorgerufen,<br />
bei <strong>syndicom</strong> und in der Bevölkerung. Mit der kommenden<br />
Revision des Postgesetzes spitzt sich die Lage zu.<br />
Eine der vielen Aktionen gegen den Kahlschlag bei der Post (Mai 2017, Zürich). (© <strong>syndicom</strong>)<br />
In den nächsten 12 Monaten wird das<br />
Postgesetz überarbeitet und die Poststrategie<br />
angepasst. Auch die Lobbyarbeit<br />
von <strong>syndicom</strong> wird gefordert sein.<br />
Wer die Liste der seit 2017 geschlossenen<br />
Poststellen studiert, stellt einen<br />
massiven Abbau fest. Immer stärker<br />
zeigt sich, wie verfehlt diese Strategie<br />
ist. Denn die alternativen Zugangspunkte<br />
können das Angebot nicht aufrechterhalten,<br />
und mit dem Verlust<br />
von Flächenpräsenz drohen der Post<br />
Einbussen am Markt. Die Verantwortlichen<br />
betonen stereotyp, die Anzahl<br />
der Zugangspunkte werde systematisch<br />
erhöht, die Dienstleistungen<br />
würden besser.<br />
Doch kompensiert ein leerer<br />
Schrank in einer Migros-Filiale die<br />
Dienstleistungen einer Poststelle?<br />
Mitnichten. Die Worte werden nicht<br />
wahrer, je öfter man sie wiederholt.<br />
Die Poststellen sind zu, die Öffnungszeiten<br />
reduziert, der Minimal-Service<br />
an einen Quartierladen ausgelagert.<br />
PostNetz hat radikal Tatsachen geschaffen,<br />
die so rasch nicht wieder zu<br />
korrigieren sind.<br />
Mithilfe vieler Mitglieder hat <strong>syndicom</strong><br />
in ihrer wohl bislang grössten<br />
Kampagne versucht Gegensteuer zu<br />
geben. Die Mitglieder harrten Stunden<br />
vor ihren Poststellen aus, um die<br />
Bevölkerung aufzuklären, sie sammelten<br />
Unterschriften in ihrer Gemeinde,<br />
sie engagierten sich in Komitees oder<br />
in Verbandsgremien. So haben sich<br />
grosse Teile der Bevölkerung solidarisiert<br />
mit den Schalter-Angestellten<br />
und auf einer guten Grundversorgung<br />
beharrt. Allein die nationale Unterschriftensammlung<br />
wurde 2019 von<br />
über zehntausend Personen unterstützt.<br />
Und dieses Signal richtet sich<br />
primär ans Parlament in Bern: Die<br />
Schweiz braucht einen hochwertigen<br />
Service public. Sie braucht eine starke<br />
Post mit einem feingliedrigen Poststellennetz.<br />
Post und Politik müssen<br />
die Grundversorgung wieder ins Zentrum<br />
ihrer Entscheide setzen.<br />
Die eidgenössischen Räte bereiten<br />
eine Revision des Postgesetzes vor.<br />
Diese fusst zum grossen Teil auf den<br />
Anstrengungen von <strong>syndicom</strong> und<br />
den zahlreichen Unterschriften. <strong>syndicom</strong><br />
verfolgt zwei Ziele: Erstens, die<br />
Arbeitsplätze müssen gesichert werden.<br />
Zweitens, die Post muss verpflichtet<br />
werden, ihr Poststellennetz<br />
wieder zu stärken und mit neuen Angeboten<br />
auszustatten. Dafür muss der<br />
Bundesrat die Renditeziele reduzieren.<br />
Es muss aufhören, dass die Post<br />
ihre Verluste an PostNetz auslagert<br />
und damit den Abbau rechtfertigt.<br />
Matthias Loosli<br />
<strong>syndicom</strong> zum Jahresergebnis der Post:<br />
Bit.ly/2xcVV6j
«Die Spirale des Lohndumpings wird besonders stark<br />
angetrieben von der öffentlichen Hand.» Daniel Hügli<br />
19<br />
Lohnschutz dank der<br />
Personenfreizügigkeit<br />
Dank den flankierenden Massnahmen zur Personenfreizügigkeit<br />
lässt sich der allgemeinverbindliche GAV der Netzinfrastruktur<br />
umfassend durchsetzen. Das ist auch bitter nötig.<br />
Jede Ähnlichkeit mit realen Ereignissen<br />
und Unternehmen ist purer Zufall:<br />
Aber nehmen wir mal an, ein Schweizer<br />
Unternehmen vergibt einen Auftrag<br />
im Bereich der Netzinfrastruktur<br />
an die Schweizer Tochtergesellschaft<br />
eines ausländischen Unternehmens.<br />
Diese hat jedoch keine eigenen Arbeitnehmenden<br />
in dem Tätigkeitsbereich.<br />
Sie beauftragt deshalb ein anderes<br />
Unternehmen mit der Ausführung der<br />
Arbeiten – wiederum ein Subunternehmen.<br />
Doch auch dieses hat keine auf die<br />
Tätigkeiten spezialisierten Arbeitnehmenden.<br />
Darum werden die Arbeitnehmenden<br />
von einem Unternehmen<br />
ausgeliehen, das auf den Verleih von<br />
Personal spezialisiert ist. Diese Arbeitnehmenden<br />
– zum Beispiel meldepflichtige<br />
Kurzaufenthalter in der<br />
Schweiz – führen schliesslich die Arbeiten<br />
aus.<br />
Nur durch Kontrollen vor Ort kann Lohndumping<br />
aufgedeckt und abgestellt werden. (© <strong>syndicom</strong>)<br />
GAV gilt auch für ausländische<br />
Dienstleister in der Schweiz<br />
Dank dem Gesamtarbeitsvertrag der<br />
Netzinfrastruktur-Branche hat <strong>syndicom</strong><br />
über die Paritätische Kommission<br />
aus Gewerkschafts- und Arbeitgebervertretern<br />
die Möglichkeit, auch<br />
solche Konstrukte auf Einhaltung der<br />
Lohn- und Arbeitsbedingungen zu<br />
kontrollieren. Der Bundesrat hat den<br />
Gesamtarbeitsvertrag per 1. Oktober<br />
2018 allgemeinverbindlich erklärt und<br />
beschliesst auch jede Vertragsanpassung<br />
– wie beispielsweise die von <strong>syndicom</strong><br />
ausgehandelte Erhöhung der<br />
Mindestlöhne. Die Allgemeinverbindlicherklärung<br />
und die ausgebaute<br />
Kontrollkompetenz der Paritätischen<br />
Kommission sowie die wichtige Möglichkeit,<br />
den Gesamtarbeitsvertrag<br />
auch gegenüber ausländischen Dienstleistern<br />
in der Schweiz durchzusetzen:<br />
alle basieren auf den Flankierenden<br />
Massnahmen im Rahmen der Personenfreizügigkeit.<br />
Personenfreizügigkeit<br />
bedeutet also mehr Lohnschutz<br />
für alle, die in der Schweiz arbeiten.<br />
Wer bezahlt den Preis?<br />
Und dieser Lohnschutz dank ausgebauter<br />
Kontrollen ist auch bitter nötig.<br />
Denn in dem fiktiven Beispiel wird<br />
der Preis, der für die Arbeitserledigung<br />
bezahlt wird, in dieser Kette der<br />
Subunternehmen von Kettenglied zu<br />
Kettenglied immer tiefer. Und am<br />
Ende der Kette stehen die Arbeitnehmenden,<br />
die nicht selten von Unternehmen<br />
durch Lohn- und Sozialdumping<br />
ausgebeutet werden.<br />
Diese Lohndumping-Spirale wird<br />
besonders von der öffentlichen Hand<br />
und ihren Betrieben angetrieben. Dahinter<br />
steckt nur allzu oft die bürgerliche<br />
Ideologie der ständigen Kostensenkung,<br />
die schliesslich kriminelle<br />
Konstrukte begünstigt – auf Kosten<br />
der Arbeitnehmenden und eines starken<br />
Service public für die Bevölkerung.<br />
Der Lohnschutz muss deshalb<br />
nicht nur in den Branchen und Unternehmen,<br />
sondern auch in der Politik<br />
immer wieder erkämpft werden.<br />
Daniel Hügli<br />
Ein Beispiel für Kapitalismus<br />
in Reinform!<br />
Am 10. März veröffentlichte Tamedia<br />
(jetzt TX Group) den Jahresabschluss<br />
2019. Vom ausgewiesenen Gewinn<br />
von 98 Millionen werden 37 Mio. an<br />
Angelo Zanetti, Zentralsekretär Sektor Medien<br />
die Anteilseigner ausgeschüttet. Ein<br />
Blick auf die letzten 10 Jahre zeigt eine<br />
Entwicklung von 59,5 (2010) auf 47<br />
Millionen in den Jahren 2014, 2015,<br />
20<strong>16</strong>, 2017 und 2018. Ein Anteil von<br />
70 % geht an die Familie Coninx-Supino,<br />
die sich, wie uns scheint, guter Gesundheit<br />
erfreut. Die Bezüge des Verwaltungsrats<br />
(mit dem Vorsitzenden<br />
Pietro Supino und weiteren 7 Mitgliedern)<br />
belaufen sich auf 2,39 Mio. und<br />
lagen seit 2010 nie unter 2,3 Mio. Die<br />
Mitglieder der Unternehmensleitung<br />
(8 Personen) bekommen 8,55 Millionen.<br />
Im Jahr 2010 belief sich dieser Betrag<br />
auf 5,61 Millionen und stieg dann<br />
über die Jahre: 7,57 – 7,95 – 6,67 – 8,23,<br />
–12,46 – 8,97 – 10,19 Mio., auf 8,81 Millionen<br />
im Jahr 2018. Ganze acht Personen<br />
haben sich dieses Sümmchen einverleibt.<br />
Dagegen mussten die 41<br />
Journalist*innen des Matin für einen<br />
Sozialplan vor Gericht, und die Zeitungsdrucker<br />
müssen ab Januar 2020<br />
eine Lohnkürzung von 1 % in Kauf<br />
nehmen, und 2021 eine weitere von<br />
0,5 %. Und die Liste der Entlassungen<br />
in den letzten zehn Jahren ist lang.<br />
Ausquetschen, abkassieren und wegwerfen<br />
– wohl eine Konstante der TX.<br />
Was wir fordern: Sofortige Rückerstattung<br />
der Lohnkürzung von 1 % in<br />
den Druckzentren, Streichung der<br />
Vereinbarungen, die mit den jeweiligen<br />
Personalkommissionen unter<br />
Ausübung eines enormen Drucks abgeschlossen<br />
wurden bzw. gerade abgeschlossen<br />
werden, und ein Stopp aller<br />
Kürzungen und Sparmassnahmen zulasten<br />
des Personals, Unterzeichnung<br />
der bestehenden Gesamtarbeitsverträge<br />
bzw. Verhandlungen mit den Gewerkschaften,<br />
um fehlende Verträge<br />
abzuschliessen. Zulasten des Personals<br />
Geld zu machen, ist wirklich zu<br />
einfach!<br />
<strong>syndicom</strong>s Appell an die TX-Aktionäre:<br />
Bit.ly/2UObxGb
20 Arbeitswelt<br />
«Eine gesamte Branche wird prekarisiert.<br />
Wie können wir diese Entwicklung stoppen?» Lena Allenspach<br />
94,5 % der Kreativen<br />
rechnen Stunden weg<br />
Eine Umfrage bei 281 selbständigerwerbenden Kreativen zeigt,<br />
dass man den Wert der Arbeit in der Visuellen Kommunikation<br />
wieder auf ein vernünftiges Niveau anheben muss.<br />
Nur schnell ein Logo zeichnen – muss<br />
nichts Grosses sein. Ich hab da schon<br />
mal was gebastelt, schau es dir doch<br />
mal an. Solche Aussagen hören Kreative<br />
oft. Klingt banal, manchmal sogar<br />
nachvollziehbar. Woher sollen Laien<br />
auch wissen, wie viel Zeit eine Grafikerin<br />
braucht, um das Logo für den neuen<br />
Buchclub zu entwerfen? Wie lässt<br />
sich der faire Preis für ein Produkt<br />
erkennen, wenn im Internet lauter<br />
Dumping-Angebote kursieren? Diese<br />
Verzerrung bringt Konsequenzen für<br />
eine gesamte Branche. Insbesondere<br />
für Selbständigerwerbende, denn sie<br />
tragen das gesamte Risiko selbst. Wir<br />
haben deshalb eine Diskussion über<br />
den Wert von selbständiger Arbeit in<br />
der Kreativbranche lanciert.<br />
281 selbständigerwerbende Kreative<br />
haben unsere Umfrage zum Start<br />
dieser Diskussion ausgefüllt. Die Ergebnisse<br />
zeigen klar, dass eine solche<br />
zwingend geführt werden muss. Wir<br />
wollten von ihnen wissen, ob sie Stunden<br />
wegrechnen, um eine günstigere<br />
Offerte stellen zu können, oder ob sie<br />
teilweise auch gratis arbeiten: 94,5 %<br />
rechnen Stunden weg. 89 % haben bereits<br />
gratis gearbeitet, wenn das Budget<br />
aufgebraucht war. 82 % haben bereits<br />
teilweise gratis gearbeitet, weil<br />
der oder die Kund*in ein zu kleines<br />
Budget hatte. 56 % haben bereits komplett<br />
gratis gearbeitet.<br />
Der Wert einer gesamten Branche<br />
Stimmen Aufwand und Ertrag nicht<br />
überein, werden zu niedrige Stundensätze<br />
verrechnet oder nicht alle Stunden<br />
aufgeschrieben – dann hat das<br />
langfristige Auswirkungen, beispielsweise<br />
auf die Altersvorsorge. Auch hier<br />
sind die Resultate aus der Umfrage<br />
klar. Lediglich 10,9 % glauben, dass<br />
ihre Rente im Alter ausreichen wird.<br />
Woher kommt diese Prekarisierung<br />
einer gesamten Branche? Eine<br />
mögliche These ist das Unvermögen<br />
von Kundinnen und Kunden, der geleisteten<br />
Arbeit einen monetären Wert<br />
zu geben, oder sie unterschätzen ihn<br />
schlicht. Dazu leisten Billiganbieter*innen<br />
und Plattformen wie<br />
99designs einen wesentlichen Beitrag.<br />
Auch hier sprechen die Zahlen<br />
der Umfrage Bände: 92,7 % der Befragten<br />
hatten schon das Gefühl, dass<br />
Kunden den monetären Wert ihrer<br />
Arbeit nicht sehen.<br />
Zukunft gestalten, aber wie?<br />
Was zuerst in einer Gruppe von Luzerner<br />
Grafikern im Atelier nach Feierabend<br />
diskutiert wurde, spiegelt sich<br />
in den Antworten von 281 Kreativen<br />
wieder: 94,9 % erachten eine Diskussion<br />
über den Wert selbständiger Arbeit<br />
als notwendig – 88 % finden, dass sich<br />
an den Arbeitsbedingungen in der<br />
Branche etwas ändern muss.<br />
Wie geht es nun weiter mit der<br />
Kampagne Was ist meine Arbeit wert?<br />
Was nun folgt, sind Diskussionsrunden<br />
in verschiedenen Ateliers, das<br />
Zusammenschliessen von Gedanken,<br />
Meinungen und Kräften. Die Sensibilisierung<br />
von Kunden, das Signal an<br />
Politik und Gesellschaft. Gemeinsam<br />
wollen wir den Wert der selbständigen<br />
Arbeit wieder anheben. Weil Lösungen<br />
nur im Kollektiven gefunden werden<br />
können.<br />
Lena Allenspach<br />
Die Kampagne zielt darauf ab, Kunden, Politik und die Gesellschaft zu sensibilisieren. (© <strong>syndicom</strong>)<br />
Infos, Anmeldung für Diskussionsrunden:<br />
was-ist-meine-arbeit-wert.ch<br />
Lohnerhöhungen in<br />
mehreren Branchen<br />
von <strong>syndicom</strong><br />
Ab April erhalten die Arbeitnehmenden<br />
verschiedener Branchen von <strong>syndicom</strong><br />
mehr Lohn. Zu verdanken ist<br />
dies der GAV-Politik.<br />
In dieser turbulenten Zeit gibt es<br />
für die Beschäftigten bei Post und<br />
PostFinance eine gute Nachricht:<br />
Dank den im letzten Jahr abgeschlossenen<br />
Vereinbarungen steigen die<br />
Löhne um 0,8 %. Der Mindestlohn<br />
wird um 200 Franken monatlich auf<br />
50 200 Franken im Jahr angehoben.<br />
Die Erhöhung gilt ab dem April-Lohn.<br />
Ebenfalls ab April erhalten die Post-<br />
Auto-Angestellten eine Lohnerhöhung<br />
von 0,6 % – dies das Ergebnis der<br />
Verhandlungen mit den Sozialpartnern<br />
<strong>syndicom</strong> und Transfair.<br />
Auch für den ICT-Sektor sind Lohnerhöhungen<br />
vorgesehen. Neben den<br />
für UPC und Sunrise bereits bekannt<br />
gegebenen Massnahmen (s. Magazin<br />
<strong>Nr</strong>. 15) steigt die Lohnsumme bei Cablex<br />
um 1,35 %. Für den Grossteil der<br />
Mitarbeitenden erhöht sich der Lohn<br />
um mindestens 0,5 %.<br />
Eine schöne Anerkennung für die<br />
Beschäftigten des öffentlichen Sektors:<br />
Sie haben in diesen Wochen des<br />
Lockdowns unter schwierigen Bedingungen<br />
gewährleistet, dass wesentliche<br />
Dienste für die Bevölkerung wie<br />
Post oder Telekommunikation weiter<br />
funktionieren, während die meisten<br />
Einwohner*innen zur Eindämmung<br />
des Coronavirus zu Hause bleiben<br />
mussten und müssen.<br />
Giovanni Valerio
«Gesamtarbeitsverträge sind eine gewerkschaftliche und<br />
politische Antwort auf den herrschenden Lohndruck.» Matteo Antonini<br />
21<br />
Löhne schützen,<br />
neue GAV<br />
verhandeln in<br />
der Logistik<br />
Was unternehmen die Gewerkschaften<br />
für den Lohnschutz?<br />
Und wo liegen ihre Prioritäten<br />
nach dem Scheitern des<br />
Mindestlohns in der Volksabstimmung?<br />
Dein GAV – deine Zukunft! <strong>syndicom</strong> will neue Gesamtarbeitsverträge schaffen. (© Margareta Sommer)<br />
Es gibt zwei Aktionsrichtungen: Die<br />
eine ist die Einführung von kantonalen<br />
Mindestlöhnen, wie in den Kantonen<br />
Jura, Neuenburg und Tessin geschehen.<br />
In Genf und Basel-Stadt soll<br />
bald darüber abgestimmt werden. Die<br />
andere Stossrichtung ist, die bestehenden<br />
Gesamtarbeitsverträge zu verstärken<br />
und neue zu entwickeln. Neue<br />
GAV werden notwendig durch das Entstehen<br />
neuer Arbeitsformen und Berufe,<br />
Stichwort Clickworking und<br />
Plattformarbeit. Aber auch durch die<br />
wachsende Aufmerksamkeit der Gewerkschaften<br />
in Branchen, in denen<br />
es früher keine GAV gab.<br />
Neue Medien hier, Minijobs da<br />
Von den Gewerkschaften neu «entdeckt»<br />
wurden die Branchen der Angestellten<br />
in sämtlichen Berufen der Informatik<br />
und der neuen Medien. Aber<br />
auch Branchen mit prekären Arbeitsverhältnissen,<br />
mit Minijobs, die auch<br />
in der Schweiz zunehmend verbreitet<br />
sind, rücken in den Fokus. Die Einführung<br />
kantonaler Mindestlöhne kann<br />
zwar einen Einfluss auf die Minijobs<br />
haben. Aber die gut qualifizierten Angestellten<br />
haben davon offensichtlich<br />
nichts.<br />
Gesamtarbeitsverträge sind umfassend<br />
und regeln neben den Löhnen<br />
zentrale Aspekte der Gewerkschaftstätigkeit<br />
wie das Mitwirkungsrecht,<br />
die Sozialleistungen usw. Vor allem<br />
aber schaffen sie, anders als kantonale<br />
Mindestlöhne, sozialpartnerschaftliche<br />
Verbindungen.<br />
Benchmarks für die Post<br />
und Post Finance<br />
<strong>syndicom</strong> verfolgt beides: die Gewerkschaft<br />
entwickelt ihre Gesamtarbeitsverträge<br />
weiter und engagiert sich in<br />
neuen Branchen. Die Ratifizierungen<br />
des GAV Post und des GAV PostFinance<br />
mit erheblichen Verbesserungen<br />
für die Mitarbeitenden sind im Gange.<br />
Bei diesem Ausbau werden die sich<br />
entwickelnden neuen Arbeitsformen<br />
berücksichtigt. Das ist aber nicht alles.<br />
Neue GAV für die qualifizierten Angestellten<br />
sind am Entstehen, und seit<br />
mehreren Monaten arbeiten wir an<br />
der Entwicklung von Benchmarks für<br />
die Minijobs. Allein bei der Post sind<br />
mindestens 10 000 Personen davon<br />
betroffen, davon rund 3000 Personen<br />
unter dem GAV der Branche KEP &<br />
Mail (private Anbieter von Kurier-, Express-,<br />
Paket- und Maildienstleistungen<br />
mit ordentlicher Meldepflicht gemäss<br />
Postverordnung).<br />
Starke Mitwirkung ist ein Mehrwert<br />
In den GAV muss das Mitwirkungsrecht<br />
auf allen Ebenen verstärkt werden.<br />
Durch Mitsprache und Mitbestimmung<br />
können Probleme ans Licht<br />
gebracht und gemeinsam gelöst werden.<br />
Dies ist ein wichtiger Mehrwert,<br />
der für die Ausdehnung der GAV in die<br />
«neuen» Branchen spricht. Deshalb<br />
betrachten wir die GAV-Verhandlung,<br />
mit der die Probleme gemeinsam gelöst<br />
und die Arbeitsbedingungen verbessert<br />
werden können, als zentral.<br />
Die GAV sind eine gewerkschaftliche<br />
und politische Antwort auf den heute<br />
in unserem Land herrschenden Lohndruck.<br />
Matteo Antonini<br />
Zum Genfer Mindestlohn (fr.):<br />
salaireminimum.ch/argumentaire<br />
Selbständige und<br />
Freischaffende –<br />
das neue Prekariat?<br />
«Jetzt muss ein Ruck durch unser Land<br />
gehen», hiess es an der Medienkonferenz<br />
des Bundesrates zu Beginn der<br />
Krise um das Coronavirus. Die für<br />
den Gesundheitsschutz notwendigen<br />
Massnahmen treffen die Arbeitswelt<br />
hart. Und am stärksten trifft es jene,<br />
welche auch vorher schon durch<br />
Sozial versicherungen nicht ausreichend<br />
geschützt wurden.<br />
Eine dieser Berufsgruppen sind<br />
die Selbständigerwerbenden und Freischaffenden<br />
in den Medien- und Kreativbranchen.<br />
Brechen die Aufträge<br />
weg, bleibt das Einkommen aus. Reserven<br />
haben die wenigsten. Dies hat<br />
auch eine Umfrage von <strong>syndicom</strong> zur<br />
Erhebung der momentanen Auftragssituation<br />
bei Selbständigen und Freischaffenden<br />
gezeigt. 10 % der 2500 Befragten<br />
hatten schon in den ersten<br />
zwei Wochen des Stillstandes keine<br />
Reserven mehr, und 50 % können nur<br />
ein bis zwei Monate ohne Erwerb auskommen.<br />
Ja, es muss ein Ruck durch das<br />
Land gehen. Denn die unmittelbare<br />
Unterstützung in dieser Ausnahmesituation<br />
darf nur der erste Schritt<br />
sein. Danach müssen die fehlenden<br />
sozialen Absicherungen, welche durch<br />
diese Krise exemplarisch zum Ausdruck<br />
kommen, endlich Teil der politischen<br />
Agenda von allen sein.<br />
Lena Allenspach<br />
Unsere aktualisierte Info zur Unterstützung<br />
der Freischaffenden: Bit.ly/3bxvB5b
22 Politik<br />
Hinter einem Virus kann sich<br />
ein anderes verbergen ...<br />
Das Home-Office verbreitet sich – oft zu Bedingungen, die von<br />
den Unternehmen diktiert werden. Die Arbeitnehmenden und<br />
Gewerk schaften müssen die rechtlichen und sozialen Begleitumstände<br />
dieser Entwicklung im Auge behalten.<br />
Angst vor einer zweiten Virus welle<br />
oder einer Virusmutation werden<br />
beibehalten wollen?<br />
Das Gleiche gilt für die Wirtschaft:<br />
Auch ihre Massnahmen, die<br />
sich bereits auf Millionen von Arbeitnehmenden<br />
auswirken, werden<br />
nach dem Ausnahmezustand fortbestehen.<br />
Text: Marc Rezzonico<br />
Bild: Burst<br />
Die Schweizer Demokratie – auf<br />
Sparflamme, pausiert oder sistiert –<br />
bekommt die Coronavirus-Krise mit<br />
voller Wucht zu spüren. Die Abstimmungen<br />
vom Mai abgesagt, die parlamentarische<br />
Arbeit offline, keine<br />
politischen Kampagnen, E-Voting<br />
nicht bereit, die gesetzgeberische<br />
Arbeit blockiert. Und dies bis auf<br />
weiteres. Niemand weiss, wie lange<br />
der Krisenzustand anhalten wird.<br />
Vorsicht bei Massenüberwachung<br />
im Namen der Gesundheit<br />
Die demokratische Funktionsweise<br />
unseres Landes ist mit einer Gesundheitskrise<br />
nicht vereinbar.<br />
Deshalb behilft man sich mit Massnahmen<br />
von Fall zu Fall. Auch mit<br />
technologischen: Die Swisscom<br />
etwa meldet den Behörden, wenn<br />
über 20 Handys auf einer Fläche von<br />
100 Quadratmetern sind. Einige dieser<br />
Massnahmen heben Grundfreiheiten<br />
(Versammlungsrecht) und<br />
Grundrechte (Schutz der Privatsphäre)<br />
auf. Im Namen der Gesundheit<br />
sind wir daran, die geografische und<br />
bald auch biometrische Massenüberwachung<br />
hinzunehmen.<br />
In seinen Massnahmen für den<br />
Gesundheitsschutz geht der Staat<br />
Schritt für Schritt vor und spricht<br />
von einem Marathon. Wieso nicht<br />
ein Sprint, um die nötigen Vorkehrungen<br />
zu treffen? Zahlreiche Ärztinnen<br />
und Ärzte fordern rasche<br />
und drastische Massnahmen.<br />
Die Wirtschaft bremst den<br />
Staat. Eine vollständige Ausgangssperre<br />
für die Bevölkerung wie in<br />
Italien würde die Schweiz fast 29<br />
Milliarden Franken monatlich kosten.<br />
Die Wirtschaft versucht aber<br />
nicht nur, den Schaden zu begrenzen.<br />
Sie versucht auch, die sich bietenden<br />
neuen Chancen zu erkennen<br />
und zu nutzen. Sie organisiert sich<br />
neu, legt neue Paradigmen fest.<br />
Die biometrische Überwachung<br />
beispielsweise. Diese erinnert an die<br />
Diskussionen über das elektronische<br />
Patientendossier und die riesigen<br />
wirtschaftlichen Interessen am<br />
Zugang zu den medizinischen Daten<br />
der Bevölkerung. Die Corona-Krise<br />
ist die perfekte Gelegenheit, um die<br />
Liberalisierung dieses Marktes zu<br />
erreichen …<br />
Die jetzt im Namen des Notstands<br />
ergriffenen staatlichen Massnahmen<br />
geben auch deshalb Anlass<br />
zu Besorgnis, weil solche temporären<br />
Massnahmen die leidige Angewohnheit<br />
haben, Ausnahmesituationen<br />
zu überdauern. Wollen wir<br />
wetten, dass die Staaten sie aus<br />
Mogelpackung Home-Office<br />
Home-Office als Allheilmittel. Gewöhnlich<br />
arbeiten nur 10 % der<br />
Schweizer Arbeitnehmenden im<br />
Home-Office (Quelle: BFS, 2018).<br />
Jetzt verbreitet es sich, wobei die<br />
Unternehmen die Bedingungen vorgeben,<br />
ohne gesetzliche Regelung.<br />
Eine solche braucht es aber sofort.<br />
Und nicht vergessen werden dürfen<br />
die übrigen Arbeitnehmenden: Die,<br />
die nicht mehr oder weniger arbeiten,<br />
und die, die in bestimmten<br />
Branchen nun 60-Stunden-Wochen<br />
haben. Das Home-Office beschleunigt<br />
die berufliche Diskriminierung,<br />
nichts anderes.<br />
Unfairer Wettbewerb<br />
Der Online-Handel explodiert, super!<br />
Trotz des vom Bundesrat beschlossenen<br />
Massnahmenpakets in Höhe von<br />
60 Milliarden Franken werden viele<br />
kleine Geschäfte und Selbständige<br />
die Krise nicht überleben. Im Paket<br />
geht es nur um Geld, es ist kein gesetzgeberisches<br />
«Schutz-Paket».<br />
Denkt an die Buchhandlungen. Da<br />
sie als «nicht essenziell» für das Land<br />
betrachtet werden, müssen sie geschlossen<br />
bleiben. Online-Buchbestellungen<br />
laufen nun einfach über<br />
Amazon. Das ist unfairer Wettbewerb.<br />
Wie viel Finanzmacht und<br />
Marktkontrolle werden Amazon und<br />
weitere Online-Riesen dadurch erwerben?<br />
Unter welchen Bedingungen<br />
arbeiten ihre Angestellten angesichts<br />
der Arbeitsüberlastung? Und unter<br />
welchen Bedingungen werden die<br />
Kleinhändler arbeiten, wenn die<br />
Wirtschaft wieder angekurbelt wird?<br />
Während dieses erzwungenen<br />
Stillstands sollten Arbeitnehmende,<br />
Gewerkschaften, Bürgerrechtsorganisationen<br />
alles Interesse haben,<br />
vor allem in rechtlicher und sozialer<br />
Hinsicht und weniger in politischer<br />
Hinsicht sehr gut hinzuschauen und<br />
reaktionsbereit zu sein.<br />
FAQ Corona und Arbeit bei <strong>syndicom</strong>.ch:<br />
Bit.ly/2JrJ42w
Politik<br />
Der Service public ist die Basis<br />
des wirtschaftlichen Lebens<br />
23<br />
Jetzt, da das öffentliche<br />
Leben stark eingeschränkt<br />
ist, zeigt sich die Wichtigkeit<br />
eines starken Service public,<br />
der die Grundversorgung<br />
für die Gesamtbevölkerung<br />
sicherstellt und das wirtschaftliche<br />
Leben so weit wie<br />
möglich aufrechterhält.<br />
Text: Christian Capacoel<br />
Bild: Markus Forte<br />
Wir sind derzeit froh um jedes nicht<br />
zusammengesparte Spitalbett.<br />
Ebenso froh sind wir um die funktionierenden<br />
Poststellen, die Päckliboten<br />
und die Netzbauer, die unsere<br />
Telekommunikationsnetze instand<br />
halten. Auf diese leistungsfähigen<br />
und stabilen Netze sind wir in Zeiten<br />
von Home-Office und Selbstisolation<br />
umso mehr angewiesen.<br />
Dabei wurde noch im Januar<br />
behauptet, ein Drittel der Spitäler<br />
sei überflüssig. Bei den Poststellen<br />
tut sich das Parlament noch immer<br />
schwer, den Schliessungen Einhalt<br />
zu gebieten, und Avenir Suisse fordert<br />
unbeirrt die Privatisierung von<br />
Netzinfrastrukturen.<br />
Die Corona-Krise zeigt deutlich,<br />
dass der Privatisierungs- und<br />
Sparkurs der letzten Jahre in eine<br />
Sackgasse führt. Denn die nächste<br />
Krise kommt bestimmt. Wenn wir<br />
also die jetzige Krise überwunden<br />
haben, müssen wir uns auf die<br />
nächste vorbereiten. Dazu braucht<br />
es eine offensive Politik beim Service<br />
public.<br />
Den Service public wieder<br />
breiter fassen<br />
Studien zeigen, dass ein starker<br />
Service public das Vertrauen in die<br />
Medien erhöht – und die Bereitschaft,<br />
dafür zu zahlen. Die wissenschaftlichen<br />
Befunde, das Allgemeinwissen,<br />
dass das Funktionieren<br />
der Demokratie im Wesentlichen<br />
von den Medien abhängt, und der<br />
offensichtliche Wert verlässlicher<br />
News in Krisensituationen sollten<br />
genügen, den Kurs bei der Medienförderung<br />
zu drehen. Die Medienförderung<br />
muss ganz dem Servicepublic-Gedanken<br />
folgen.<br />
Dazu gehört eine unabhängige,<br />
dreisprachige Nachrichtenagentur –<br />
die heutige Keystone-SDA ist es mit<br />
ihrer Besitzerstruktur nicht – und<br />
eine SRF mit genügend Mitteln, um<br />
ihren Standard für alle Landesteile<br />
aufrechtzuerhalten.<br />
Schluss mit der Privatisierung<br />
Das wäre ein erster Schritt, um dem<br />
Abwehrkampf abzusagen. Gegen die<br />
Privatisierung der Swisscom. Gegen<br />
die Aushöhlung der SDA. Gegen die<br />
Poststellenschliessungen. In einem<br />
offensiven Diskurs müssen wir vielmehr<br />
von Investitionen in das Rückgrat<br />
unserer Gesellschaft, unserer<br />
Wirtschaft sprechen.<br />
Wir müssen den Moment nutzen,<br />
um in den Köpfen der Bevölkerung<br />
und Politik zu verankern, dass<br />
zum Service public mehr gehört als<br />
die Medien, die Poststellen und die<br />
Swisscom. Wie zum Beispiel die Paketsortiererinnen<br />
und Lieferanten,<br />
die im Zeitalter des Onlinehandels<br />
immer unverzichtbarer werden.<br />
Oder die Frühzusteller*innen, die<br />
uns auch jetzt noch die Zeitung<br />
nach Hause bringen. Es gilt aber<br />
auch noch weiter zu denken. Zum<br />
Beispiel der öffentliche Verkehr:<br />
Warum sollen in Zukunft nicht auch<br />
Taxis dazugehören, wenn insbesondere<br />
die ältere Bevölkerung auf<br />
einen individuellen Service angewiesen<br />
ist?<br />
Gesamtarbeitsverträge in allen<br />
Branchen der Grundversorgung<br />
Gerade jetzt rückt die Leistung der<br />
Arbeitnehmenden und der Wert<br />
ihrer Arbeit in den Fokus der Öffentlichkeit.<br />
Viele systemrelevante<br />
Arbeitende leiden unter prekären<br />
Arbeitsbedingungen, weil durch die<br />
Privatisierung und Liberalisierung<br />
der letzten Jahre ein deregulierter<br />
Markt entstanden ist, in dem die sozialpartnerschaftlichen<br />
Errungenschaften<br />
massiv unter Druck stehen.<br />
Und es kommt zu Ungleichbehandlungen:<br />
Während eine Paketbotin<br />
der Post noch gute Arbeitsbedingungen<br />
geniesst, sieht es beim<br />
DPD- oder DHL-Lieferanten deutlich<br />
schlechter aus. Wir müssen deshalb<br />
auf der politischen Ebene erreichen,<br />
dass der Bund in allen<br />
Branchen der Grundversorgung<br />
Gesamtarbeits verträge verordnet.<br />
Nur so erreichen wir die Gleichbehandlung<br />
der Arbeitnehmenden der<br />
Grundversorgung. Der Service public<br />
als Fundament unserer Gesellschaft<br />
verdient unseren Einsatz.<br />
Den Beschäftigten in der Logistik, der Post<br />
und dem öffentlichen Verkehr muss für die<br />
Erbringung essenzieller Dienstleistungen<br />
eine Risikoprämie gewährt werden.<br />
Unterzeichnet die Petition von <strong>syndicom</strong>!<br />
Bit.ly/2UPrADY
24 Politik<br />
Der Staat muss investieren<br />
wie ein Unternehmer<br />
Zum 20-jährigen Bestehen<br />
der Tessiner Associazione per<br />
la difesa del servizio pubblico<br />
hielt Prof. Sergio Rossi von<br />
der Uni Freiburg einen Talk<br />
über die Perspektiven des<br />
Service public in der Schweiz.<br />
Er hofft auf eine Rückkehr zu<br />
den keynesianischen Theorien<br />
und zu einem Staat, der<br />
investiert, um aus der Krise<br />
herauszufinden.<br />
Text: Sergio Rossi<br />
Bild: Omar Cartulano<br />
John Maynard Keynes, einer der<br />
gros sen Ökonomen des 20. Jahrhunderts,<br />
forderte das antizyklische<br />
Eingreifen des Staates in die Konjunktur:<br />
Geht es der Wirtschaft<br />
schlecht, soll der Staat sie unterstützen<br />
und sich nötigenfalls verschulden.<br />
Dies geschah nach der Krise<br />
von 1929. Allerdings vergassen die<br />
Politiker in den folgenden Jahrzehnten,<br />
die öffentlichen Schulden zurückzuzahlen.<br />
Zugunsten ihrer<br />
Wieder wahl verzichteten sie auf<br />
Steuererhöhungen oder Ausgabenkürzungen.<br />
Das gemäss Keynes umgekehrt<br />
proportionale Verhältnis<br />
von Arbeitslosigkeit und Inflation<br />
löste sich deshalb Ende der 70er-<br />
Jahre auf. An die Stelle des Keynesianismus<br />
trat die Theorie Milton<br />
Friedmans.<br />
Die Wirtschaftsfakultäten werden<br />
heute vom neoliberalen Gedankengut<br />
beherrscht: Die «Väter»<br />
des Neoliberalismus bemächtigten<br />
sich zunächst der Hochschulen und<br />
dann der Zentralbanken und Verwaltungsräte.<br />
Die Globalisierung<br />
spielte bei der Schwächung des Service<br />
public nur eine untergeordnete<br />
Rolle, entscheidender war die wirtschaftliche<br />
und finanzielle Deregulierung.<br />
Die Banken wurden zu<br />
Universal banken und traten mit<br />
Versicherungen und Pensionskassen<br />
in Wettbewerb. Dazu kommen<br />
die Interessenkonflikte, die Drehtüren<br />
für Bank kader. Ein Beispiel<br />
von vielen: Vor seiner Zeit als Präsident<br />
der Europäischen Zentralbank<br />
war Mario Draghi bei der US-Investmentbank<br />
Goldman Sachs. Der<br />
Slogan «Gewinne privatisieren, Verluste<br />
verstaatlichen» fasst die Situation<br />
treffend zusammen. Gewinne,<br />
die der Staat mit profitablen Tätigkeiten<br />
erzielte, wurden privatisiert.<br />
Geblieben sind ihm die Verluste.<br />
Und da der Service public nicht<br />
mehr rentierte, wurde er abgebaut.<br />
Staatshandeln aus Manageroptik<br />
In der Schweiz hat sich der gesellschaftliche<br />
Zusammenhalt (zwischen<br />
Einkommensklassen) und die<br />
nationale Kohäsion (zwischen Zentren<br />
und Randregionen) verringert.<br />
Mit der Schwächung des sozialen<br />
Gefüges verroht die Gesellschaft.<br />
Der für die Willensnation Schweiz<br />
typische kooperative Föderalismus<br />
(reiche Kantone helfen den ärmeren)<br />
ist kompetitiv geworden. Dies<br />
zeigt ein Blick auf das Steuersystem.<br />
Ausserdem hat der Staat einen Teil<br />
seiner rentablen Tätigkeiten an bereitwillige<br />
Private ausgelagert und<br />
Leistungen abgebaut (Gesundheit,<br />
Verkehr, Infrastruktur, Bildung).<br />
Der Staat gleicht immer mehr<br />
einem Konzern, effektiv und effizient.<br />
Er soll den Service public möglichst<br />
kostengünstig bereitstellen,<br />
zu Lasten der Qualität. Das ist das<br />
Resultat, wenn Entscheide von öffentlichem<br />
Interesse aus Manageroptik<br />
getroffen werden. Zwischen<br />
Managern und Unternehmern gilt<br />
es zu unterscheiden. Unternehmer<br />
wie Steve Jobs haben zukunftsorientierte,<br />
innovative Ideen. Manager<br />
denken kurzfristig: Sie haben kein<br />
Interesse, in Unternehmen zu investieren,<br />
um deren langfristigen Fortbestand<br />
zu sichern. Die Zahl der<br />
Unter nehmer ist gesunken, die Zahl<br />
der Manager gewachsen. Dies hat zu<br />
einer Schwächung des Schweizer<br />
Wirtschaftsgefüges geführt.<br />
Streiken für Keynes<br />
Greta Thunberg hat uns zum Nachdenken<br />
über den Klimawandel und<br />
die Jungen zum Streiken gebracht.<br />
Nun müssten wir weniger Jungen einen<br />
Streik für den Keynesianismus<br />
organisieren. Wir sollten zurückkehren<br />
zu Keynes’ Idee eines unternehmerischen<br />
Staats, der als wichtiger<br />
Akteur in der Marktwirtschaft<br />
auftritt. Vor kurzem hat meine Kollegin<br />
Mariana Mazzucato, Professorin<br />
in London, das Buch Das Kapital<br />
des Staates publiziert, das sich mit<br />
genau diesem Thema befasst. Die<br />
USA haben öffentliche Gelder in die<br />
Eroberung des Weltraums investiert.<br />
Auch das Internet ist durch öffentliche<br />
Ausgaben – für die Landesverteidigung<br />
– entstanden. Diese<br />
staatlichen Investitionen haben es<br />
den Unternehmen möglich gemacht,<br />
sich mit neuen Produkten<br />
neue Absatzmöglichkeiten und Gewinne<br />
zu erschliessen.<br />
Meine Prognosen sind pessimistisch:<br />
Soziale Spannungen und<br />
die Entfremdung von der Politik<br />
nehmen zu. Auf der anderen Seite<br />
ist eine solidarische Wirtschaft am<br />
Entstehen, in der man sich gegenseitig<br />
hilft. Es fehlt die Rolle des<br />
Staates. Die durch das Coronavirus<br />
ausgelöste Wirtschaftskrise zeigt<br />
erneut, dass die öffentlichen Ausgaben<br />
für die globale Wirtschaftsentwicklung<br />
entscheidend sind.
Recht so!<br />
25<br />
Liebe Rechtsberatung von <strong>syndicom</strong>, ich<br />
arbeite in einem Unternehmen, welches<br />
aufgrund der Corona-Pandemie unter<br />
einem massiven Einbruch der Auftragslage<br />
leidet. Fast jeden Tag kommuniziert die<br />
Geschäftsleitung neue Massnahmen.<br />
Heute wurden für diverse Mitarbeitende<br />
mit Wirkung ab nächster Woche Zwangsferien<br />
verordnet. Darf das Unternehmen<br />
Ferien anordnen?<br />
Die Geschäftsleitung hat zudem kommuniziert,<br />
dass wir sämtliche positiven Zeitsaldi<br />
abbauen müssen. So werden Mitarbeitende<br />
früher nach Hause geschickt bzw. gar nicht<br />
erst eingeplant und die Zeitsaldi nehmen<br />
ab. Einige Mitarbeitende sind deshalb<br />
schon ins Minus geraten.<br />
Unser Arbeitgeber hat mitgeteilt, dass er<br />
die Anmeldung von Kurzarbeit in Betracht<br />
zieht. Was hätte dies für finanzielle Konsequenzen<br />
für uns? Können wir Kurzarbeit<br />
ablehnen?<br />
Antwort des <strong>syndicom</strong>-Rechtsdienstes<br />
Bei der Festlegung der Ferien sind die Bedürfnisse der<br />
Mitarbeitenden stets zu berücksichtigen, der Arbeitgeber<br />
hat aber «das letzte Wort»: Können sich beide Parteien<br />
nicht einigen, so bestimmt der Arbeitgeber den Zeitpunkt<br />
der Ferien. Diese sog. Ferien anordnung muss aber rund<br />
drei Monate vor Beginn der Ferien erfolgen, sodass du die<br />
angeordneten kurzfristigen Zwangsferien nicht akzeptieren<br />
musst. Teile per Mail oder eingeschriebenem Brief<br />
mit, dass du die Ferien nicht akzeptierst und deine Arbeit<br />
anbietest.<br />
Je nach in Frage kommenden Zeit saldi ist die Rechtslage<br />
anders: Die Kompensation von Überzeit setzt zwingend<br />
das Einverständnis der Arbeitnehmenden voraus.<br />
Eine Kompensation kann daher verweigert werden.<br />
Die Kompensation von Überstunden setzt ebenfalls das<br />
Einverständnis der Arbeitnehmenden voraus, wobei –<br />
abweichend zur Überzeit – im Arbeitsvertrag oder GAV<br />
von dieser Regelung abgewichen und dem Arbeitgeber<br />
das Recht verliehen werden kann, Kompensation einseitig<br />
anzuordnen. Enthält dein Arbeitsvertrag oder der anwendbare<br />
GAV eine solche Regelung, muss die Anordnung<br />
hingenommen werden. Die Kompensation von Gleitzeitguthaben<br />
kann ohne eine explizit anderslautende Regelung<br />
im Arbeitsvertrag angeordnet werden.<br />
Keinesfalls zulässig ist, dass ihr aufgrund der schlechten<br />
Auftragslage ins Minus geratet: Der Arbeitgeber trägt<br />
das Unternehmerrisiko und darf es nicht auf die Arbeitnehmenden<br />
abwälzen. Wehrt euch gegen die Massnahmen<br />
und bietet die Arbeit per Mail oder eingeschriebenem<br />
Brief an, wenn der Arbeitgeber euch nicht<br />
vertragsgemäss arbeiten lässt.<br />
Kurzarbeit setzt das schriftliche Einverständnis der Mitarbeitenden<br />
voraus. Durch Kurzarbeit erleiden die Arbeitnehmenden<br />
eine Lohneinbusse von bis zu 20 %. Wie hoch<br />
die Einbusse im konkreten Fall ist, hängt davon ab, in<br />
welchem Ausmass die betroffenen Mitarbeitenden noch<br />
arbeiten können: Bei einer Kurzarbeit von bspw. 50 % werden<br />
die geleisteten Arbeitsstunden zu 100 % durch den<br />
Arbeitgeber entlöhnt, die Ausfallstunden hingegen zu<br />
80 % aus den Versicherungsleistungen (Kurzarbeitsentschädigung).<br />
Der Arbeitnehmer muss demnach bei 50 %<br />
Kurzarbeit eine Lohneinbusse von 10 % des Lohnes hinnehmen.<br />
Wer die Kurzarbeit ablehnt, erhält weiterhin den<br />
vollen Lohn, muss aber damit rechnen, die Kündigung zu<br />
erhalten.<br />
<strong>syndicom</strong>.ch/rechtso
26 Freizeit<br />
Tipps<br />
Lohngleichheit in die Praxis<br />
umsetzen<br />
Ab 1. Juli 2020 tritt das revidierte<br />
Gleichstellungsgesetz in Kraft. Unternehmen<br />
mit mehr als 100 Mitarbeitenden<br />
müssen ihre Löhne auf<br />
Diskriminierung analysieren und<br />
die Analyse formell durch Revisionsstellen<br />
überprüfen lassen. Sie haben<br />
aber auch die Möglichkeit, die<br />
Lohnanalysen sozialpartnerschaftlich<br />
durchzuführen.<br />
Das Bildungsinstitut der Gewerkschaften<br />
Movendo hat diese<br />
Gelegenheit benützt, um einen Kurs<br />
über die Lohngleichheitsanalysen<br />
aufzustellen. Die Teilnehmenden<br />
(Personalkommissionen und Gewerkschaftssekretär*innen)<br />
bekommen<br />
zuerst eine Einführung in die<br />
rechtlichen und wissenschaftlichen<br />
Grundlagen der Lohngleichheit.<br />
Danach gibt es einen anwendungsbezogenen<br />
Teil, damit die Teilnehmenden<br />
kompetent sind für sozialpartnerschaftliche<br />
Lohnanalysen<br />
und diese bei den Arbeitgebern<br />
auch einfordern können.<br />
Dieser Anlass findet am 12. 5. in<br />
Bern, Hotel Ambassador, statt und<br />
kostet 300 Franken. Neben Regula<br />
Bühlmann vom SGB wird Patrizia<br />
Mordini von <strong>syndicom</strong> Argumente<br />
für die sozialpartnerschaftliche<br />
Durchführung der Lohnanalysen<br />
geben.<br />
Andere interessante Kurse haben<br />
ebenfalls noch freie Plätze: z. B.<br />
das Führungsseminar für Präsidien<br />
von Personalvertretungen, vom 13.<br />
bis 15. Mai 2020 in Vitznau, Hotel<br />
Flora Alpina; der Kurs «Mutig handeln<br />
im Betrieb» für den besseren<br />
Umgang mit Vorgesetzten, HR und<br />
Kolleg*innen (5./6. Juni 2020, Solbadhotel<br />
Sigriswil) oder der Kurs<br />
zum Gesundbleiben in stehenden<br />
Berufen (25. Juni 2020, Romero-<br />
Haus, Luzern), mit der Ergonomin<br />
Daniela Biberstein.<br />
Anmeldung: Movendo.ch<br />
Rückfragen: 031 370 00 70<br />
© El Periscopio<br />
Ein Beispiel für den kollektiven<br />
Kampf aus Argentinien<br />
Im März gibt der Verlag Editions de<br />
l’Aire das Buch «Ni fous ni morts»<br />
heraus, die französische und aktualisierte<br />
Übersetzung* eines in den<br />
frühen 2000er-Jahren in Argentinien<br />
publizierten Sammelbands. Er versammelt<br />
die Berichte ehemaliger<br />
politischer Gefangener, die während<br />
der argentinischen Militärdiktatur<br />
von 1974 bis 1979 im<br />
Gefängnis Coronda festgehalten<br />
wurden. Die jungen Männer – mit<br />
unterschiedlichem politischem Hintergrund<br />
und unterschiedlichen<br />
Ideologien, aus allen sozialen<br />
Schichten – kämpften gemeinsam<br />
und mutig für ihre Ideale.<br />
Sergio Ferrari, Journalist und<br />
Co-Präsident des Branchenvorstands<br />
Presse von <strong>syndicom</strong>, ist einer<br />
dieser früheren Häftlinge. Für<br />
ihn trägt dieses Buch nicht nur zur<br />
Aufarbeitung der argentinischen<br />
Diktatur bei, sondern birgt auch<br />
eine universelle Botschaft: «In einem<br />
solch besonderen Moment<br />
in der Geschichte der Menschheit,<br />
nicht nur in Lateinamerika, sondern<br />
auch in Europa, ist es wichtig, vor<br />
allem der jungen Generation den<br />
Wert kollektiver und geeinter Aktionen<br />
in Erinnerung zu rufen.»<br />
«Ni fous ni morts» (weder verrückt<br />
noch tot) heisst das Buch,<br />
weil den Gefangenen im Pavillon 5,<br />
den «Hoffnungslosen», gedroht<br />
wurde, sie würden das Gefängnis<br />
nur tot oder verrückt verlassen. Die<br />
Überlebenden von Coronda aber<br />
sind diesem Schicksal entkommen<br />
und erinnern heute daran, wie wichtig<br />
es ist, aufzubegehren und einig<br />
im Kampf zu sein. Melina Schröter<br />
* Die Übersetzung erscheint ausschliesslich in<br />
französischer Sprache.<br />
«Ni fous, ni morts – Prisonniers politiques<br />
sous la dictature argentine, Coronda 1974–<br />
1979», Editions de l’Aire, März 2020. Interview<br />
mit Sergio Ferrari auf <strong>syndicom</strong>.ch/fr<br />
© Konzernverantwortungsinitiative<br />
Konzerne vor dem Gesetz<br />
«Die Mine hat unsere Zukunft und<br />
unsere Kultur zerstört», erzählen die<br />
Einwohner des Departements La<br />
Guajira in Kolumbien. Dort besitzt<br />
der Konzern Glencore (mit Sitz in<br />
der Schweiz) eine der weltgrössten<br />
Kohleminen. Für den Abbau wurden<br />
die indigenen Gemeinschaften (wie<br />
die Wayuu) zwangsumgesiedelt. Die<br />
Vergiftung des Flusses Ranchería<br />
gefährdet 450 000 Menschen.<br />
Solches Vorgehen ist für diverse<br />
Konzerne gängige Praxis. Der Profit<br />
geht vor, Natur und Arbeiter werden<br />
ausgebeutet. Es gilt das Gesetz des<br />
Geldes, andere Gesetze werden<br />
miss achtet. Deshalb fordert die<br />
Konzernverantwortungs-Initiative,<br />
dass Konzerne mit Sitz in der<br />
Schweiz die internationalen Umweltstandards<br />
respektieren und für<br />
Menschenrechtsverletzungen bestraft<br />
werden. Überall auf der Welt,<br />
dort, wo sie tätig sind.<br />
Der Dokumentarfilm «Der Konzern-Report»<br />
zeigt anhand mehrerer<br />
Beispiele, wie dringend und notwendig<br />
diese Initiative ist. Eines ist<br />
die kolumbianische Mine El Cerrejón.<br />
Schlimme Beispiele, auf die<br />
auch Persönlichkeiten in der<br />
Schweiz und in anderen Ländern<br />
in Appellen hinweisen. Etwa Dick<br />
Marty, der Unternehmer Dietrich<br />
Pestalozzi oder die Präsidentin des<br />
Schweizerischen Katholischen<br />
Frauenbunds, Simone Curau-Aepli.<br />
Es braucht klare Regeln, um die<br />
Konzerne zur Rechenschaft ziehen<br />
zu können. Giovanni Valerio<br />
Die DVD (Fr. 10.–) kann bestellt werden auf:<br />
konzern-initiative.ch
1000 Worte<br />
Ruedi Widmer<br />
27
28 Bisch im Bild Im Februar und März 2020 war <strong>syndicom</strong> aktiv mit den vielen Teilnehmer*innen<br />
des Frauenstreiks vom 8. März, mit den Delegierten von Post, PostFinance und<br />
PostAuto, am Kongress Reclaim Democracy, mit den Jugendlichen und jungen<br />
Erwachsenen der Gewerkschaft und mit den Vertrauensleuten.<br />
1<br />
2<br />
3<br />
4<br />
5
1. Am Frauentag in Bern bildeten Frauen auf dem Bundesplatz das<br />
Symbol der Frau. (© <strong>syndicom</strong>)<br />
2. In Lausanne haben die Frauen am Frauenstreik den Flashmob<br />
«Un violador en tu camino» organisiert. (© Jean-Christophe Bott/keystone-sda.ch)<br />
3. In Lugano lancierte eine Gruppe von Tessiner Frauen für den 8. März<br />
die Initiative #stepupgirls: Auf den Treppen hinauf zum Bahnhof wurde<br />
ein roter Teppich gegen die Lohnungleichheit zwischen Männern und<br />
Frauen ausgelegt. Darauf konnte man sich fotografieren und das Bild in<br />
den sozialen Netzwerken teilen. (© #stepupgirls)<br />
4. Die Kathedrale in Genf trug ein Transparent mit der Aufschrift «Révolution<br />
féministe». (© DR)<br />
5. Die Delegiertenversammlung Post und PostFinance am 14. Februar in<br />
Bern bekundete ihre Unterstützung für den Redaktor, den der Corriere<br />
del Ticino wegen eines ironischen Reims entlassen möchte. (© <strong>syndicom</strong>)<br />
6. An der Delegiertenversammlung vom 28. Februar in Bern weigerten<br />
sich die PostAuto-Chauffeur*innen, in den laufenden GAV-Verhandlungen<br />
Konzessionen zu machen (© <strong>syndicom</strong>)<br />
7. Stephanie Vonarburg, Leiterin Sektor Medien von <strong>syndicom</strong>, diskutierte<br />
am Reclaim-Democracy-Kongress in Zürich über Medienförderung.<br />
(© Marco Geissbühler)<br />
8. Die Interessengruppe Frauen von <strong>syndicom</strong> organisierte am 2. März in<br />
Bern eine Diskussion über sexuelle Gewalt am Arbeitsplatz. (© <strong>syndicom</strong>)<br />
9. Die <strong>syndicom</strong>-Jugend diskutierte über die Weiterbildung in Zeiten<br />
der Digitalisierung. Gestützt darauf formulieren sie einen Antrag an die<br />
Delegiertenversammlung. (© Marcel Lüthy)<br />
10. Am 21./22. Februar fand das Seminar für Vertrauensleute in der<br />
Logistik, Region Zürich/Ostschweiz, statt. (© Marcel Lüthy)<br />
6<br />
7<br />
8<br />
9<br />
10
30<br />
Aus dem<br />
Leben von ...<br />
Henner Knorr: «Die Flankierenden<br />
Massnahmen sind eine gute Sache»<br />
Henner Knorr, 53, geboren in Bremen<br />
(Deutschland), schloss erst sein Studium<br />
als Diplomphysiker ab, bevor er<br />
eher zufällig Webdesigner für eine NGO<br />
in den Niederlanden wurde. In dieser<br />
Zeit engagierte er sich ehrenamtlich<br />
für die Rechte von Migrant*innen.<br />
Nach einem kurzen Abstecher in die<br />
Bildungsbranche hat er erst im Callcenter<br />
gelernt, was es eigentlich<br />
braucht, um ein guter Lehrer zu sein:<br />
zuhören – und Wissen in kleinen Happen<br />
vermitteln. Er lebt in einer kleinen<br />
Stadt im Landkreis Konstanz und nennt<br />
Musik einen festen Teil seines Lebens.<br />
Neben seinem Job im Callcenter bei<br />
der Capita Customer Services AG in<br />
Täger wilen engagiert er sich als Branchenvorstand<br />
Contact- und Callcenter<br />
bei <strong>syndicom</strong>.<br />
Text: Philippe Wenger<br />
Bild: Alexander Egger<br />
Eine gewerkschaftliche<br />
Einstellung ist für mich<br />
selbstverständlich<br />
Im Callcenter gibt es viele, die sagen:<br />
«Ich bin nur temporär hier» – selbst<br />
wenn sie eigentlich eine Festanstellung<br />
haben. Das macht es schwierig,<br />
Leute zu finden, die sich gewerkschaftlich<br />
engagieren.<br />
Dass Engagement aber wichtig<br />
ist, habe ich am eigenen Leib erfahren:<br />
Früher war es in meinem Betrieb<br />
üblich, Kranksein abzustrafen. In<br />
einem für mich besonders bitteren<br />
Fall wurde mir ein Bonus mit dazugehörigem<br />
Stufenanstieg gestrichen,<br />
für den ich zuvor über lange Zeit gute<br />
Leistungen gezeigt hatte. Die Hochstufung<br />
verschob sich um ein halbes<br />
Jahr, und das nur, weil ich in einem<br />
Dezember für zwei Tage ausfiel.<br />
Auf meinen Protest hin – erst bei<br />
meinem Chef und dann bei dessen<br />
Chef – hat man dann eine Lösung<br />
gefunden, aber den Bonus hat man<br />
mir trotzdem nicht ausbezahlt. Weil:<br />
so waren ja die Regeln. Aber solche<br />
Regeln dürfen nicht sein. Ich fühlte<br />
mich beschmutzt und von meinem<br />
Arbeitgeber nicht wertgeschätzt. Da<br />
habe ich gemerkt, dass etwas grundlegend<br />
falsch lief, das die Firma<br />
nicht alleine korrigieren konnte.<br />
Es brauchte die Gewerkschaft.<br />
Seither engagiere ich mich für<br />
bessere Arbeitsbedingungen. Dass<br />
wir 2015 einen GAV aushandeln<br />
konnten, hat einiges verbessert:<br />
So ist Kranksein heute kein Grund<br />
mehr, einen Bonus zu streichen, wir<br />
haben mehr Urlaubstage, und die<br />
paritä tische Kommission wacht über<br />
die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen<br />
– etwa bei den Schichtplänen.<br />
Zwar laufen ein paar Dinge<br />
etwas bürokratischer ab als vorher,<br />
aber dafür fairer.<br />
Für mich sind die Flankierenden<br />
Massnahmen zur Personenfreizügigkeit<br />
eine gute Sache. Wer umgekehrt<br />
zum Beispiel als polnischer Grenzgänger<br />
in Deutschland arbeitet, erhält<br />
manchmal weniger Lohn als die<br />
deutschen Kolleginnen und Kollegen<br />
– das baut einen ungesunden Konkurrenzdruck<br />
in der Belegschaft auf.<br />
In der Schweiz ist das anders: Zwar<br />
verdienen Leute, die nahe der Grenze<br />
wohnen, weniger als jene aus Zürich,<br />
aber es wird nicht nach deiner Nationalität<br />
unterschieden. Den gleichen<br />
Job könnte ich in Deutschland nicht<br />
machen, weil der Lohn viel zu tief<br />
wäre.<br />
Dafür nehme ich auch einen langen<br />
Arbeitsweg von mindestens eineinviertel<br />
Stunden pro Weg in Kauf.<br />
Ich habe immer mein Faltvelo dabei,<br />
mit dem ich über die Grenze radle,<br />
und mein Kornett, ein kleines, trompetenähnliches<br />
Instrument, hilft<br />
mir, Wartezeiten zu überbrücken.<br />
Ich mache meinen Job gerne und<br />
für mich ist eine gewerkschaftliche<br />
Einstellung selbstverständlich. Über<br />
mein Amt im Branchenvorstand hinaus<br />
habe ich aber keine Ambitionen<br />
für eine Gewerkschaftskarriere. Ich<br />
wünschte mir bloss, dass man uns<br />
Milizer etwas mehr in die politischen<br />
Entscheidungen einbezieht. Vielleicht<br />
wird es dann etwas leichter,<br />
die Leute zu aktivieren – auch wenn<br />
es wohl schwierig bleiben wird.<br />
<strong>syndicom</strong>.ch/branchen/ccc
Impressum<br />
Redaktion: Sylvie Fischer, Giovanni Valerio<br />
Tel. 058 817 18 18, redaktion@<strong>syndicom</strong>.ch<br />
Freie Mitarbeit: Rieke Krüger<br />
Porträts, Zeichnungen: Katja Leudolph<br />
Fotos ohne ©Copyright-Vermerk: zVg<br />
Layout und Druck: Stämpfli AG, Bern<br />
Adressänderungen: <strong>syndicom</strong>, Adressverwaltung,<br />
Monbijoustrasse 33, Postfach, 3001 Bern<br />
Tel. 058 817 18 18, Fax 058 817 18 17<br />
Inserate: priska.zuercher@<strong>syndicom</strong>.ch<br />
Abobestellung: info@<strong>syndicom</strong>.ch<br />
Abopreis ist im Mitgliederbeitrag inbegriffen. Für<br />
Nichtmitglieder: Fr. 50.– (Inland), Fr. 70.– (Ausland)<br />
Verlegerin: <strong>syndicom</strong> – Gewerkschaft<br />
Medien und Kommunikation, Monbijoustr. 33,<br />
Postfach, 3001 Bern<br />
Das <strong>syndicom</strong>-Magazin erscheint sechsmal im Jahr.<br />
Ausgabe <strong>Nr</strong>. 17 erscheint am 29. Juni 2020<br />
Redaktionsschluss: 18. Mai 2020<br />
Redaktionsschluss dieser Ausgabe war der 6. April.<br />
Alle Zahlen/Daten sind aktuell für diesen Zeitpunkt.<br />
31<br />
Anzeige<br />
Das <strong>syndicom</strong>-Kreuzworträtsel<br />
Für danach, wenn wir wieder reisen können:<br />
Zu gewinnen gibt es eine Hotelcard,<br />
gespendet von unserer Dienstleistungspartnerin<br />
Hotelcard. Das Lösungswort<br />
wird in der nächsten Ausgabe zusammen<br />
mit dem Namen der Gewinnerin<br />
oder des Gewinners veröffentlicht.<br />
Lösungswort und Absender auf einer<br />
A6-Postkarte senden an: <strong>syndicom</strong>-<br />
Magazin, Monbijoustrasse 33, Postfach,<br />
3001 Bern. Einsendeschluss: 18.5.20<br />
Der Gewinner<br />
Die Lösung des <strong>syndicom</strong>-Kreuzworträtsels<br />
aus dem <strong>syndicom</strong>-Magazin<br />
<strong>Nr</strong>. 15 lautet:<br />
Gewerkschaftliche Entlassung.<br />
Gewonnen hat Walter Brun aus Emmen.<br />
Die Reka-Checks im Wert von 50 Franken<br />
sind unterwegs. Wir gratulieren herzlich!<br />
Bezahlen Sie<br />
Ihre Ferien mit<br />
Reka-Geld.<br />
7 %<br />
Rabatt!<br />
Gönnen Sie sich mehr für Ihr Budget.<br />
Beziehen Sie Reka-Geld mit Rabatt<br />
und bezahlen Sie damit Ihre Ferien bei<br />
vielen Schweizer Reisebüros. Insgesamt<br />
akzeptieren über 9‘000 Annahmestellen<br />
Reka-Geld. reka-guide.ch<br />
Als <strong>syndicom</strong>-<br />
Mitglied beziehen<br />
Sie Reka-Geld<br />
mit 7 % Rabatt.<br />
Mit Reka liegt mehr drin.<br />
Reka18_Syndicom_176x88_d_01_quer.indd 1 21.11.18 13:53
32 Inter-aktiv<br />
<strong>syndicom</strong> social<br />
Podcasts: Trend ungebrochen<br />
5.3.2020<br />
Günstig in der Produktion, überall zu<br />
konsumieren, junges Publikum, lange<br />
Verweildauer: Podcasts boomen. Immer mehr setzen<br />
auch Unternehmen und Organisationen auf das neue<br />
Medium, in der Hoffnung, sich als Themenführer ihrer<br />
Branche in Szene zu setzen.<br />
Quelle: rnz.de<br />
Gleichstellung: Ja, aber …3.3.2020<br />
81 Prozent der Unternehmen weltweit sehen<br />
Diversität und Inklusion als wichtiges Thema.<br />
Doch weniger als die Hälfte (42 %) verfolgen eine<br />
klare Strategie zur Erreichung von Geschlechtergerechtigkeit.<br />
Quelle: Mercer.ch<br />
Crowdwork in der Schweiz<br />
2.3.2020<br />
Als Crowdwork bezeichnet<br />
man Aufträge, die über<br />
Internetplattformen angeboten<br />
und von einem oder mehreren<br />
Crowdworkern bearbeitet werden. Gut eine<br />
Million Schweizer*innen haben schon<br />
Crowdwork gemacht, für rund 135 000 davon<br />
ist es gar die einzige Einkommens quelle,<br />
schreibt Daniel Hügli, <strong>syndicom</strong>- Zentralsekretär<br />
im Sektor ICT, auf swissict.ch.<br />
Der Turing-Test erklärt<br />
Wann ist maschinelle Intelligenz der menschlichen<br />
Intelligenz gleichwertig? – Wenn ein<br />
Frage steller nicht unterscheiden kann, wer ihm<br />
auf eine Reihe von Fragen geantwortet hat, ein<br />
Mensch oder eine Maschine.<br />
Alan Turing († 1954), der diesen Test vorgeschlagen<br />
hat, war ein britischer Mathematiker<br />
und Informatiker. Bisher konnte keine Maschine<br />
den Turing-Test zweifelsfrei bestehen.<br />
Dies ist eines von 52 Schlagwörtern aus dem<br />
<strong>syndicom</strong>-KI-Lexikon: Bit.ly/39xOV<strong>16</strong><br />
<strong>syndicom</strong> begrüsst Unterstützung<br />
für die Selbständigen20.3.2020<br />
<strong>syndicom</strong> begrüsst die Beschlüsse des<br />
Bundesrates, insbesondere die finanzielle<br />
Unterstützung der Selbständigen in Form<br />
eines Taggeldes nach dem Vorbild der<br />
Verdienst ausfallentschädigung. Die Gewerkschaften<br />
müssen jedoch als Sozialpartner<br />
in die einheitliche Umsetzung<br />
dieser Beschlüsse einbezogen werden.<br />
Streaming über alles2.3.2020<br />
Drei von vier Online-Nutzer*innen in der<br />
Schweiz sind Kunden von Streaming-Diensten<br />
wie Youtube, SRF und Spotify, so das Resultat<br />
der NET-Metrix-Base-Studie. Am liebsten hören<br />
und schauen wir uns die Inhalte auf dem<br />
Smartphone an. Einzig bei Bezahldiensten wie<br />
Netflix kommt vermehrt der Laptop zum Zug.<br />
Digitalisierung verändert die Kreativbranche15.2.2020<br />
«Die Digitalisierung hat tatsächlich die Kreativbranche<br />
verändert. Dienstleistungen, die zuvor nur von Fachkräften<br />
erledigt werden konnten, wurden auch für Laien<br />
zugänglich gemacht. Dies zwingt uns zur Reflexion über<br />
unsere Kompetenzen. (…) Wir sind Experten in visueller<br />
Kommunikation von Inhalten. Diese Fähigkeit ist vermehrt<br />
ins Zentrum unserer eigenen Tätigkeit zu rücken<br />
und Kunden auf Augenhöhe zu vermitteln», sagt Heidi<br />
Bernard, Innovationsprozess- und Kommunikationsdesignerin,<br />
via LinkedIn.<br />
Zoogler bald mit<br />
Personalvertretung13.2.2020<br />
Die Mitarbeitenden von Google in<br />
Zürich, auch Zoogler genannt, erhalten<br />
neu eine Personalvertretung.<br />
<strong>syndicom</strong> stand ihnen dabei beratend zur Seite.<br />
Ein Sympathisant dazu auf Facebook: «Auch amerikanische<br />
Grossfirmen können mit ihren MA nicht<br />
machen, was sie wollen! Recht so! »<br />
Neuer Lohnrechner für Post-Mitarbeitende2020<br />
Mit dem Lohnrechner von <strong>syndicom</strong> können Mitarbeitende der<br />
Post ihre voraussichtliche Lohnerhöhung berechnen. Der Lohnanstieg<br />
ist je nach Konzernbereich unterschiedlich. Ein Verteilschlüssel<br />
sorgt für Fairness und Klarheit. Je weniger jemand<br />
verdient, desto höher kann die Lohnerhöhung ausfallen.<br />
Check deinen Lohn: <strong>syndicom</strong>.ch/lohn20


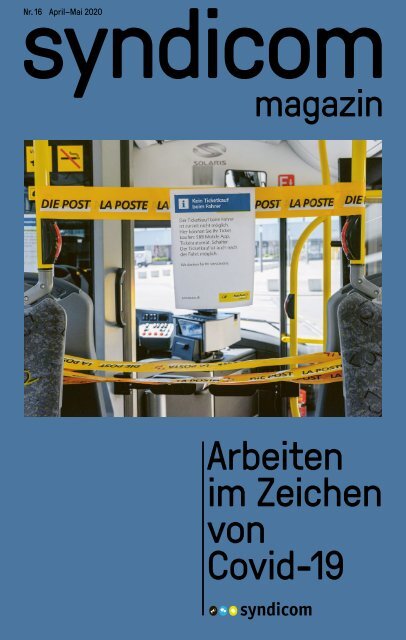

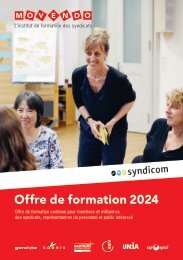



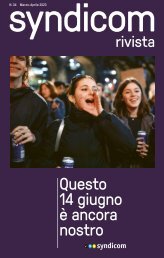

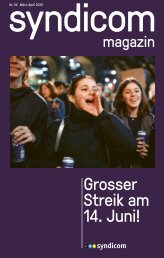


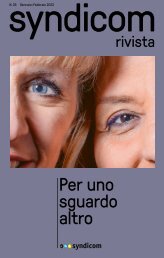
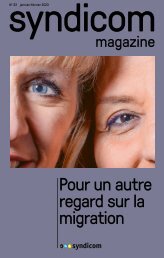
![2202456_[230122]_Syndicom_33_2023_DE_LOW_150_dpi](https://img.yumpu.com/67501302/1/164x260/2202456-230122-syndicom-33-2023-de-low-150-dpi.jpg?quality=85)