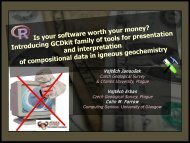EINFÜHRUNG IN DIE ISOTOPENGEOCHEMIE
EINFÜHRUNG IN DIE ISOTOPENGEOCHEMIE
EINFÜHRUNG IN DIE ISOTOPENGEOCHEMIE
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
34<br />
Das K–Ar-Zerfallssystem (K–Ar- und Ar–Ar-Methoden)<br />
In Abbildung 25 ist der Zusammenhang<br />
zwischen Schließungstemperatur<br />
und Abkühlgeschwindigkeit am<br />
Beispiel der Sr-Diffusion in natürlichem<br />
Diopsid illustriert. Der geologisch<br />
relevante Bereich entspricht<br />
Abkühlungsgeschwindigkeiten -dT/<br />
dt von 10 o – 104 K/Ma, wofür die<br />
Schließungstemperatur des Diopsids<br />
zwischen »800 und 950°C liegt.<br />
Die Diffusionskoeffizienten haben<br />
extrem niedrige Werte – »10-14 – 10-17 cm2 /s im Fall der Sr-Diffusion in<br />
Diopsid. Diffusionslängen oder -wege<br />
x können mit Hilfe der Relation<br />
abgeschätzt werden. Daraus<br />
errechnet sich im Fall, daß D=10-15 cm2 /s ist, eine Diffusionslänge<br />
x»0.18cm für t = 106a = 3.15´1013s, d.h. ein Sr-Atom im Diopsid diffundiert<br />
pro 106 x Dt<br />
a »0.18cm weit.<br />
@<br />
Das Konzept der Schließungstemperatur<br />
ist in der Folgezeit zunächst<br />
weitgehend akzeptiert worden.<br />
Inzwischen wird aber zunehmend<br />
und auch rigoros Kritik daran geäußert.<br />
Neben der Diffusion werden die<br />
Deformation von Gesteinen und<br />
Mineralen, die eine Rekristallisation<br />
der Minerale verursacht, und die<br />
Rolle von Fluiden auf Korngrenzen<br />
für noch wichtiger gehalten. Bei<br />
Abwesenheit von Fluiden muß<br />
zudem ein anderes Mineral als Reak-<br />
Schließungstemperatur [�C]<br />
1500<br />
1400<br />
1300<br />
1200<br />
1100<br />
1000<br />
900<br />
800<br />
Abhängigkeit der<br />
Schließungstemperatur<br />
von Diopsid für Sr-<br />
Diffusion von der<br />
Abkühlrate<br />
0 1 2 3 4 5 6 7 8<br />
log dT/dt [K/Ma]<br />
ABBILDUNG 25 Sr-Diffusion in Diopsid: Abhängigkeit<br />
der Schließungstemperatur von der Abkühlgeschwindigkeit.<br />
Die Berechnung der Kurve erfolgte nach der<br />
é22440<br />
æ dT ö ù<br />
Gleichung: T[C] c ° = ê<br />
-logç<br />
÷ . Sie<br />
è dt ø<br />
ú - 273<br />
ë 20.9<br />
û<br />
beruht auf experimentellen Untersuchungen zur Sr-<br />
Diffusion in natürlichem Diopsid. Angenommen wurde<br />
bei den Berechnungen ein Kornradius von 0.2cm<br />
und A=55 (Kugelgestalt des Minerals); die Aktivierungsenergie<br />
wurde zu 97 kcal/mol bestimmt, und D0 = 54cm 2 /sec.<br />
tionspartner zur Verfügung stehen, und außerdem muß zwischen den austauschenden<br />
Mineralen ein Ladungsausgleich bewerkstelligt werden. Villa [24] macht auf zahlreiche<br />
Widersprüche innerhalb der originalen Kalibrierung der Schließungstemperaturen aufmerksam<br />
und auf innere Widersprüche in vielen anderen Studien. So weist er zum Beispiel<br />
auf eine Kompilierung von Altersdaten aus den Zentralalpen hin, die anzuzeigen scheint,<br />
daß Rb–Sr-Alter von Muskoviten höher liegen (Eozän) als U–Pb-Alter von Monaziten (Oligozän).<br />
Daraus wurde gefolgert, daß die Schließungstemperatur von Monazit für das U–Pb-<br />
System mit ca. 420 °C deutlich unterhalb der für Rb–Sr im Muskovit liegt [25] , für die ca. 500<br />
°C angenommen wurde. Villa argumentiert demgegenüber, die Muskovite seien nicht ausschließlich<br />
Neubildungen der alpinen Metamorphose und enthielten noch Anteile an herzynischem<br />
radiogenem 87 Sr, so daß ihre eozänen scheinbaren Alter tatsächlich Mischalter<br />
zwischen herzynisch und alpin seien, während die Monazite Neubildungen der Metamorphose<br />
im Oligozän wären. Gut belegt scheint immerhin, daß zonierte Monazite scharfe<br />
Altersunterschiede zeigen, die der Zonierung entsprechen [27] . Das bedeutet, daß die Diffusion<br />
während des thermischen Ereignisses, das zur Bildung von Anwachssäumen führte,<br />
nicht rasch genug erfolgte, um die U–Pb-Isotopenunterschiede auszugleichen. Daraus wiederum<br />
ergibt sich, daß die Schließungstemperatur des Monazits für die Diffusion von Pb<br />
erheblich über 420 °C liegen muß. Bei der Datierung von Hellglimmern aus grünschieferbis<br />
amphibolitfaziellen Metagraniten der Alpen mittels der Ar–Ar-Methode wurde gefun-