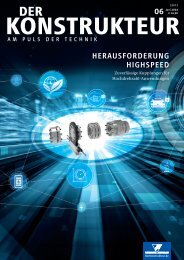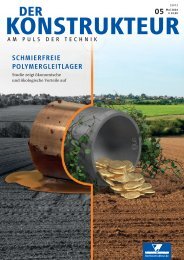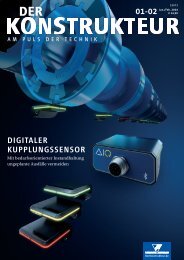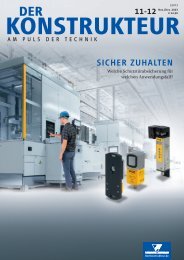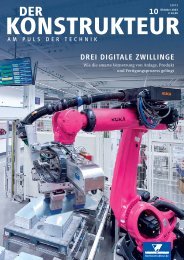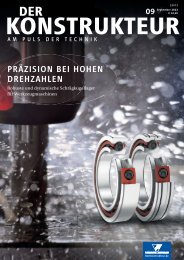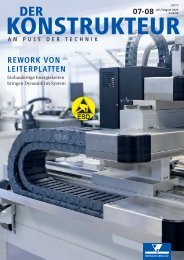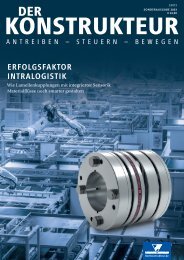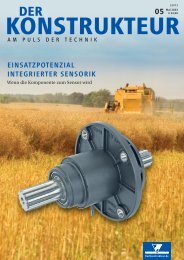DER KONSTRUKTEUR 5/2020
DER KONSTRUKTEUR 5/2020
DER KONSTRUKTEUR 5/2020
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
19073<br />
05 MAI <strong>2020</strong><br />
AM PULS <strong>DER</strong> TECHNIK<br />
TITELSTORY<br />
EFFIZIENT,<br />
EFFIZIENTER ...<br />
High-End-Stromversorgung<br />
erschließt Einsparpotenziale<br />
DerKonstrukteur.de
FÜHL DEN<br />
PULS<br />
<strong>DER</strong><br />
TECHNIK !<br />
<strong>DER</strong><br />
<strong>KONSTRUKTEUR</strong><br />
Erlebe die Faszination<br />
Technik für Konstrukteure<br />
mit begeisternden Formaten<br />
und inspirierenden Inhalten!<br />
Sichern Sie sich den lückenlosen Bezug wertvoller Informationen!<br />
6 Telefax: 06131/992-100 @ E-Mail: vertrieb@vfmz.de Internet: vereinigte-fachverlage.de & Telefon: 06131/992-147<br />
Jahresabo nur 95 €:<br />
10 Print-Ausgaben im Jahr<br />
+ Sonderausgabe<br />
Antreiben – Steuern – Bewegen<br />
(1x jährlich)<br />
Abo-Begrüßungsgeschenk:<br />
Der Bluetooth-Lautsprecher MSS-560.bt3<br />
Akku, Freisprecher & NFC, 5W, inkl. Zubehör;<br />
kompatibel mit Bluetooth-Smartphones, Tablets und PCs<br />
max. Akkulaufzeit: bis zu 6 Stunden<br />
+
EDITORIAL<br />
ÖKOSYSTEME EINER<br />
INDUSTRIE 4.0<br />
TOX ®<br />
ElectricDrive<br />
moves<br />
Seit vielen Wochen erreichen uns tagtäglich neue Informationen über<br />
die pandemiebedingten Veränderungen unseres gesellschaftlichen und<br />
geschäftlichen Lebens. Doch so langsam sehnt man sich nach ein wenig<br />
Normalität. Und auch wenn im Moment viele Unternehmen in der<br />
Industrie um eine Schadensbegrenzung bemüht sind, brauchen wir<br />
konkrete Projekte, die uns optimistisch stimmen. Eines davon ist die<br />
Schaffung digitaler Ökosysteme im Anlagen- und Maschinenbau. Sie<br />
bilden die Basis für neue Formen des Wirtschaftens und Arbeitens und<br />
die Grundlage für Industrie 4.0. Ein solches Ökosystem integriert<br />
unterschiedliche Geräte, Maschinen und Anlagen, Roboter und Dienste,<br />
also Einzel-<br />
EINHEITLICHE STANDARDS<br />
ERÖFFNEN VÖLLIG NEUE<br />
INTEGRATIONSKONZEPTE<br />
und Systemlösungen,<br />
in<br />
ein Gesamtkonzept.<br />
Voraussetzung<br />
dafür ist ein<br />
einheitlicher Kommunikationsstandard wie OPC UA. Diese herstellerund<br />
plattformunabhängige Technologie ermöglicht eine durchgängige<br />
Vernetzung vom kleinsten Sensor über die Maschine bis in die Cloud.<br />
Ganz vorne mit dabei ist hier die Werkzeugmaschinenindustrie und damit<br />
der VDW, der das Label umati (universal machine technology interface)<br />
ins Leben gerufen. Was sich dahinter verbirgt und welche Rolle der<br />
VDMA hierbei spielt, lesen Sie auf Seite 7. Die Verbreitung des<br />
OPC-UA-Standards geht mit großen Schritten voran, und damit eröffnen<br />
sich auch für Entwickler und Konstrukteure neue Freiheitsgrade,<br />
insbesondere im Hinblick auf die fortschreitende Automatisierung.<br />
Mit Blick auf eine neue Ära des Internet of Things in digitalen<br />
Öko systemen grüßt Sie herzlich Ihre<br />
Nicole Steinicke<br />
Chefredakteurin<br />
n.steinicke@vfmz.de<br />
Die treibende Kraft<br />
der Industrie.<br />
tox-electricdrive.com
INHALT<br />
MENSCHEN UND MÄRKTE<br />
03 Editorial: Ökosysteme einer Industrie 4.0<br />
06 Standpunkt: Vom Datensammeln<br />
zur smarten Montage<br />
08 Whiteboard: Der Infotainer – Einblicke in das bunte<br />
Leben von „Unterhaltungskünstler“ Hansjörg<br />
Sperling-Wohlgemuth, zuständig für Veranstaltungsund<br />
Kongressmanagement bei Pilz<br />
10<br />
08<br />
PRODUKTE UND ANWENDUNGEN<br />
WERKSTOFF- & VERBINDUNGSTECHNIK<br />
10 INTERVIEW<br />
„Das Geheimnis unseres Werkstoffs basiert auf<br />
drei Technologien“ – Klaus Wagner, Leiter Forschung<br />
und Innovation der Herbert Hänchen GmbH & Co. KG<br />
12 Infrarot-Systeme: Wärme, die verbindet<br />
16 Keramik top in Form<br />
KONSTRUKTIONSELEMENTE<br />
18 TITELSTORY<br />
Stromversorgung: Effizient, effizienter, …<br />
22 5 TRENDS<br />
bei Energieführungssystemen<br />
24 Steckverbinder: Ein Leichtgewicht für alle Fälle<br />
ANTRIEBSTECHNIK<br />
26 Lineartechnik auf neuem Level<br />
36<br />
12<br />
26<br />
4 <strong>DER</strong> <strong>KONSTRUKTEUR</strong> <strong>2020</strong>/05 www.derkonstrukteur.de
SPECIAL<br />
ROBOTIK<br />
28 CNC und Knickarmroboter:<br />
Wenn der Roboter mit der Werkzeugmaschine …<br />
32 KLARTEXT<br />
Was brauchen die Cobots?<br />
34 Encoder: Hohl – aber oho<br />
36 Planetengetriebe: Perfekte Kombination<br />
38 Vision Sensor: Koordinaten im Blick<br />
40 Antrieb für Dr. Roboter<br />
42 Linearmodul: Neue Horizonte<br />
SERVICE<br />
41 Impressum<br />
43 Vorschau<br />
38<br />
ANZEIGE<br />
TITELBILD<br />
WAGO Kontakttechnik,<br />
Minden<br />
ANZEIGE<br />
TITELBILD SPECIAL<br />
Mitsubishi Electric,<br />
Ratingen<br />
Der schnellste<br />
Draht zum<br />
Schaltschrank<br />
Schaltschränke kompakt planen und<br />
schneller fertigstellen mit innovativen<br />
Connectivity-Lösungen von HARTING.<br />
www.HARTING.com/<br />
Schaltschrankbau
STANDPUNKT<br />
VOM DATENSAMMELN<br />
ZUR SMARTEN MONTAGE<br />
MENSCHEN UND MÄRKTE<br />
Im Bereich der Montagtechnik hält der Begriff „Smart-Montage“<br />
immer mehr Einzug. Was ist aber der Unterschied zwischen<br />
dem Sammeln von Daten und ihrer Bereitstellung für eine<br />
intelligente Montage?<br />
Das Datensammeln ist der erste Schritt. Er bringt für sich<br />
genommen noch keinen effektiven Mehrwert. Teilweise ist<br />
sogar der gegenteilige Effekt zu beobachten, da durch eine<br />
Vielzahl von Informationen und ihre Bewertung Störeffekte<br />
produziert werden, die den Montageablauf behindern.<br />
Als ein Vorteil der smarten Montage wird häufig die vorausschauende<br />
Wartung genannt, um über planbare Instandhaltungsmaßnahmen<br />
die Stillstandzeiten zu reduzieren und somit<br />
die Wirtschaftlichkeit der Anlagen zu steigern.<br />
Die meisten Hersteller stoßen jedoch schon beim Sammeln<br />
der notwendigen Informationen auf Schwierigkeiten. Nur wenige<br />
Anlagenbetreiber wollen ihre Daten und die daraus resultierenden<br />
Erkenntnisse Dritten zur Verfügung stellen. Hersteller<br />
können die Informationen, die sie zur Effektivitätssteigerung<br />
ihrer Anlagen benötigen, daher meist nur aufwändig mithilfe<br />
entsprechender Langzeittests ermitteln.<br />
Wichtig dabei sind realistische Umweltbedingungen. Denn<br />
es ist ein Unterschied, ob Daten an einer Anlage unter den<br />
Bedingungen eines täglichen Temperaturwechsels<br />
beispielsweise im Nahen Osten erhoben werden<br />
oder im Testlabor einer klimatisierten Werkshalle<br />
in Hessen. Die Ergebnisse weichen voneinander<br />
ab – unabhängig davon, dass der<br />
zulässige Temperaturbereich des Herstellers<br />
zwischen - 10 und + 40 °C<br />
in beiden Fällen eingehalten wird.<br />
Veränderungen in den Prozessen<br />
zu erkennen und zuverlässige<br />
Kriterien für die Bewertung dieser<br />
Abweichungen zu entwickeln,<br />
werden in Zukunft daher auf die<br />
Konstruktion immer mehr Einfluss<br />
nehmen und zusätzliche<br />
Prozesse erfordern.<br />
In der manuellen oder<br />
teilautomatisierten Montage<br />
ist dieser neue Aspekt für<br />
die Konstruktion ebenfalls<br />
eine Herausforderung. Das<br />
Monitoren und Bewerten des<br />
vollständigen Montageprozesses<br />
wird hier ebenfalls immer<br />
wichtiger: Qualitätsmerkmale<br />
müssen definiert, überwacht<br />
und dokumentiert werden.<br />
Hier wird die Konstruktion eine<br />
führende Rolle übernehmen.<br />
Die somit erforderlichen smarten<br />
Montagearbeitsplätze werden durch<br />
die Kombination von kommunikations-<br />
fähigen Hub-, Dreh-, Kipp-, Wagen- oder Flurmodulen realisierbar.<br />
Manuelle Montagearbeiten können so auf mehreren Seiten<br />
am Werkstück ausgeführt und analysiert und die entsprechenden<br />
Zustandsinformationen erfasst werden. Diese können dann<br />
smart zur Prozessoptimierung, Qualitätssicherung und Dokumentation<br />
genutzt werden. Sie geben somit dem Konstrukteur<br />
neue Möglichkeiten zur Gesamtoptimierung bis tief in den<br />
Fertigungsprozess.<br />
Festzuhalten ist: Bis zur smarten Montageanlage ist es noch<br />
weit. Es gibt erfolgversprechende Ansätze, noch aber fehlen<br />
häufig sowohl ausreichende Daten als auch zuverlässige Kriterien<br />
zur Bewertung von Veränderungen in Prozessen.<br />
www.roemheld-gruppe.de<br />
BIS ZUR SMARTEN<br />
MONTAGE ANLAGE<br />
IST ES NOCH WEIT<br />
MARC BELZER, PRODUKT-<br />
BEREICHSLEITER MONTAGE-<br />
UND ANTRIEBSTECHNIK,<br />
RÖMHELD GMBH FRIEDRICHS-<br />
HÜTTE, LAUBACH<br />
6 <strong>DER</strong> <strong>KONSTRUKTEUR</strong> 1-2/2018 <strong>2020</strong>/05 www.derkonstrukteur.de
UMATI WIRD ZUR WELTSPRACHE <strong>DER</strong> PRODUKTION<br />
Künftig werden VDMA und VDW die Nutzung und Verbreitung von OPC-UA-Standards<br />
für den gesamten Maschinenbau unter der Marke Umati gemeinsam voranbringen.<br />
Denn OPC UA bietet einen einheitlichen Rahmen für die Interoperabilität zwischen<br />
Maschinen und Systemen. Über einen Bottom-up-Ansatz wurde deutlich, dass Grundelemente<br />
für einen großen Teil des vielfältigen Produktspektrums im Maschinen- und<br />
Anlagenbau einheitlich definiert werden müssen. Das einfachste Beispiel ist die<br />
Maschinenidentifikation, also Merkmale wie etwa Hersteller, Seriennummer, Baujahr<br />
und Maschinentyp. Deshalb arbeiten verschiedene Bereiche im VDMA – dazu gehören<br />
elektrische Antriebstechnik, Kunststoff- und Gummimaschinen, industrielle Bildverarbeitung,<br />
Metallurgy, Robotik und Werkzeugmaschinen – an den Grundlagen<br />
der Companion Specification OPC UA for Machinery. „Sie wird noch im laufenden Jahr in der ersten Version veröffentlicht“, kündigt<br />
Hartmut Rauen, stellvertretender Hauptgeschäftsführer des VDMA, an.<br />
www.vdma.org<br />
E-CAD-LÖSUNG<br />
FÜR DAS HOMEOFFICE<br />
Japanese quality – trusted worldwide since 1921<br />
Mit der E-CAD-Lösung von<br />
WSCAD arbeiten viele Ingenieure<br />
und Elektrokonstrukteure in<br />
Zeiten von Corona im Homeoffice<br />
von zuhause aus – schnell,<br />
einfach und effizient. Weil die<br />
Netzwerk lizenz der WSCAD Suite<br />
über eine Ausleihfunktion<br />
verfügt, können Mitarbeiter mit<br />
der Electrical-Engineering-Lösung<br />
von jedem beliebigen Ort aus<br />
arbeiten. Für alle Unternehmen<br />
und Anwender, die keine Netzwerklizenz<br />
haben, bietet WSCAD<br />
bis 31.05.<strong>2020</strong> ein spezielles<br />
Upgrade-Angebot.<br />
„Wir wollen, dass unsere Kunden<br />
auch in diesen für uns alle<br />
schwierigen Zeiten so effektiv<br />
wie möglich an ihren Projekten<br />
weiterarbeiten können. Deshalb<br />
bieten wir diesen zeitlich<br />
begrenzten Preisnachlass an“,<br />
sagt Axel Zein, Geschäfts führer<br />
der WSCAD GmbH. Für eine<br />
optimale Unterstützung hat<br />
WSCAD auch das Online-<br />
Schulungsprogramm der aktuellen<br />
Situation angepasst: In kleinen<br />
Gruppen zu maximal fünf<br />
Personen oder individuell und<br />
inhaltlich ganz auf den persönlichen<br />
Bedarf abgestimmt,<br />
schulen die erfahrenen Dozenten<br />
in Online-Sessions die Anwender<br />
zuhause oder am Arbeitsplatz.<br />
www.wscad.com<br />
Bearings<br />
for speed<br />
Get to know our bearings at www.koyo.eu<br />
Automotive components Bearings Machine Tools / Mechatronics
WHITEBOARD<br />
<strong>DER</strong><br />
INFOTAINER<br />
EINBLICKE IN DAS BUNTE<br />
LEBEN VON „UNTER-<br />
HALTUNGSKÜNSTLER“<br />
HANSJÖRG SPERLING-<br />
WOHLGEMUTH<br />
Sie sind Lehrer, Spiel- und<br />
Theaterpädagoge und<br />
Entertainer, was hat Sie in<br />
die Industrie verschlagen?<br />
In welcher Rolle sehen<br />
Sie sich hier?<br />
Welches Bild von Automatisierung<br />
wollen Sie vermitteln?<br />
Welche Werte sind Ihnen beim<br />
Arbeiten in dem Familienunternehmen<br />
Pilz wichtig?<br />
MENSCHEN UND MÄRKTE<br />
Bilder: 1.-3.: Pilz GmbH & Co. KG;<br />
4.: Julien Eichinger - stock.adobe.com<br />
8 <strong>DER</strong> <strong>KONSTRUKTEUR</strong> <strong>2020</strong>/05 www.derkonstrukteur.de
HANSJÖRG SPERLING-WOHLGEMUTH<br />
VERANSTALTUNGS- UND KONGRESSMANAGEMENT,<br />
PILZ GMBH & CO. KG, OSTFIL<strong>DER</strong>N
WERKSTOFF- & VERBINDUNGSTECHNIK<br />
DAS GEHEIMNIS UNSERES<br />
WERKSTOFFS BASIERT AUF<br />
DREI TECHNOLOGIEN<br />
Die Ursprünge liegen vor 95 Jahren in der Motorinstandhaltung –<br />
das erste eigene Produkt der Herbert Hänchen GmbH & Co. KG<br />
war dann 1952 ein Hydraulikzylinder. Heute versteht sich das<br />
Unternehmen als Systemlieferant. Seit 2015 gehören auch<br />
Bauteile aus kohlefaserverstärkten Kunststoffen zum Portfolio.<br />
Wie kam das? Und wo geht die Reise in dem Bereich hin?<br />
Darüber sprachen wir mit Klaus Wagner, dem Leiter Forschung<br />
und Innovation der Herbert Hänchen GmbH & Co. KG.<br />
Sie sind Spezialist für Hydraulikzylinder<br />
und Antriebssysteme, wie kam es dazu,<br />
dass Sie sich mit kohlefaserverstärkten<br />
Kunststoffen beschäftigen?<br />
Ein Kunde aus der Prüftechnik fragte nach<br />
sehr leichten Kolbenstangen für einen<br />
hochdynamischen Prüfstand. Diese Anforderung<br />
war mit konventionellen Werkstoffen<br />
wie Stahl, Aluminium oder Titan nicht<br />
umsetzbar. Mit Stahl waren die projektierten<br />
Stangen aufgrund der hohen Werkstoffdichte<br />
zu schwer. Leichtbauwerkstoffe wie<br />
Titan oder Aluminium verfügen zwar über<br />
geringere Dichte, aber auch einen geringeren<br />
Elastizitätsmodul. Dadurch wäre eine<br />
stark erhöhte Baugröße der Kolbenstangen<br />
nötig gewesen, um die Anforderungen an<br />
die Steifigkeit zur Aufnahme von Seitenkräften<br />
zu erfüllen. Aus dieser Anforderung<br />
heraus haben wir entschieden, uns<br />
mit dem Thema Verbundwerkstoffe zu<br />
befassen.<br />
INTERVIEW<br />
PRODUKTE UND ANWENDUNGEN<br />
Was leistet Ihr Werkstoff, das andere<br />
kohlefaserverstärkte Kunststoffe nicht<br />
können?<br />
H-CFK ist ein von Hänchen entwickelter,<br />
hochbelastbarer Verbund von Carbon und<br />
anderen Komponenten. Zur Aufnahme<br />
der Kräfte werden spezielle Laminataufbauten<br />
designt, die die hohen dreidimensionalen<br />
Belastungen aufnehmen können.<br />
Hierzu werden verschiedene Faserwinkel<br />
von verschiedenen Faserwerkstoffen<br />
kombiniert. Um eine hohe Kraft in die<br />
Kolbenstangen einleiten zu können, werden<br />
speziell entwickelte Verfahren angewandt,<br />
um metallische Gewindeende hochbelastbar<br />
in das Laminat einzubinden. Und um<br />
die Oberfläche druckfest und flüssigkeitsdicht<br />
auszuführen, ist eine spezielle Oberflächenbeschichtung<br />
erforderlich, die<br />
auch den Belastungen von Dichtungen<br />
bei hohen Hydraulikdrücken standhält.<br />
Hierbei unterscheiden wir uns von am<br />
Markt gängigen Methoden.<br />
Stv. Chefredakteurin Martina Klein im<br />
Gespräch mit Klaus Wagner, dem Leiter<br />
Forschung und Innovation der Herbert<br />
Hänchen GmbH & Co. KG in Ostfildern<br />
10 <strong>DER</strong> <strong>KONSTRUKTEUR</strong> <strong>2020</strong>/05 www.derkonstrukteur.de
WERKSTOFF- & VERBINDUNGSTECHNIK<br />
Wie erreichen Sie das?<br />
Die verschiedenen Verfahren und Maschinen,<br />
um diese Technologien umzusetzen,<br />
wurden von uns eigens entwickelt. Zum<br />
Beispiel haben wir mit unserem Geschäftsbereich<br />
Ratio-Drive eine 10-Achs-<br />
Wickelmaschine konstruiert und gebaut,<br />
die Fasern nicht nur rund wickeln kann,<br />
sondern in alle Richtungen, auch unidirektional<br />
– also in Längsrichtung – legen<br />
kann. In diesem Verfahren werden auch<br />
metallische Endstücke eingebunden.<br />
Auch das spezielle Verfahren zur Erzeugung<br />
der H-CFK-Oberfläche wurde von<br />
uns entwickelt und kann bei uns angewandt<br />
werden. Wichtig ist es, für jeden<br />
Anwendungsfall die möglichst genaue<br />
Belastung der Bauteile zu kennen, um die<br />
jeweils passende Technologie optimal<br />
anwenden zu können.<br />
Sie erzielen mit dem Werkstoff an<br />
verschiedenen Stellen Vorteile bei Ihren<br />
Produkten. Können Sie uns das erklären?<br />
Da der Geschäftsbereich H-CFK mit Mitarbeitern<br />
und Know-how aus dem Bereich<br />
Hydraulik aufgebaut wurde, liegen Anwendungen<br />
des neuen Werkstoffs am und<br />
im Hydraulikzylinder nahe. Neben der<br />
Kolbenstange und dem Zylinderrohr aus<br />
H-CFK ist hier insbesondere die Entwicklung<br />
des Dichtungssystems Servoseal zu<br />
nennen. Der Servoseal ist eine Hybriddichtung<br />
und besteht aus einem Kunststoffdichtring<br />
für die eigentliche Dichtwirkung<br />
und einem Verstärkungsring aus<br />
Carbon. Durch den hochsteifen Carbonring<br />
können die Belastungen auf die<br />
Dichtungslauffläche derart reduziert<br />
werden, dass eine Dichtung auch hochdynamische<br />
Anwendungen im Kurzhubbereich<br />
fast ohne Leckage und Reibung<br />
abdichtet.<br />
Aber es geht nicht mehr nur um die<br />
Optimierung Ihrer Hydraulikzylinder.<br />
Bauteile aus H-CFK sind heute ein eigener<br />
Geschäftsbereich bei Ihnen. Wo kommen<br />
die Produkte überall zum Einsatz?<br />
Die oben genannten drei Technologien<br />
von H-CFK – das Carbon-Design, der<br />
Metall-Carbon-Verbund und die Oberfläche<br />
– wurden für hoch belastbare<br />
BEI <strong>DER</strong> KONSTRUKTION VON CARBONBAUTEILEN<br />
IST ES WICHTIG, DASS MAN SICH VON<br />
VORGÄNGERBAUTEILEN AUS METALL LÖST<br />
Kolbenstangen entwickelt. Schnell haben<br />
wir gemerkt, dass die Anwendung dieser<br />
Technologien aber auch in anderen Bereichen,<br />
insbesondere auch in nicht hydraulischen<br />
Bereichen, sinnvoll sind, wenn<br />
auch in manchen Anwendungen nur<br />
eine dieser Technologien. So kommen<br />
H-CFK-Walzen aus Gewichtsgründen zum<br />
Beispiel in der Handhabungstechnik zum<br />
Einsatz, wenn große Vliesrollen für die<br />
Produktion von Fahrzeuginnenverkleidungen<br />
bewegt werden müssen. Oder<br />
als Antriebswelle in Schraubsystemen,<br />
um mit den niedrigen Massenträgheitsmomenten<br />
hohe Anzugsmoment-Genauigkeiten<br />
zu erreichen.<br />
Welche möglichen Anwendungsfelder<br />
sehen Sie für den Werkstoff in der<br />
Zukunft noch?<br />
H-CFK ist ein Werkstoff, der nicht nur ein<br />
geringes Gewicht bietet. Auch mit anderen<br />
Eigenschaften kann das Material punkten:<br />
So ist H-CFK amagnetisch, was zum Beispiel<br />
in der Sensortechnik ein Vorteil sein<br />
kann. Oder es kann als hochfestes Element<br />
zur Armierung von schnell laufenden<br />
Rotoren in Elektromotoren zur Fixierung<br />
der Magnete eingesetzt werden. Hierzu<br />
kann man eine H-CFK-Hülse aufpressen<br />
oder H-CFK in Dienstleistung auf den<br />
Rotor direkt aufwickeln. Ein weiterer Materialvorteil<br />
ist das Temperaturverhalten:<br />
H-CFK hat eine deutlich geringere Wärmeausdehnung<br />
als metallische Werkstoffe, die<br />
daraus gefertigten Produkte sind also sehr<br />
temperaturstabil. Dies kann zum Beispiel<br />
für wissenschaftliche Teleskope oder in<br />
der Satellitentechnik vorteilhaft sein.<br />
Was ist bei der Entwicklung von Bauteilen<br />
aus dem Werkstoff zu beachten?<br />
Wichtig ist bei der Konstruktion von Carbonbauteilen<br />
immer, dass man sich von Vorgängerbauteilen<br />
aus Metall löst. H-CFK ist<br />
ein nicht-isotroper Werkstoff aus Fasern,<br />
dessen Belastungsfähigkeit aus dem Aufbau<br />
des Laminats beziehungsweise der Faseranordnung<br />
kommt. Anders als bei isotropen<br />
Metallen, die in alle Richtungen gleich belastbar<br />
sind, muss bei H-CFK stets die genaue<br />
Belastung berücksichtigt werden und<br />
entsprechend muss das Laminat designt<br />
werden. Dadurch sehen Carbonbauteile<br />
oft anders aus bzw. sind nicht zu 100 %<br />
austauschbar. Auch kann es sein, dass<br />
H-CFK-Bauteile größer als Metallbauteile<br />
konstruiert werden müssen, um alle Belastungen<br />
realisieren zu können. Trotzdem<br />
können sie dadurch leichter als Metall sein.<br />
www.haenchen.de<br />
Das Interview führte Martina Klein.<br />
KERAMIK LEISTET MEHR.<br />
Bauteile aus Technischer Keramik<br />
vollbringen Höchstleistungen in den<br />
anspruchsvollsten Anwendungen.<br />
Profitieren Sie von den herausragenden<br />
Materialeigenschaften der<br />
extrem harten und verschleißfesten<br />
Funktionswerkstoffe.<br />
Mehr unter sembach.de<br />
Sembach GmbH & Co. KG . 91207 Lauf a. d. Pegnitz . Tel.: +49 (0) 9123 167 0 . info@sembach.de
WERKSTOFF- & VERBINDUNGSTECHNIK<br />
WÄRME, DIE VERBINDET<br />
PRODUKTE UND ANWENDUNGEN<br />
Flugzeuge und Automobile sollen leichter werden,<br />
um Kraftstoff zu sparen, für die Fahrgäste müssen<br />
sie jedoch genauso sicher bleiben. Rotorblätter<br />
von Windenergieanlagen dürfen nicht zu schwer,<br />
müssen aber gleichzeitig extrem belastbar sein.<br />
Infrarot-Wärme kann helfen, diese<br />
widersprüchlichen Anforderungen zu erfüllen.<br />
Und zwar indem sie bei der Herstellung<br />
faserverstärkter Kunststoffe für Effizienz und<br />
einen bestmöglichen Verbund sorgt. Der Einsatz<br />
von CAE kann dies noch weiter optimieren.<br />
Faserverstärkte Kunststoffe sind moderne Verbundwerkstoffe.<br />
Sie bestehen aus Kunststoffen wie Polyphenylsulfid (PPS),<br />
Polyetheretherketon (PEEK) oder Epoxidharzen (EP), in die<br />
Carbon- oder Glas-Fasern eingebettet wurden. Die Fasern<br />
machen das Bauteil fest und steif, die Kunststoffmatrix kann die<br />
auftretende Energie absorbieren. Viele hoch belastete Bauteile im<br />
Auto, wie Lenkrohre, die hohen Torsionskräften ausgesetzt sind,<br />
oder auch Elemente für den Seitenaufprallschutz werden aus diesen<br />
Kompositen hergestellt. Ein weiteres typisches Einsatzgebiet sind<br />
die riesigen Rotorblätter von Windenergieanlagen.<br />
Bei der Herstellung solcher modernen Bauteile kommen Infrarot-Systeme<br />
zum Einsatz, weil sie die Materialien schnell und<br />
homogen erwärmen und so die Prozesszeiten verkürzen können.<br />
Es gibt verschiedene Komposite, je nach ihrem späteren Einsatz.<br />
Kurzfaserverstärkte Duroplaste für große Karosserieteile, langfaserverstärkte<br />
Thermoplaste für hoch belastete Strukturbauteile oder<br />
gewebte Rovings für Windflügel, allen gemeinsam ist, dass sie möglichst<br />
kosteneffizient hergestellt werden sollen.<br />
Autorin: Dr. Marie-Luise Bopp, Projektmanager Marketing,<br />
Heraeus Noblelight GmbH, Kleinostheim<br />
Bei der Fertigung von Komposit-Materialien werden verschiedene<br />
Wärmeprozesse benötigt, etwa zum Aushärten der duroplastischen<br />
Kunststoffe. Thermoplasten werden erwärmt, um sie zu verschweißen,<br />
zu formen oder umzuformen. Faservolumengehalt und Faserorientierung<br />
haben einen erheblichen Einfluss auf die Wärmeleitung,<br />
daher ist die präzise und homogene Erwärmung von Komposit-<br />
Materialien grundsätzlich nicht trivial. Sie ist eine Grundvoraussetzung<br />
dafür, dass die Schichten optimal verdichtet werden können<br />
und so Strukturen mit hoher Integrität bilden.<br />
SCHNELL UND HOMOGEN HEIZEN<br />
Bisher führt man die erforderlichen Wärmeprozesse häufig mit konventionellen<br />
Heißluftöfen durch. Infrarot-Wärmetechnologie bietet<br />
dagegen einige Vorteile. Infrarot-Strahler zeigen Reaktionszeiten<br />
innerhalb von Sekunden, das macht Wärme regelbar und hilft, Energie<br />
richtig zu dosieren. Wenn die Wärmequelle nur dann angeschaltet<br />
sein muss, wenn sie gebraucht wird, spart man Energie.<br />
Infrarot-Systeme sind relativ kompakte Wärmeeinheiten, die<br />
große Werkteile am Band erwärmen, ohne dass ein großvolumiger<br />
Ofen für das komplette Teil benötigt wird. Infrarot-Strahlung kann<br />
EINE HOMOGENE ERWÄRMUNG <strong>DER</strong><br />
KOMPOSIT-MATERIALIEN IST EINE<br />
VORAUSSETZUNG DAFÜR, DASS DIE<br />
SCHICHTEN STRUKTUREN MIT HOHER<br />
INTEGRITÄT BILDEN KÖNNEN<br />
genau an Produkt und Prozess angepasst werden. CAE kann mit<br />
modernen Simulations-Methoden zusätzlich helfen, große Flächen<br />
homogen zu erwärmen, indem beispielsweise die Energieverteilung<br />
auf der Fläche optimiert wird.<br />
EINSATZBEISPIEL FORSCHUNG<br />
So hat Heraeus Noblelight für ein Projekt des National Composites<br />
Centre (NCC) in Bristol, einer weltweit führenden Instanz für Verbundwerkstoffe,<br />
nicht nur Infrarot-Systeme geliefert, sondern auch<br />
12 <strong>DER</strong> <strong>KONSTRUKTEUR</strong> <strong>2020</strong>/05 www.derkonstrukteur.de
TARTLER<br />
KUNDENSPEZIFISCHE<br />
DOSIER- UND<br />
MISCHANLAGEN<br />
FÜR FOLGENDE APPLIKATIONEN<br />
CAE STATT VERSUCH UND IRRTUM<br />
Durch den Einsatz von CAE-Werkzeugen können Wärmeprozesse, die üblicherweise im<br />
Labor zeit- und kostenaufwendig untersucht werden, schnell und effizient simuliert und<br />
optimiert werden. Mithilfe der CAE-Simulation werden präzise Informationen zu Temperaturverteilung<br />
in Substraten, Bauteilen bzw. Rückwirkungen auf Umgebungseinflüsse<br />
berechnet. Weiterhin können die Luftführung oder ein möglicher Druckabfall innerhalb<br />
verschiedener Anlagenkammern in Abhängigkeit der verwendeten Lüfter und Temperatur-<br />
Gradienten berechnet und visualisiert werden. Auf diese Weise werden bereits am Rechner<br />
Designänderungen der Anlagen geprüft und Optimierungsmaßnahmen evaluiert. Darüber<br />
hinaus lassen sich die Ursachen für Qualitätsschwankungen oder die Möglichkeiten zur<br />
Optimierung kritischer Produktionsschritte im Hinblick auf Energieeffizienz und Prozessqualität<br />
erkennen und das Potenzial für Energieeinsparungen aufdecken.<br />
GIESSEN<br />
RTM<br />
KLEBEN<br />
SPRÜHEN<br />
Simulationen angestellt, um die genaue Positionierung<br />
von Infrarotmodulen beim Auflegen von<br />
Pre-Preg-Material zu bestimmen.<br />
Und zwar beauftragte das NCC Heraeus Noblelight<br />
im Rahmen eines Projekts damit, eine optimale<br />
Wärmezufuhr für die herzustellenden Verbundwerkstoffe<br />
zu entwickeln. Die Experten<br />
von Heraeus nutzten dafür CAE-Simulationen,<br />
Ray Tracing und Computational Fluid. Es wurden<br />
Reflexionsmessungen durchgeführt, um die<br />
Materialeigenschaften des Komposits zu ermitteln,<br />
ein Drahtgittermodell erstellt und mit Ray<br />
Tracing die Bestrahlung simuliert. So konnte für<br />
den Zielbereich ein Konzept entwickelt werden,<br />
das die geforderte Homogenität bei einem Minimum<br />
an verwendeten Strahlern gewährleistet.<br />
Nach den CAE-Arbeiten bei Heraeus wurde<br />
im NCC ein Infrarotsystem mit schnell reagierenden,<br />
mittelwelligen Infrarot-Strahlern installiert.<br />
Dieses besteht aus sechs separaten Zonen,<br />
von denen jede PID-gesteuert ist und deren<br />
Oberflächentemperatur mit einem Pyrometer<br />
gemessen wird.<br />
Das IR-System wird derzeit im NCC eingesetzt,<br />
Richard Entwistle, der Projektleiter, erklärt: „Wir<br />
waren beeindruckt von der Arbeit von Heraeus,<br />
sowohl in Bezug auf ihre CAE-Expertise als auch<br />
auf die Qualität der gelieferten Strahler.“<br />
SCHÄUMEN<br />
VAKUUM<br />
INFUSION<br />
PULTRUSION<br />
FASER<br />
WICKELN<br />
Bilder: Heraeus Noblelight<br />
www.heraeus-noblelight.com/infrared<br />
Die Erwärmung von Kompositen wird im<br />
hauseigenen Anwendungszentrum bei<br />
Heraeus Noblelight getestet<br />
Anwendungs-Videos<br />
finden Sie auf unserem<br />
YouTube Kanal<br />
https://yt.vu/+tartler<br />
TARTLER GMBH<br />
Kundenspezifische Dosier- u.<br />
Mischanlagen für Polyurethan,<br />
Silikon und Expoxidharze<br />
www.tartler.com
WERKSTOFF- & VERBINDUNGSTECHNIK<br />
NEUER SPEZIALWERKSTOFF FÜR HOHE<br />
TEMPERATUREN<br />
Dichtungshersteller C. Otto<br />
Gehrckens präsentiert seinen<br />
besonders temperaturbeständigen<br />
Hochleistungswerkstoff<br />
Vi 250. Speziell für<br />
hohe Einsatztemperaturen<br />
konzipiert, dichtet das neue<br />
FKM-Compound dauerhaft bis<br />
zu + 250 °C zuverlässig gegen<br />
Luft ab. Der Werkstoff Vi 250<br />
kommt aber nicht nur mit<br />
hohen Temperaturen zurecht: Er kann auch in kalten Umgebungen<br />
bis - 25 °C eingesetzt werden. Zudem zeigt er eine sehr gute Medienbeständigkeit<br />
und ist widerstandsfähig gegenüber Chemikalien wie<br />
etwa Kohlenwasserstoffen. Eine niedrige Gasdurchlässigkeit und die<br />
gute Beständigkeit gegen Dampf runden das Werkstoffprofil ab.<br />
www.cog.de<br />
HOCHTEMPERATURLÖTSYSTEME FÜR DIE<br />
KUPFERLACKDRAHTVERARBEITUNG<br />
Lackdrahthersteller entwickeln<br />
immer neue Produkte, die mit<br />
unterschiedlichsten, teilweise<br />
ebenfalls neu entwickelten<br />
Isolationsmaterialien versehen<br />
sind. Dadurch soll die Verbesserung<br />
der Isolationsklasse sowie die<br />
thermische Widerstandsfähigkeit<br />
für zukünftige Endprodukte verbessert werden. Eutect verfügt in<br />
seinem Modulbaukasten über alle selektiven Lötverfahren, die in<br />
der Lage sind, beschichtete Kupferlackdrähte in einem Schritt, ohne<br />
zusätzliche Entfernung der Isolierung, prozesssicher thermisch<br />
abzuisolieren. Der Hochtemperaturprozess zum Verzinnen von<br />
Eutect kann mit einem statischen Lötbad und einem dynamischen,<br />
frei programmierbaren Rakelsystem erfolgen. Dieses reduziert die<br />
Kontamination und hält die Basislegierung des Lotes konstant.<br />
Damit bleibt die Legierung über den gesamten Prozessverlauf in<br />
der ursprünglichen Zusammensetzung erhalten.<br />
www.eutect.de<br />
KOMPAKTE LED-AUSHÄRTUNGSLAMPE<br />
Delo hat eine<br />
platzsparende<br />
UV-Lampe für<br />
die Klebstoff-<br />
Aushärtung<br />
entwickelt. Die<br />
Delolux 503 ist<br />
für industrielle<br />
Klebanwendungen<br />
mit kleinen<br />
Flächen und<br />
sekundenschnellen<br />
Serienprozessen konzipiert, zum Beispiel für das Kleben von<br />
Kameras für das automatisierte Fahren. Mit einem typischen<br />
Arbeitsabstand von 15 mm belichtet sie eine Fläche von<br />
18 x 6 mm. Zudem weist die Lampe eine Besonderheit auf: Sie<br />
leuchtet schräg nach unten, wodurch sie nicht auf einer Ebene<br />
mit den zu verklebenden Bauteilen eingebaut werden muss.<br />
Dies erhöht den Bewegungsfreiraum von Achsen oder Greifern<br />
und erleichtert die Integration in komplexe Anlagen. Die<br />
Hochleistungs-Punktlichtquelle gibt es in zwei Varianten. Das<br />
Modell mit 365 nm Wellenlänge und einer Nennintensität von<br />
mehr als 1 000 mW/cm² ist für eine schnelle Klebstofffixierung<br />
in unter einer Sekunde optimiert. Die Version mit 400 nm und<br />
einer Intensität von über 1 600 mW/cm² wurde für eine<br />
optimierte Tiefenhärtung des Klebstoffs entwickelt sowie zum<br />
besseren Durchdringen schwer durchstrahlbarer Kunststoffe.<br />
www.delo.de<br />
DRUCKVERSCHRAUBUNGEN FÜR<br />
ÖL- UND GASINDUSTRIE<br />
Die Permanent-<br />
Druckverschraubungen<br />
der Serie<br />
Phastite von Parker<br />
Hannifin sind<br />
nun auch in<br />
unterschiedlichen<br />
korrosionsbeständigen<br />
Legierungen<br />
– einschließlich<br />
Alloy<br />
825, 625 und<br />
Super Duplex – sowie in neuen Größen erhältlich. Diese sind<br />
für Anwendungen in der Öl- und Gasindustrie gedacht. Die<br />
Druckverschraubungen machen das Schweißen von Rohren bis<br />
1 Zoll überflüssig. Um eine dauerhaft leckagefreie Verbindung<br />
herzustellen, muss nur das Anschlussstück auf das Rohr-Ende<br />
gesetzt und die Abdeckmutter bis zum Anschlag geschoben<br />
und festgezogen werden. Mit Handwerkzeug dauert die<br />
Installation weniger als eine Minute und stellt sicher, dass<br />
Rohre beim ersten Mal richtig verbunden sind. Die Serie sorgt<br />
für reduzierte Kontroll- und Abkühlzeiten sowie minimierte<br />
Ausfallzeiten bei Rohrreparaturen. Sie hat eine integrierte<br />
Maßtoleranzkontrolle und eine Metall-Metall-Dichtung.<br />
Geeignet ist sie u. a. für Hydrauliköl, Wasser und Glykol-<br />
Wasser-Gemische, Schmieröl sowie weitere Medien. Sie kann<br />
in Anwendungen mit Drücken von bis zu 1 380 bar und bis zu<br />
Unterwassertiefen von 15 000 Fuß eingesetzt werden.<br />
www.parker.com<br />
14 <strong>DER</strong> <strong>KONSTRUKTEUR</strong> <strong>2020</strong>/05 www.derkonstrukteur.de<br />
LIMBACH.indd 1 22.11.2017 08:28:39
WERKSTOFF- & VERBINDUNGSTECHNIK<br />
CAE-PROZESSKETTE FÜR DAS FASERWICKELN<br />
Bambusstäbe werden<br />
schon seit Jahrhunderten<br />
durch das Umwickeln<br />
mit Seilen zu<br />
stabilen und leichten<br />
Tragwerken verbunden.<br />
Am WBK Institut<br />
für Produktionstechnik<br />
des KIT Karlsruher<br />
Institut für Technologie<br />
umwickeln heute<br />
6-Achs-Roboter Hohlprofile aus Faserverbundwerkstoffen mit<br />
Carbonfasern. Das Besondere dabei ist nicht nur die Fügetechnologie<br />
an sich, sondern die durchgängige Abbildung des Prozesses<br />
in einer vollständigen CAE-Prozesskette. Durch eine grafische<br />
Benutzeroberfläche lässt sich der Vorgang des Wickelns auslegen,<br />
planen und bedienen. Dazu gehört, das Wickelmuster zu berechnen,<br />
die Verbindungen gemäß FEM auszulegen und die Bewegungen<br />
des Wickel-Roboters zu simulieren.<br />
Zu den Vorteilen des Verfahrens zählt, dass durch das Verbinden<br />
keinerlei Schäden an den Faserverbund-Profilen entstehen.<br />
Außerdem ist es besonders ressourceneffizient, da die Fasern<br />
lastpfadgerecht abgelegt werden können und so besonders<br />
wenig Material verbraucht wird.<br />
Das Fügeverfahren könnte insbesondere im Bau- und Kranwesen<br />
für besonders leichte, steife und gleichzeitig dennoch kostengünstige<br />
Fachwerkkonstruktionen sorgen. Weitere Anwendungen<br />
sind im Automobil- und Zweiradbau denkbar. Dort werden<br />
räumliche Fachwerke für Fahrgestelle als sogenannte Gitterrahmen<br />
verwendet. Das Verfahren wurde im Februar <strong>2020</strong> mit dem<br />
ThinKing-Award von Leichtbau BW ausgezeichnet.<br />
www.wbk.kit.edu<br />
www.leichtbau-bw.de<br />
WERKSTOFF FÜR DEN 3D-DRUCK VON<br />
DÄMPFUNGSELEMENTEN<br />
Ein flexibler Polymerwerkstoff für die additive Serienfertigung ist<br />
TPU 1301 von EOS. Dieses thermoplastische Polyurethan hat gute<br />
Stoßdämpfungseigenschaften und eignet sich damit u. a. besonders<br />
für Schuhe und den Automobilbau. Der Werkstoff bietet<br />
außerdem eine hohe Elastizität nach Verformung und ist sehr<br />
prozessstabil. Gleichzeitig verfügen die 3D-gedruckten Bauteile<br />
aus dem Material über eine glatte Oberfläche. Der Werkstoff<br />
eignet sich etwa für Sportsohlen, Schutzausrüstungen und<br />
Dämpfungselemente. TPU wird häufig eingesetzt, wenn Eigenschaften<br />
von Elastomeren und einfache Verarbeitbarkeit gefordert<br />
sind. Die für verschiedenste Anwendungen erforderliche Flexibilität<br />
sowie entsprechende Dämpfungseigenschaften können über<br />
die Struktur des Bauteildesigns und die verwendeten Prozessparameter<br />
angepasst werden.<br />
www.eos.info<br />
FORM- UND NORMPLATTEN AUS KUNSTSTOFF-<br />
FORMENSTAHL 1.2738 TSHH<br />
Oftmals sind Formenstähle<br />
auf die mit dem<br />
Kunststoff in Kontakt<br />
stehende Kavität<br />
konzipiert. Die für die<br />
konstruktive Formauslegung<br />
wichtigen<br />
Stahleigenschaften<br />
treten dabei häufig in<br />
den Hintergrund. Der<br />
modifizierte und vergütete Kunststoff-Formenstahl 1.2738 TSHH<br />
deckt hingegen beide Anforderungen ausgezeichnet ab: Er bietet<br />
zum einen gute Polierbarkeit bzw. beste Narbbarkeit und zum<br />
anderen besitzt er eine hohe Wärmeleitfähigkeit sowie einen<br />
hohen Verschleißwiderstand. Speziell bei Formplatten ohne<br />
Dimensionseinschränkungen, tiefen Kavitäten, hohen Kernbeanspruchungen<br />
sowie höchsten Oberflächenansprüchen eignet sich<br />
dieses Material bestens. Besonders im Automotive-Bereich, aber<br />
auch im Bereich der Konsumgüter findet dieser Stahl Verwendung.<br />
Meusburger bietet ab sofort Formplatten und Normplatten in der<br />
Materialqualität 1.2738 TSHH ab Lager an.<br />
www.meusburger.com<br />
VERBINDUNGSELEMENTE UND BEFESTIGUNGS-<br />
TECHNIK: 84 000 ARTIKEL<br />
Reyher hat seinen Katalog<br />
für Verbindungselemente<br />
und Befestigungstechnik<br />
in der aktualisierten<br />
Version herausgebracht.<br />
Der überarbeitete Katalog<br />
umfasst jetzt 84 000 Artikel<br />
und berücksichtigt die<br />
jüngsten Erweiterungen<br />
der Sortimente aus<br />
verschiedenen Anwendungsbereichen.<br />
Optimierte<br />
Artikelangaben<br />
unterstützen Einkäufer<br />
bei der Auswahl. Außerdem hat der Anbieter die technischen<br />
Informationen zu den Artikeln erweitert. Diese liefern Anwendern<br />
Know-how und Entscheidungshilfen. Der Katalog kann ab sofort<br />
bei dem Händler angefordert werden und steht außerdem als<br />
PDF-Version auf der Website (www.reyher.de) kostenlos zum<br />
Abruf bereit. Das Sortiment des Handelsunternehmens gehört<br />
mit insgesamt über 130 000 Artikeln am Lager zu den breitesten<br />
und tiefsten der Branche. Dazu kommt ein umfangreiches<br />
Dienstleistungsangebot rund um die C-Teile-Versorgung.<br />
www.reyher.de
KERAMIK<br />
TOP IN FORM<br />
PRODUKTE UND ANWENDUNGEN<br />
Die Möglichkeiten technischer Keramik sind noch<br />
immer nicht vollständig bekannt. Es kursieren die<br />
Annahmen, der Werkstoff sei teuer und breche<br />
leicht, sei zu temperaturempfindlich oder es<br />
könnten nur simple Formen hergestellt werden.<br />
Tatsächlich ist technische Keramik äußerst<br />
vielfältig und kann, wenn sie mit der passenden<br />
Fertigungstechnologie – wie z. B. dem<br />
Spritzgussverfahren – in Form gebracht wird, ein<br />
gleichwertiger oder gar besser geeigneter Ersatz<br />
für Metall oder Kunststoff sein.<br />
Sembach Technical Ceramics ist, wie der Name schon vermuten<br />
lässt, Spezialist für die Entwicklung, Herstellung und Veredelung<br />
hochwertiger Komponenten aus technischer Keramik<br />
und das seit über 100 Jahren. Mit modernen Fertigungsverfahren<br />
wie der Spritzgusstechnologie realisiert das familiengeführte Unternehmen<br />
auch komplexe Geometrien oder Mikroteile.<br />
Folgende grundlegenden Eigenschaften technischer Keramik<br />
prädestinieren den Werkstoff für zahlreiche hochtechnologische<br />
Anwendungen beispielsweise im Automotive-Bereich, in der<br />
Medizingerätetechnik oder im Maschinen- und Anlagenbau:<br />
n ausgezeichnete Temperaturbeständigkeit (bis 1 800 ° C)<br />
n sehr gute Verschleiß- und Korrosionseigenschaften<br />
n hohe bis sehr hohe Festigkeiten<br />
n hervorragende Härte (bei Aluminiumoxid nahezu<br />
ähnlich wie Diamant)<br />
n elektrische Isolation<br />
n thermische Isolation bzw. hohe thermische Leitfähigkeit<br />
n Formstabilität (auch bei hohen Temperaturen)<br />
n Feuerfestigkeit<br />
n Alterungsbeständigkeit<br />
n Biokompatibilität<br />
DAS PASSENDE FORMGEBUNGSVERFAHREN<br />
Der initiale Aufwand für die Herstellung eines Produkts aus Keramik<br />
ist tatsächlich manchmal höher als bei gewohnten Werkstoffen aus<br />
Metall oder Kunststoff. Im Produktionsprozess zeigt sich dann<br />
jedoch häufig, dass der integrale Aufwand wesentlich geringer und<br />
die Keramik in der Herstellung insgesamt günstiger, weil länger<br />
haltbar ist. Ein kleiner Überblick über die Formgebungsverfahren<br />
zeigt, welches Spektrum an Bauteilen und Anwendungen mit technischer<br />
Keramik möglich ist:<br />
EXTRUSION<br />
Achssymmetrische keramische Bauteile wie Rohre, Stäbe oder<br />
Profile lassen sich im Extrusionsverfahren herstellen. Zur Extrusion<br />
benötigt man eine bildsame oder plastische Arbeitsmasse mit einer<br />
16 <strong>DER</strong> <strong>KONSTRUKTEUR</strong> <strong>2020</strong>/05 www.derkonstrukteur.de
WERKSTOFF- & VERBINDUNGSTECHNIK<br />
Arbeitsfeuchte von ca. 15 bis 25 %. Die eigentliche Formgebung<br />
erfolgt mittels Vakuumschneckenextruder oder Kolbenstrangpresse,<br />
indem die plastische Masse durch ein formgebendes Mundstück<br />
gedrückt wird.<br />
TROCKENPRESSEN<br />
Das Trockenpressen ist ein zweiseitig axiales Pressverfahren. Komplexe<br />
Formen sind nur auf der Unterseite ausführbar. Beim uniaxialen<br />
Trockenpressen wird entweder durch einseitige Bewegung<br />
eines Stempels oder zweiseitige Bewegung von Ober- und Unterstempel<br />
eine Pulver- oder Granulatschüttung verdichtet. Das Verfahren<br />
eignet sich ausgezeichnet für die Großserienproduktion.<br />
Einsetzbar sind nahezu alle keramischen Werkstoffe.<br />
UM DIE IDEEN <strong>DER</strong> KONSTRUK-<br />
TEURE KERAMIKGERECHT UM-<br />
ZUSETZEN, IST EINE MÖGLICHST<br />
FRÜHE EINBINDUNG <strong>DER</strong><br />
KERAMIKHERSTELLER SINNVOLL<br />
KERAMISCHER SPRITZGUSS<br />
Dank des Spritzgussverfahrens (CIM = Ceramic Injection Moulding)<br />
erhalten Entwickler und Konstrukteure mehr Spielraum bei der<br />
Gestaltung von keramischen Bauteilen höchster Festigkeit, höchster<br />
Zähigkeit und bester Oberflächenqualität. Da die Prozesssicherheit<br />
des CIM sehr hoch ist, können auch hochwertige und damit hochpreisige<br />
Rohmaterialien uneingeschränkt verarbeitet werden. Die<br />
Kombination der sicheren Formgebungsmethodik mit der werkstoffbedingt<br />
hohen Festigkeit der Formteile, die entsprechend mechanisch<br />
belastbar sind, verschafft dem CIM einen deutlichen Vorteil gegenüber<br />
anderen Formgebungsmethoden. Zunächst wird beim CIM eine<br />
Arbeitsmasse, der sogenannte Feedstock, durch Zugabe ausgeklügelter<br />
organischer Bindersysteme hergestellt. Die einzelnen chemischen<br />
Komponenten dieses Bindersystems müssen gewährleisten, dass<br />
durch Erhitzen des Feedstocks in der Spritzgussmaschine das Material<br />
ausreichend fließfähig wird und so unter hohem Druck in eine oder<br />
Mehrfachkavitäten eingespritzt werden kann. Darüber hinaus muss<br />
der Rohling in der Form wieder erstarren und ausreichende Festigkeit<br />
für das weitere Handling außerhalb der Maschine aufweisen.<br />
Die präzise Einstellung der Fließfähigkeit des keramischen Feedstocks<br />
über das Bindersystem ermöglicht eine hohe Prozesssicherheit<br />
bei der Formgebung. Es wird beim Füllen der Kavität immer<br />
dieselbe Menge Material eingespritzt, sodass eine gleich bleibende<br />
Verdichtung gewährleistet ist. Dies führt dazu, dass die Toleranzen<br />
auf ein Minimum eingegrenzt werden können. Unter Sintern ist die<br />
abschließende Temperaturbehandlung zu verstehen, bei der aus<br />
den Rohstoffen erst der eigentliche keramische Werkstoff entsteht.<br />
Dieser Prozess ist mit einem Schrumpfen des Bauteiles von bis zu<br />
50 Vol.-% verbunden. Auf diesem Weg lassen sich keramische Bauteile<br />
in einem hochautomatisierten Prozess extrem präzise fertigen.<br />
MIKROSPRITZGUSS<br />
Sobald Bauteile besonders winzig und filigran sein müssen, wie<br />
z. B. in der Medizingerätetechnik, ist der Mikrospritzguss das geeignete<br />
Fertigungsverfahren, das bisher in der technischen Keramik<br />
eher selten zur Anwendung kommt. Sembach bietet das Verfahren<br />
an, um Kleinstkomponenten mit einem Gewicht zwischen 0,01 und<br />
0,5 g, wie Spitzen für Endoskope für minimalinvasive Eingriffe oder<br />
Werkzeuge für Miniaturbauteile, zu fertigen. Mikrospritzguss unterscheidet<br />
sich zum klassischen Spritzguss durch eine sehr kleine<br />
Einspritzeinheit, die anstelle der normal großen Einheit in der<br />
Spritzgussmaschine integriert ist. Diese Einspritzeinheit basiert auf<br />
einer anderen Technik. Es handelt sich um eine Kolbenpresse mit<br />
Miniaturkolben, der sehr geringe Materialmengen befördern kann.<br />
Wichtig ist dabei die Überwachung des Prozesses, die bei Mikrospritzguss<br />
auf einer normalen Spritzgussmaschine nicht zu leisten<br />
wäre. Die Auflösung ist zu grob, um Einspritzdrücke, Spritzvolumen<br />
etc. zu messen. Mit der kleinen Einspritzeinheit ist es möglich, die<br />
minimalen Kolbenbewegungen wieder zu skalieren und damit diese<br />
Kleinstmengen zu messen und zu überwachen. So gewährleistet<br />
Sembach die Prozesssicherheit für die Mikroteile.<br />
KERAMIKGERECHTE KONSTRUKTION<br />
Der Keramikspritzguss trägt dazu bei, dass Werkstoffe wie Metall<br />
und Kunststoff in Anwendungen substituiert werden können. Deshalb<br />
ist es sinnvoll, dass eine möglichst frühe Einbindung der<br />
Keramikhersteller in die Entwicklung der Bauteile erfolgt, um die<br />
Ideen der Konstrukteure keramikgerecht umzusetzen. So kann<br />
beispielsweise gezielt auf die spezifischen Eigenschaften des keramischen<br />
Materials und deren wirtschaftliche Auswirkungen im für<br />
das Bauteil passenden Produktionsprozess eingegangen werden.<br />
Bilder: Sembach Technical Ceramics<br />
www.sembach.de<br />
01 Keramischer Spritzguss bietet Konstrukteuren gegenüber anderen<br />
Formgebungsverfahren die größten gestalterischen Freiheiten<br />
02 Komplexe Geometrien wie ein Trägerkörper für Potentiometer,<br />
können ohne Gratbildungen mit Keramikspritzguss realisiert werden<br />
03 Im Mikrospritzguss gefertigt: eine Endoskopspitze für<br />
minimalinvasive Eingriffe<br />
01 02 03
TITELSTORY<br />
KONSTRUKTIONSELEMENTE<br />
EFFIZIENT, EFFIZIENTER, …<br />
PRODUKTE UND ANWENDUNGEN<br />
Grundsätzlich muss eine moderne Stromversorgung eines leisten: Eine<br />
Wechselspannung in eine galvanisch sicher getrennte Gleichspannung wandeln.<br />
Und das soll sie möglichst effizient tun. Aber was braucht eine Stromversorgung, um<br />
maximal effizient zu sein? Und welcher Zusammenhang besteht zum Wirkungsgrad<br />
und der Baugröße? Eine kompakte High-End-Stromversorgung liefert Antworten.<br />
Autorin: Lena Kalmer, Communication Manager, WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG, Minden<br />
18 <strong>DER</strong> <strong>KONSTRUKTEUR</strong> <strong>2020</strong>/05 www.derkonstrukteur.de
KONSTRUKTIONSELEMENTE<br />
Welche ökonomischen und ökologischen Aspekte gilt<br />
es, bei der Auswahl der Stromversorgung im Blick zu<br />
haben? Welche Bedeutung hat ein hoher Wirkungsgrad?<br />
Und welche weiteren Anforderungen sollte ein<br />
modernes Netzgerät erfüllen? Wago hat sich mit diesen Fragen<br />
auseinandergesetzt und mit der Stromversorgung Pro 2 eine neue<br />
Lösung geschaffen, die den aktuellen und zukünftigen Anforderungen<br />
des Markts gerecht wird.<br />
EFFIZIENZ ALS KERNELEMENT<br />
Die Vielfalt der Stromversorgungen am Markt spiegelt die unterschiedlichen<br />
Einsatzgebiete und Applikationen wider. Wettbewerb<br />
ist gut für den Anwender, denn so kann er die für seine Applikation<br />
passende Stromversorgung auswählen. Effizienz und damit einhergehend<br />
ein hoher Wirkungsgrad können hierbei ein entscheidender<br />
Wettbewerbsvorteil sein. Damit verbunden ist eine geringere<br />
Verlustleistung und eine niedrigere Erwärmung im Schaltrank.<br />
Das Ergebnis? Weniger Systemkosten und eine höhere Lebensdauer<br />
des Netzteils für den Nutzer. Aber nicht nur die Total Cost of<br />
Ownership können durch einen höheren Wirkungsgrad reduziert<br />
werden, sondern auch ökologische Aspekte, wie die Einsparung<br />
von CO 2<br />
und die Wärmeverlustleistung im Schaltschrank spielen<br />
hierbei eine große Rolle. Wie genau, demonstriert die neue Wago<br />
Stromversorgung Pro 2.<br />
ERFOLGSFAKTOR DESIGN<br />
Die Anforderung der Anwender sind breit gefächert hinsichtlich<br />
Preis, Wirkungsgrad, Spannungsbereiche und Einstellbarkeit sowie<br />
Baugröße. Diese widersprechen sich zum Teil und sind somit<br />
Herausforderungen bei der Entwicklung eines Netzgeräts.<br />
Bereits bei der Auswahl der Topologie des Schaltnetzgeräts<br />
werden wichtige Weichen hinsichtlich Wirkungsgrad und Kosten<br />
gestellt. Zu den derzeit effizientesten und wirtschaftlichsten<br />
Topologien zählen die „soft“-schaltenden Resonanzwandler, bei<br />
denen die Verluste durch Schalten im Nulldurchgangspunkt<br />
verringert werden.<br />
Durch Kombination mit aktiver Synchrongleichrichtung und<br />
einer aktiven Leistungsfaktorkorrektur werden die Verluste weiter<br />
reduziert. Die Entwicklung eines eigenen, für jedes Netzgerät<br />
angepassten Übertragers sorgt für hohe Effizienz, Zuverlässigkeit<br />
und Baugrößenreduzierung. Und auch die Auswahl der Bauteile<br />
erfolgt unter den Gesichtspunkten Effizienz sowie Kostenoptimierung.<br />
LANGE LEBENSDAUER<br />
Durch die verlustarme Schaltungstechnik wird gewährleistet, dass<br />
die Bauelemente einem geringeren thermischen Stress ausgesetzt<br />
sind. Das steigert deren Lebenserwartung deutlich, insbesondere<br />
bei wärmeempfindlichen Kondensatoren oder Halbleitern. Es ergeben<br />
sich so sehr gute Werte in der Berechnung von MTBF (Mean Time<br />
Between Failures) sowie Cap-Lifetime.<br />
Anwendungen im 24/7-Dauerbetrieb, wie beispielsweise in<br />
Gebäuden, profitieren davon durch zuverlässige Versorgung. Dies<br />
ist besonders wichtig, wenn Geräte durch Verbau in Systemverteilern<br />
in Zwischendecken nur schwer erreichbar sind. Weitere Beispiele<br />
für Anwendungen im 24/7-Betrieb sind beispielsweise in der<br />
Produktion chemischer Erzeugnisse, auf Mautbrücken oder in<br />
Ortsnetzstationen zu finden.<br />
01 Das optional steckbare Kommunikations-Interface, die IO-Link-Schnittstelle<br />
und Konfigurationsmöglickkeiten der neuen Stromver sorgung Pro 2<br />
können den Anwender schon heute ins digitale Zeitalter bringen<br />
VERLUSTLEISTUNGSKOSTENRECHNER<br />
Wieviel der Einsatz der Stromversorgung Pro 2 in ihrer<br />
Anwendung einsparen kann, das können Konstrukteure jetzt<br />
ganz leicht herausfinden – mit dem Wago-Verlustleistungskostenrechner.<br />
Er steht online unter: wago.com/vlkr.<br />
„Lange Lebensdauer, höchste Effizienz, kleinste Baugröße und<br />
dadurch maximal reduzierte Betriebskosten. Das sind direkte Vorteile<br />
für unsere Kunden und auch für die Anlagenbetreiber – vom<br />
ersten Tag des Einsatzes an“, sagt Klaus Böhmer, BU-Leiter Interface<br />
Electronics bei Wago.<br />
DIE GRÖSSE ZÄHLT<br />
Durch den hohen Wirkungsgrad können die Verlustleistung und<br />
Dimensionen deutlich reduziert werden. Die Implementierung der<br />
Pro 2 senkt somit die Kosten für die Kühlung, außerdem wird der<br />
Platzbedarf im Schaltschrank minimiert. So fallen die Abstände<br />
www.derkonstrukteur.de <strong>DER</strong> <strong>KONSTRUKTEUR</strong> <strong>2020</strong>/05 19
KONSTRUKTIONSELEMENTE<br />
02<br />
links und rechts zu anderen Komponenten geringer aus, und durch<br />
die steckbare Anschlusstechnik wird der für die optimale Kühlung<br />
benötigte Abstand nach oben und unten automatisch eingehalten.<br />
Außerdem wird die Installation deutlich vereinfacht. In einigen Fällen<br />
kann sogar der Schaltschrank verkleinert werden, was zu zusätzlichen<br />
Kosteneinsparungen führt.<br />
„Wir haben bei unseren Netzgeräten den Anspruch, uns durch<br />
eine hohe Effizienz und Zuverlässigkeit von anderen Anbietern am<br />
BEREITS BEI <strong>DER</strong> AUSWAHL <strong>DER</strong><br />
TOPOLOGIE DES SCHALTNETZGERÄTS<br />
WERDEN WICHTIGE WEICHEN<br />
HINSICHTLICH WIRKUNGSGRAD<br />
UND KOSTEN GESTELLT<br />
Markt zu differenzieren. Das heißt konkret: Weniger Verlustleistung<br />
sowie eine höhere Packungsdichte für den Schaltschrankbau“ sagt<br />
Klaus Böhmer, BU-Leiter Interface Electronics bei Wago.<br />
PRODUKTE UND ANWENDUNGEN TITELSTORY<br />
02 Der hohe Wirkungsgrad sorgt für platzsparende Abmessungen;<br />
ein einheitliches Gehäusedesign und ein digitaler Zwilling<br />
machen die Implementierung sehr einfach<br />
03 Ein typischer Wirkungsgrad bei einem einfachen Netzgerät mit<br />
960 W Nennleistung beträgt 91 %, bei der neuen Pro-2-<br />
Stromversorgung liegt der Wirkungsgrad bei 96,3 %<br />
KLEINER UNTERSCHIED, GROSSE WIRKUNG<br />
Gering erscheinende Unterschiede in den technischen Daten können<br />
große Auswirkungen haben. Wieso, zeigen wir anhand eines kleinen<br />
Beispiels: Ein typischer Wirkungsgrad bei einem einfachen Netzgerät<br />
mit 960 W Nennleistung beträgt 91 %. Bei der neuen Pro-2-Stromversorgung<br />
liegt der Wirkungsgrad bei 96,3 %. Auf den ersten Blick scheinen<br />
diese 5,3 Prozentpunkte nicht gerade viel zu sein – aber genau auf sie<br />
kommt es an: Dieser bessere Wirkungsgrad der Pro-2-Netzgeräte<br />
03<br />
20 <strong>DER</strong> <strong>KONSTRUKTEUR</strong> <strong>2020</strong>/05 www.derkonstrukteur.de
escha.net<br />
DIE EINSPARPOTENZIALE<br />
WERDEN UNTERSCHÄTZT<br />
Die enormen Einsparpotenziale durch eine<br />
moderne Stromversorgung werden oftmals unterschätzt.<br />
Das zeigen erste Gespräche mit unseren<br />
Kunden. Die Reduktion der Verlustleistungskosten<br />
in Euro und die CO 2<br />
-Einsparungen durch die Pro 2<br />
sind deutlich höher, als vom Kunden zunächst<br />
angenommen.<br />
FLORIAN KOTHE, Business Development Manager<br />
Interface, WAGO, Minden<br />
spart 37 W an Verlustleistung. Auf eine Betriebszeit von fünf Jahren<br />
gerechnet bedeutet dies eine Einsparung von 209 EUR an Energiekosten<br />
und gleichzeitig eine Einsparung von 1 t CO 2<br />
. Zum Vergleich:<br />
Eine 80-jährige Buche mit 23 m Wuchshöhe hat in ihrem<br />
Leben 1 t CO 2<br />
gespeichert – bei mehreren hundert Netzgeräten in<br />
einer Produktionsstraße wäre das also schon ein ganzer Wald.<br />
Man sieht: kleiner Unterschied, große Wirkung!<br />
BIS 60 °C OHNE <strong>DER</strong>ATING<br />
Bei Anwendungen ohne Klimatisierung muss der Konstrukteur<br />
Derating-Kurven einzelner Komponenten beachten. Ein Schaltschrank<br />
im Außenbereich kann eine Innentemperatur von 60 °C<br />
und mehr erreichen. Nicht alle Komponenten im Schaltschrank<br />
können bei diesen hohen Temperaturen die Nennleistung abgeben.<br />
Die Dearting-Kurven geben hier Aufschluss auf die notwendige<br />
Leistungsreduzierung in Abhängigkeit von der Temperatur.<br />
Nicht so bei den neuen Wago-Stromversorgungen Pro 2, die<br />
ohne Derating bis 60 °C zu betreiben sind und bei 70 °C mit 70 %<br />
Auslastung betrieben werden können.<br />
Anschlusstechnik für<br />
Roboterapplikationen<br />
PROFINET Anschlusstechnik<br />
für Robotik<br />
Sensor-/Aktorleitungen<br />
Maximale Biegewechsel & Torsion<br />
Höchste Verfügbarkeit in<br />
dynamischen Anwendungen<br />
Bilder: Aufmacher Hintergrund: liuzishan – stock.adobe.com, Sonstige: WAGO<br />
www.wago.com
MENSCHEN UND MÄRKTE<br />
TRENDS<br />
bei Energieführungssystemen<br />
Autor: Peter Sebastian Pütz, Head of Market /Product/Development, Head of Crane<br />
Business, TSUBAKI KABELSCHLEPP GmbH, Wenden
NACHHALTIGKEIT IN <strong>DER</strong> FERTIGUNG<br />
UND BEI DEN MATERIALIEN<br />
Warum nachhaltiges Wirtschaften immer wichtiger wird, liegt auf der Hand. Die<br />
Nachhaltigkeit in der Produktion umfasst idealerweise alle Schritte von der Planung<br />
über die Verarbeitung der Materialien bis zur Entsorgung und darüber hinaus.<br />
Die möglichen Maßnahmen sind vielfältig: Zum Beispiel können Produktionsabfälle<br />
aus der Kunststoffkettenproduktion zu Regranulat verarbeitet und in den Produktionskreislauf<br />
zurückgeführt werden. Auch Stahlkettensysteme sind recyclefähig. Darüber<br />
hinaus kann ein modularer Aufbau von Produktprogrammen dazu beitragen, dass<br />
weniger Materialien vorgehalten werden müssen als bei klassischen Einzel- und<br />
Sonderanfertigungen – das spart Platz bei der Lagerhaltung und reduziert das Risiko<br />
nicht verwertbarer Restmengen. Tsubaki Kabelschlepp nutzt all diese Methoden und<br />
forscht am Einsatz von Kunststoffen aus nachwachsenden Rohstoffen.<br />
INDUSTRIE 4.0 – NEUE MÖGLICHKEITEN <strong>DER</strong><br />
PROZESSSTEUERUNG UND -ÜBERWACHUNG<br />
Auch bei Energieketten kommt Industrie 4.0 ins Spiel. Denn die Digitalisierung<br />
eröffnet auch hier neue Möglichkeiten der Prozesssteuerung und -überwachung.<br />
Mit ihrer Hilfe lassen sich die Zug- und Schubkräfte überwachen, die auf die<br />
Energiekettensysteme wirken oder es lässt sich eine Verschleißprognose bei<br />
Gleitschuhen erstellen. Möglich wird dies z. B. mit einem standardisierten<br />
Hut schienenmodul von Tsubaki Kabelschlepp.<br />
ERWEITERTE SYSTEMKONZEPTE –<br />
ALLES AUS EINER HAND<br />
Turnkey-Konzepte sind gefragt. Im Rahmen dieser schlüsselfertigen Lösungen<br />
bekommen Kunden alle Leistungen aus einer Hand. Erweiterte Systemkonzepte<br />
umfassen nicht nur die reine Auftragsbearbeitung, sondern auch im Vorfeld die<br />
Planung und im Nachhinein Wartung und Service. Vom einfachen System bis zur<br />
komplexen Anlage – im Idealfall deckt, wie bei Tsubaki Kabelsschlepp, ein maßgeschneidertes<br />
Konzept mit den passenden Systemen und Materialien alles ab.<br />
Anwender erhalten darüber hinaus umfassenden Support, sodass die Anlage<br />
unmittelbar nach Lieferung und Montage in Betrieb gehen kann.<br />
BRANCHENSPEZIFISCHE LÖSUNGEN<br />
Große Verfahrwege, Abriebfestigkeit, Seewasserbeständigkeit: Die Anforderungen,<br />
die an Energieketten in der Intralogistik gestellt werden, unterscheiden sich<br />
mitunter deutlich von denen, die in der Medizin- und Reinraumtechnik oder in<br />
der Kran-Industrie gelten. Deshalb sind branchenspezifische Lösungen angesagt.<br />
Sie werden bei Tsubaki Kabelschlepp speziell auf die Bedürfnisse der verschiedenen<br />
Industrien zugeschnitten, auch Vertrieb und Marketing sind jeweils auf die<br />
Branchen abgestimmt.<br />
BAUKASTENSYSTEME: STANDARDISIERUNG<br />
BEI MAXIMALER FLEXIBILITÄT<br />
Baukastensysteme ermöglichen maßgeschneiderte Lösungen für jede Applikation.<br />
Standardisierte Einzelteile als kleinste Einheit lassen größtmögliche Flexibilität bei<br />
der Gestaltung und bei den Einsatzbereichen der Energiekettensysteme zu. Für jede<br />
Anwendung steht das passende Material – ob Kunststoff, Stahl oder Hybrid – bereit.<br />
Nebeneffekte standardisierter Einzelteile sind Liefertreue, ein hohes Maß an Qualität<br />
und Nachhaltigkeit (siehe 1).<br />
Bilder: 1: RFsole – stock.adobe.com, 2: Moonnoon – stock.adobe.com, 3 - 5: Kabelschlepp<br />
www. tsubaki-kabelschlepp.com<br />
www.derkonstrukteur.de <strong>DER</strong> <strong>KONSTRUKTEUR</strong> <strong>2020</strong>/05 23
KONSTRUKTIONSELEMENTE<br />
EIN LEICHTGEWICHT<br />
FÜR ALLE FÄLLE<br />
PRODUKTE UND ANWENDUNGEN<br />
Maschinenkomponenten in der Industrie<br />
werden immer kleiner, die Modularisierung<br />
schreitet voran. Antriebe und Sensorik sind<br />
zunehmend dezentral angeordnet und auch die<br />
Schnittstellen müssen sich an die veränderten<br />
Anforderungen anpassen. Eine Antwort auf<br />
den Trend bietet eine Steckverbinder-Reihe,<br />
die klein, leicht und flexibel ist.<br />
Die neue Steckverbinder-Reihe Han 1A stellt sich den Herausforderungen<br />
der Miniaturisierung. Die kompakten Steckverbinder<br />
ermöglichen leistungsfähige und wirtschaftliche<br />
Verbindungslösungen auf minimalem Bauraum – und<br />
werden damit den Anforderungen der Industrie 4.0 gerecht. Der<br />
einfache Aufbau, die Leichtigkeit sowie vielfältiges Zubehör beschleunigen<br />
die Montage und Vernetzung intelligenter Endgeräte.<br />
Die Rechtecksteckverbinder eignen sich besonders für die Installation<br />
Autor: Maximilian Tischler, Product Manager Han Connectors,<br />
HARTING Electric GmbH & Co. KG, Espelkamp<br />
dezentraler Verbraucher, ermöglichen ein modulares Design und<br />
unterstützt die Miniaturisierung. Tatsächlich benötigen sie bis zu<br />
30 % weniger Bauraum als der bisher kleinste Rechtecksteckverbinder<br />
im Harting-Portfolio, der Han 3A.<br />
Das Maschinen-Design gewinnt durch den modularen Han 1A<br />
an Flexibilität. Je nach Bedarf sind Einsätze sowohl im geschützten<br />
Bereich, z. B. als Schnittstelle in Schaltschränken oder Maschinen,<br />
als auch in rauer Industrieumgebung möglich. Vielfältige Konfigurationen<br />
gewährleisten eine zuverlässige Übertragung von Daten<br />
(Geschwindigkeit 10 Gbit/s), Signalen (bis 12 Kontakte) und/oder<br />
Leistungen (bis 16 A/400 V).<br />
BESON<strong>DER</strong>E KONSTRUKTION<br />
Die Vielseitigkeit des Steckverbinders beruht auf seiner besonderen<br />
Konstruktion: Isolierkörper und Gehäuse bilden beim Han 1A eine<br />
Einheit, die sich per Clip oder Bügel verriegeln lässt. Mithilfe von<br />
Einzeladerdichtmatten und Gehäuseelementen lässt sich das System<br />
schrittweise aus einer IP20- in eine IP65-Lösung verwandeln – und<br />
damit individuell auf eine Applikation zurechtschneiden. Durch die<br />
Möglichkeit, aus nur wenigen Grundelementen eine ganze Bandbreite<br />
an Schnittstellen zu entwickeln, ergeben sich für den Anwender<br />
erhebliche Vorteile: Erstens sinken die Kosten für die Bevor ratung<br />
durch die geringere erforderliche Lagerfläche. Zweitens gewinnt<br />
der Anwender Flexibilität, um auf spezifische Kunden anforderung<br />
reagieren zu können.<br />
24 <strong>DER</strong> <strong>KONSTRUKTEUR</strong> 5/<strong>2020</strong>
KONSTRUKTIONSELEMENTE<br />
Eine weitere Besonderheit des Han-1A-Systems ist, dass sich<br />
Isolierkörper und Zubehör werkzeugfrei montieren lassen. Dies<br />
beschleunigt die Inbetriebnahme von Maschinen und Fertigungssystemen,<br />
was wiederrum Zeit und Kosten spart. Die Balance zwischen<br />
Sparsamkeit und möglichst großer Flexibilität hält auch die<br />
Ausstattung mit Anschlusstechniken: Es gibt Schraubanschlüsse<br />
für die schnelle und einfache Feldkonfektionierung sowie Crimpkontakte<br />
für die Konfektionierung im größeren Maßstab.<br />
IM MASCHINENBAU ZUHAUSE<br />
Naheliegend ist der Einsatz des Han 1A in Maschinenbau, Robotik<br />
und Automation, in der Energieerzeugung und -verteilung sowie im<br />
Schienenfahrzeugbau. Der Steckverbinder ermöglicht den effizienten<br />
Anschluss von Werkzeugen und Modulen wie Heiz- und Kühlaggregaten,<br />
Ventilatoren, Steuerungsterminals, Beleuchtungen und<br />
Vibrationsförderern. Er ist äußerst robust und resistent gegen Stöße<br />
und Vibrationen, wodurch sich unter anderem das Risiko von<br />
Maschinenausfällen verringert.<br />
Fördersysteme sind ein ideales Anwendungsfeld. Auch die Komponenten<br />
dieser Systeme werden zunehmend kleiner, daran müssen<br />
sich die Schnittstellen anpassen. In aktuellen Anwendungen kann<br />
es vorkommen, dass Steckverbinder eingesetzt werden, die größer<br />
<strong>DER</strong> KOMPAKTE RECHTECK-<br />
STECKVERBIN<strong>DER</strong> ERMÖGLICHT<br />
LEISTUNGSSTARKE VERBINDUNGEN<br />
AUF KLEINSTEM RAUM<br />
sind als der angeschlossene Motor. Harting präsentiert mit dem<br />
Han 1A eine zugleich passgenaue und flexible Lösung.<br />
Ähnliches gilt für die Robotik: Große Stückzahlen werden vor<br />
allem im Pick & Place-Segment benötigt. Immer geringere Lasten<br />
und leichtere Antriebskomponenten stehen für den Trend. Entsprechend<br />
weniger Leistung muss transportiert werden. Dem wird<br />
der Han 1A mit seinem Leistungsbereich und dem rechteckigen<br />
Format gerecht. Darüber hinaus lassen sich nahezu unbegrenzt<br />
weitere Anwendungsmöglichkeiten finden: für den kostengünstigen<br />
Anschluss von Motoren ebenso wie für den Aufbau von Daten- und<br />
Signal-Schnittstellen für Steuerungen oder Sensoren.<br />
Bilder: Harting, Feder: Zbyszek Nowak – stock.adobe.com<br />
www.harting.com<br />
Der Steckverbinder ist robust und resistent gegen Stöße und Vibrationen<br />
5
ANTRIEBSTECHNIK<br />
LINEARTECHNIK AUF NEUEM LEVEL<br />
PRODUKTE UND ANWENDUNGEN<br />
Die eigene Produktion schnell umstellen zu können,<br />
wird in Zeiten steigender Unsicherheiten für viele<br />
Unternehmen zum entscheidenden Kriterium.<br />
Das sollten auch Konstrukteure bedenken.<br />
Lösungen müssen einfach und schnell adaptierbar<br />
sein und sich ebenso schnell in Betrieb nehmen<br />
lassen. Die Digitalisierung auch vermeintlich rein<br />
mechanischer Komponenten wie der Lineartechnik<br />
hilft bei der technischen Umsetzung.<br />
Die Grundlagen für die Evolution der Lineartechnik hat Bosch<br />
Rexroth frühzeitig gelegt. So bietet das Unternehmen bereits<br />
heute eine ganze Palette digitaler Engineering-Tools und<br />
Konfiguratoren, mit denen die Auslegungsprozesse grundlegend<br />
vereinfacht werden. Doch das ist erst der Anfang. Die digitale<br />
Transformation ist für den Spezialisten für Antriebs- und Steuerungstechnologien<br />
ein Prozess, der kontinuierlich weitergeführt wird – und<br />
mit dem er die Lineartechnik jetzt auf ein neues Level heben will.<br />
NUR MECHANIK?<br />
Bosch Rexroth will zeigen, dass Lineartechnik auch als vermeintlich<br />
rein mechanische Technologie in der Fabrik der Zukunft ganz neue<br />
Möglichkeiten eröffnet. Auf Grundlage seines Produktprogramms<br />
bringt der Hersteller zusätzliche Intelligenz in die Lineartechnik.<br />
Angefangen von der vertikalen Integration mit Zusatzfeatures wie<br />
Software und Elektronik, bis hin zum gezielten Einsatz von Sensorik<br />
in seinen Lineartechnik-Komponenten. Ein erstes Lösungspaket<br />
dazu ist seit letztem Jahr auf dem Markt. Mit dem Smart Function<br />
Kit für Press- und Fügeanwendungen bekommt der Anwender einen<br />
modularen Baukasten aus Mechanik, Elektrik und Software als<br />
Subsystem. Eine Besonderheit ist dabei die intuitive Inbetriebnahme<br />
und Prozesskonfiguration. Für beides sind keine Programmierkenntnisse<br />
notwendig. Auch im späteren Betrieb kann die Software<br />
ohne Vorkenntnisse sofort intuitiv bedient werden.<br />
Autor: Dr. Ulf Lehmann, Leiter Geschäftsbereich Linear<br />
Motion Technology, Bosch Rexroth AG, Lohr a.M.<br />
VON FLEXIBILITÄT ZU WANDLUNGSFÄHIGKEIT<br />
Bei der Entwicklung der neuen Plattform für smarte mechatronische<br />
Lösungen standen die Bedürfnisse der Anwender im Fokus.<br />
Ziel war es, für jeden Prozessschritt die passende Lösung zu bieten.<br />
Das beginnt bereits bei der Produktauswahl und Auslegung: Der<br />
Anwender soll sich nicht erst aufwändig in die Technologie einarbeiten,<br />
sondern er realisiert seine Idee durch die Tools intuitiv in<br />
wenigen Schritten zur fertigen Konstruktion.<br />
Bei der Inbetriebnahme lautet das Credo „Plug-and-produce“, in<br />
Anlehnung an das Prinzip Plug-and-play, das vor allem aus dem<br />
Consumer-Bereich bekannt ist. In der Praxis bedeutet das z. B. im<br />
Fall von Linearachsen: Auspacken, anschließen und in nur wenigen<br />
Minuten kann der Funktionstest erfolgen.<br />
Im Betrieb selbst geht Rexroths Vision hin zu anpassbaren – und<br />
damit wandelbaren Handlingsystemen, die sich flexibel den neuen<br />
Produktionsprozessen anpassen. Konkrete Anwendung findet dieser<br />
Ansatz unter anderem beispielhaft mit einem Schnellwechselsystem<br />
für Linearachsen, die durch nur zwei Klicks einfach getauscht<br />
werden können, sich anschließend wieder selbst in Betrieb<br />
nehmen und umgehend bereit für neue Aufgaben sind.<br />
Der schnelle Wechsel einzelner Komponenten wirkt sich im<br />
letzten Schritt auch auf die Instandhaltung aus: Steht eine Linearachse<br />
zum Service an, kann der Techniker heute direkt ein Austauschexemplar<br />
einsetzen, sodass die Maschine ohne Stillstände<br />
weiterarbeiten kann. Zusätzlich eröffnen Sensoren die Möglichkeit,<br />
Predictive Maintenance und Condition Monitoring aktiv für<br />
die Verbesserung der Anlageneffizienz zu nutzen. Zur Anlageneffizienz<br />
tragen daneben auch völlig neue Produktansätze bei:<br />
So zum Beispiel ein nachrüstbares Ausgleichselement, mit dem<br />
sich die Positioniergenauigkeit von Robotern und kartesischen<br />
Systemen einzigartig verbessern lässt.<br />
Bild: Bosch Rexroth<br />
www.boschrexroth.com<br />
VIDEO<br />
Interessierte Anwender können die neuen Lösungen<br />
von Bosch Rexroth schon jetzt in Bild und Ton erleben:<br />
https://bit.ly/BoschRexroth_smarteLineartechnik<br />
26 <strong>DER</strong> <strong>KONSTRUKTEUR</strong> <strong>2020</strong>/05 www.derkonstrukteur.de
ANTRIEBSTECHNIK<br />
NEUE DREHMOMENTSTARKE ANTRIEBE<br />
Maxon hat eine Reihe drehmomentstarker Antriebe vorgestellt.<br />
Dazu gehören leistungsverstärkte Flachmotoren, Antriebe mit<br />
zusätzlicher Drehmomentleistung, und auch die GPX-Getriebefamilie<br />
hat Zuwachs erhalten. Der Motor EC-i52 Power up deckt<br />
die Nachfrage nach zusätzlicher Drehmomentleistung ab.<br />
Die neue Version des bürstenlosen DC-Motors erreicht nun ein<br />
Drehmoment<br />
bis 1 Nm.<br />
Zudem hat der<br />
Antriebsspezialist<br />
einen Rotor<br />
für Flachmotoren<br />
entwickelt,<br />
bei dem das<br />
Rotorgehäuse<br />
im Kaltumformungsverfahren<br />
produziert wird.<br />
Das Ergebnis ist<br />
der leistungsverstärkte<br />
Flachmotor<br />
EC 45 flat<br />
Power up. Die bürstenlosen ECX-Torque-Motoren erreichen eine<br />
sehr hohe Drehmomentdichte bei moderater Drehzahl. Sie haben<br />
einen Durchmesser von 22 mm und sind in drei Längen erhältlich.<br />
In der GPX-Getriebefamilie gibt es nun neben den Durchmessern<br />
22 und 32 mm auch die größere Version GPX 42 UP. Diese<br />
Ultra-Performance-Getriebe zeichnen sich durch einen sehr<br />
hohen Wirkungsgrad aus.<br />
www.maxongroup.com<br />
GELENKLAGER: AUSGLEICHEND<br />
BEI SCHWENK- UND KIPPBEWEGUNGEN<br />
KBT Knapp<br />
bietet anwendungsspezifische<br />
Gelenklager<br />
an, die beim<br />
integrierten<br />
Schmiernutensystem<br />
be -<br />
ginnen und<br />
auch wartungsfreie, mit PTFE-Gewebe eingelegte Sondergelenklager<br />
beinhalten. Viele Anwendungen erfordern Lagerelemente,<br />
die sowohl für Schwenk- als auch für Kippbewegungen ausgelegt<br />
sind und dadurch Schiefstellungen ausgleichen können. Die<br />
meisten Wälzlager erfüllen diese Anforderungen nicht, da sie für<br />
kontinuierliche Umlaufbewegungen ausgelegt sind und Schiefstellungen<br />
nur begrenzt aufnehmen können. Gelenklager<br />
hingegen erfüllen diese Anforderungen. Sie werden als hochtragfähige<br />
Lagerelemente verwendet, um Bewegungen zwischen<br />
Welle und Gehäuse momentenarm auszugleichen. Das Gehäuse<br />
der KBT-Gelenkköpfe trägt das entsprechende Gelenklager.<br />
Abgestimmt auf die Anwendung werden als Trägermaterialien<br />
Vergütungsstahl, Grauguss bzw. Sphäroguss und Baustahl<br />
verwendet. Wartungspflichtige Gelenkköpfe sind nachschmierbar<br />
und mit Abdichtungen versehen.<br />
www.knapp-waelzlagertechnik.de<br />
Der Konstrukteur Mar quarter page.pdf 1 14.02.<strong>2020</strong> 09:37:25<br />
SYNCHRONMOTOR:<br />
NOCH MEHR ENERGIEEFFIZIENZ<br />
Nord Drive Systems kündigt einen neuen energieeffizienten<br />
Permanentmagnet-Synchronmotor (IE5+) an, der Verluste im<br />
Vergleich zur IE4-Baureihe weiter minimiert. Das Modell der<br />
jüngsten Generation ergänzt die Getriebemotorvarianten der<br />
LogiDrive-Systeme und soll dazu beitragen, die Variantenvielfalt<br />
in der Intralogistik zu reduzieren. Der kompakt konzipierte,<br />
unbelüftete<br />
Glattmotor<br />
erreicht seinen<br />
hohen Wirkungsgrad<br />
über<br />
einen breiten<br />
Drehmomentbereich<br />
und<br />
eignet sich für<br />
den Betrieb in<br />
Teillast. IE5+<br />
wird zunächst<br />
in einer Baugröße<br />
für<br />
Leistungen von 0,35 bis 1,1 kW mit einem Dauerdrehmoment von<br />
1,6 bis 4,8 Nm sowie Drehzahlen von 0 bis 2 100 min -1 angeboten.<br />
Für eine verringerte Variantenzahl sorgt das konstante Drehmoment<br />
über einen weiten Drehzahlbereich. Damit sinkt der<br />
administrative und organisatorische Aufwand auf Lagerungsund<br />
Serviceebene. Der IE5+-Motor ist im Baukastensystem mit<br />
Getrieben und Antriebselektronik kombinierbar.<br />
www.nord.com<br />
www.derkonstrukteur.de <strong>DER</strong> <strong>KONSTRUKTEUR</strong> <strong>2020</strong>/05 27
SPECIAL<br />
ROBOTIK<br />
SPECIAL<br />
28 <strong>DER</strong> <strong>KONSTRUKTEUR</strong> <strong>2020</strong>/05 www.derkonstrukteur.de
ROBOTIK<br />
WENN <strong>DER</strong><br />
ROBOTER MIT<br />
<strong>DER</strong> WERKZEUG-<br />
MASCHINE …<br />
Roboterprogrammierung und -inbetriebnahme<br />
direkt über eine CNC, ohne spezielle<br />
Programmierkenntnisse – das klingt gut! Ein<br />
Automatisierungsspezialist hat genau das jetzt<br />
möglich gemacht, indem er seine<br />
Werkzeugmaschinensteuerungen mit einer<br />
Robotersteuerungs-Funktionalität ausgestattet<br />
hat. Seine Knickarmroboter bilden die perfekte<br />
Hardware-Ergänzung dazu.<br />
Autor: Michael Finke, Mitsubishi Electric<br />
Industrial Automation, Ratingen<br />
Mit weniger Fachkräften mehr erreichen – vor dieser<br />
Herausforderung stehen Unternehmen zunehmend.<br />
Wichtig sind dafür eine möglichst flexible Produktion<br />
und immer kürzere Taktzeiten. Automatisierte<br />
Fertigungen mit Industrierobotern sind zwar gefragt wie nie,<br />
allerdings ist die Hürde durch Unsicherheit bezüglich der Integration<br />
und Programmierung ohne Erfahrung oft ziemlich hoch.<br />
Mit seiner neuen Steuerungslösung beschleunigt Mitsubishi<br />
Electric nicht nur die Inbetriebnahme, sondern senkt gleichzeitig<br />
auch den Schulungs- und Fachkräftebedarf. Dazu erhöht<br />
sie die Flexibilität – besonders bei kleinen Losgrößen. Der Roboter<br />
lässt sich nun ohne Aufwand durch den Anwender mit der CNC<br />
bedienen und kontrollieren. Mit bereits vorhandenen Kenntnissen<br />
können Be- und Entladevorgänge automatisiert werden.<br />
Und das ohne zusätzlich externe Experten heranziehen zu<br />
müssen.<br />
Denn Mitsubishi Electric hat seine CNCs der Serie M8 mit der<br />
Direct-Robot-Control (DRC)- Funktionalität ausgestattet, speziell<br />
um die Automatisierung von Werkzeugmaschinen zu erleichtern.<br />
Dank dieser neuen Software-Lösung kann der Roboter per Plug<br />
and Play mit der Werkzeugmaschinen-Steuerung verbunden<br />
werden. Voraussetzungen sind, dass die Steuerung aus der<br />
M8-CNC-Serie von Mitsubishi Electric das neue Feature Direct-<br />
Robot-Control installiert hat und das System die Eckdaten des<br />
Roboters kennt. Sind diese Bedingungen erfüllt, kann der Roboter<br />
DANK <strong>DER</strong> NEUEN SOFTWARE-<br />
LÖSUNG KANN <strong>DER</strong> ROBOTER<br />
PER PLUG AND PLAY MIT <strong>DER</strong><br />
CNC VERBUNDEN WERDEN<br />
direkt an der Werkzeugmaschine in Betrieb genommen werden.<br />
So entsteht auch die Möglichkeit, den Roboter an verschiedenen<br />
Werkzeugmaschinen einzusetzen – je nach Bedarf und<br />
Größe mobil verschiebbar oder fest installiert im Zentrum einer<br />
Fertigungsinsel.<br />
Sowohl die M800 mit großem Touchscreen als auch die M80<br />
von Mitsubishi Electric sind serienmäßig mit DRC ausgestattet.<br />
EINFACHE BEDIENUNG PER G-CODE<br />
Mithilfe der DRC-Funktion kann der Roboter ganz einfach über<br />
G-Code gesteuert werden. Dadurch entfällt das Starten des Programms<br />
via SPS oder auch die Bedienung per Teaching-Box und<br />
Smart Panel. Die neue Funktion bietet vielfältige Anwendungsmöglichkeiten,<br />
die vorher nicht gegeben waren: Funktionen, die<br />
aus der CNC-Technik bekannt sind, können jetzt auf den Roboter<br />
übertragen werden.<br />
EIN TOUCH, ZWEI SYSTEME<br />
Das Steuern des Roboters via Direct-Robot-Control ist kinderleicht:<br />
Über das integrierte Roboter-HMI auf der CNC lassen<br />
sich die Roboter problemlos im JOG-Modus verfahren. Ohne zusätzliche<br />
Programmierkenntnisse lässt sich der Roboter per<br />
G-Code oder SPS-Signal steuern, wodurch der Programmieraufwand<br />
erheblich reduziert wird. Dabei können sowohl der Roboter-<br />
www.derkonstrukteur.de <strong>DER</strong> <strong>KONSTRUKTEUR</strong> <strong>2020</strong>/05 29
SPECIAL<br />
ROBOTIK<br />
UNSERE<br />
ANWENDUNG<br />
BÜNDELT<br />
KNOW-HOW<br />
als auch der CNC-Status leicht überwacht werden.<br />
Die Synchronisierung der Bewegung von Roboter<br />
und Werkzeugmaschine erfolgt durch DRC mit nur<br />
wenigen Fingertips des Anwenders. Der Wechsel<br />
zwischen Roboter und CNC geht sehr zügig mit<br />
dem 1-Touch-Feature. Bei der Optimierung der<br />
Abläufe helfen weitere Features von Mitsubishi<br />
Electric wie Prozess- und Operationshistorien sowie<br />
Fehlerlogs. Je nach Auftragslage ermöglicht Direct-<br />
Robot-Control dem Anwender sehr flexibel mit der<br />
Roboterautomation reagieren zu können.<br />
Noch komfortabler als mit per HMI gestaltet sich<br />
die Steuerung über den optionalen 19"-Touchscreen.<br />
ZUGRIFF AUFS KOORDINATENSYSTEM<br />
Mit Direct Robot Control können über die CNC die Werkzeugmaschine<br />
und der Roboter gesteuert werden. Diese Anwendung deckt ein breites<br />
Spektrum von einfachen Zyklen bis hin zu komplexen Verfahrbewegungen<br />
ab. Für den normalen CNC-Benutzer ändert sich dabei gar nichts. Die<br />
G-Code-Programmierung bleibt und er kann direkt im Menü den Roboter<br />
steuern. Also wird nur noch ein Mann benötigt, der beide Komponenten<br />
steuert. Er kann sein Wissen aus der G-Code-Programmierung direkt auf<br />
den Roboter übertragen. Dadurch haben wir Know-how gebündelt.<br />
Bequem und besonders akkurat kann jetzt auch<br />
direkt auf das Koordinatensystem der Werkzeugmaschinenachsen<br />
zugegriffen werden. Werkstückkoordinaten<br />
können ohne Übergabe an ein weiteres<br />
System verwendet werden. Das Anfahren von<br />
Zielpunkten der Teaching-Methode bleibt davon<br />
unberührt und ist weiterhin möglich. Dies reduziert<br />
die Programmierzeiten, steigert simultan die<br />
Sicherheit und ermöglicht kürzere Zykluszeiten in<br />
der Praxis.<br />
DRC reduziert den Aufwand und die Komplexität<br />
spürbar und ermöglicht dadurch eine mühelose<br />
BENJAMIN BUZGA, CNC Sales & Business Development Manager,<br />
Mitsubishi Electric Factory Automation CNC<br />
01 Einfache Bedienung und Programmierung via G-Code<br />
über die CNC-Steuerung – und schon läuft der Roboter<br />
02 Die Knickarmroboter sind eine perfekte Hardware-<br />
Ergänzung für die Direct-Robot-Control-Software<br />
01<br />
02
03 Gutes Team für die Automatisierung von<br />
Werkzeugmaschinen: die CNC-Steuerungen<br />
mit der DRC-Funktionalität und der Knickarmroboter<br />
ermöglichen eine flexiblere Produktion<br />
und ein schnelleres Time-to-Market<br />
VIELFÄLTIGE VORTEILE<br />
Von der Direct-Robot-Control-Funktion profitieren sowohl Werkzeugmaschinen-<br />
Hersteller als auch -Anwender. Denn das einfache Einbinden von Robotern zum<br />
Be- und Entladen oder für nachgelagerte Arbeitsgänge eröffnet vielfältige<br />
Vorteile für maschinelle Bearbeitungsprozesse in der Industrie. Zunächst einmal<br />
sind nur noch eine Steuerung und ein Bediener nötig. Neben Kostenvorteilen<br />
erleichtert das die Roboterintegration deutlich. Durch die in die CNC integrierte<br />
Robotersteuerung können z. B. neue Roboterfunktionen ganz einfach vom<br />
Bediener selbst direkt an der CNC in G-Code programmiert werden. So müssen<br />
zum Ändern einfacherer Roboteraktionen keine Roboterspezialisten mehr<br />
hinzugezogen werden. In Summe kann der Einsatz der CNC mit DRC so zu einer<br />
flexibleren Produktion und einer schnelleren time to market (TTM) beitragen<br />
und damit die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen erhöhen.<br />
Integration von Robotern in eine automatisierte<br />
Fertigung.<br />
<strong>DER</strong> PASSENDE ROBOTER<br />
Die Melfa-Knickarmroboter von Mitsubishi<br />
Electric sind qualifizierte Kandidaten für<br />
die Automatisierung von Werkzeugmaschinen<br />
– und damit eine passende Hardware-<br />
Ergänzung für DRC. Dank ihrer speziellen<br />
Motoren und Verstärker eignen Sie sich gut<br />
VIDEO<br />
Die CNC und der Roboter:<br />
Der Clip zeigt das Team in Aktion<br />
und fasst die Besonderheiten<br />
zusammen – in 150 s.<br />
für Anwendungen mit hoher Präzision bei<br />
hohen Geschwindigkeiten. Sie ermöglichen<br />
Taktzeiten von bis zu 0,32 s mit Wiederholgenauigkeiten<br />
von bis zu ± 0,02 mm. Die<br />
Knickarmroboter haben eine Reichweite<br />
von 504 bis 2 055 mm bei kugelförmigem<br />
Arbeitsraum – d. h. auch der Raum hinter<br />
dem Roboter ist nutzbar. Schutzklasse IP67<br />
ist Standard und die Kabelführung verläuft<br />
intern. Dank Melfa-SmartPlus-Optionskarte<br />
ist sogar KI in die Roboter integrierbar.<br />
Das sind nur einige der Merkmale, die für<br />
den Einsatz der Melfa-Knickarmroboter in<br />
dieser Applikation sprechen.<br />
Ein weiterer Vorteil ist, dass sie nicht<br />
nur mit der CNC sondern auch mit anderen<br />
Komponenten von Mitsubishi Electric,<br />
wie SPS, Bediengeräte und Servos harmonieren.<br />
Dadurch sind sie gut gerüstet für<br />
einfache und komplexe Einsatzbereiche<br />
bei den unterschiedlichsten Produkten<br />
und Produktionsprozessen. Auch Arbeitsschritte<br />
wie das Entgraten oder Messen<br />
von Werkstücken können direkt übernommen<br />
werden.<br />
Bilder: Mitsubishi Electric<br />
WIR MACHEN<br />
IHRE MASCHINE<br />
SICHER<br />
SICHERHEITSLÖSUNGEN<br />
FÜR ROBOTER<br />
n Breites Produkt- und Leistungsspektrum,<br />
erfüllt ISO 10218-1<br />
und ISO 10218-2<br />
n Diverse Sicherheitskomponenten<br />
für die Zugangs- und Bereichsabsicherung<br />
n Sicherheitsrelaisbausteine und<br />
Sicherheitssteuerungen für größere<br />
Roboteranlagen<br />
n Umfangreiches technisches<br />
Know-how in allen Fragen der<br />
Robotersicherheit<br />
www.schmersal.com<br />
https://bit.ly/MitsubishiElectric_DRC<br />
https://de3a.mitsubishielectric.com
KLARTEXT<br />
WAS BRAUCHEN<br />
DIE COBOTS?<br />
BERND KEES<br />
Produktmanager, Mayr Antriebstechnik, Mauerstetten<br />
Die Zusammenarbeit von Mensch und Roboter wird immer enger. Damit<br />
steigt das Gefährdungspotenzial. An Bremsen werden hierbei im Hinblick<br />
auf die Sicherheit besondere Anforderungen gestellt. Fällt zum Beispiel<br />
während eines Arbeitsvorgangs der Strom aus, muss der Roboterarm, der<br />
den Arbeitsschritt vornimmt, sofort exakt gehalten werden. Speziell für die<br />
Robotik haben wir von Mayr Antriebstechnik zuverlässige, leistungsdichte<br />
und verschleißfeste Leichtbaubremsen mit extrem kurzen Schaltzeiten<br />
entwickelt, die den hohen Anforderungen standhalten. Wichtig ist, dass die<br />
Bremsen individuell anpassbar sind und sich direkt in die Robotergelenke<br />
integrieren lassen. Natürlich stellen wir die für die Sicherheitsbetrachtung<br />
erforderlichen Sicherheitskennwerte für die Bremsen bereit.<br />
Roboter haben in den<br />
letzten Jahren eine<br />
beachtliche Entwicklung<br />
durchlaufen. Sie haben die<br />
Käfige verlassen und<br />
arbeiten heute als Cobots<br />
mit Menschen zusammen.<br />
Und die Entwicklung geht<br />
weiter – sie werden immer<br />
kleiner, wendiger, smarter.<br />
Was fordern diese Trends<br />
von den eingesetzten<br />
Bauteilen? Wir haben<br />
Hersteller aus ganz<br />
verschiedenen Bereichen<br />
gefragt: „Was verlangen<br />
die Cobots von Ihren<br />
Komponenten?“<br />
ZUVERLÄSSIGE,<br />
LEISTUNGSDICHTE<br />
LEICHTBAUBREM-<br />
SEN SIND GEFRAGT<br />
ES ZÄHLEN<br />
SICHERHEIT,<br />
EFFIZIENZ<br />
UND SMARTE<br />
KOMPATIBILITÄT<br />
SPECIAL<br />
THORSTEN HERGENRÖTHER<br />
Innovation Engineer, SMC Deutschland, Egelsbach<br />
Das Wort Cobot bezeichnet einen Roboter, der direkt mit Menschen interagiert –<br />
etwa bei der Bestückung von Maschinen. Dabei sind drei Aspekte elementar:<br />
Sicherheit, Effizienz und Kosten. Der Roboter darf niemanden verletzen, muss<br />
die Produktivität erhöhen und sollte nicht zu teuer sein. Um das zu realisieren,<br />
werden besonders kompakte, zuverlässige und preisgünstige Komponenten<br />
und Antriebe benötigt. Für die Industrie 4.0 sind zudem einfache und smarte<br />
Kompatibilität sowie Konnektivität wichtig. Jede Cobot-Anwendung benötigt<br />
eine individuelle Kombination aus Komponenten und Steuerung – unter<br />
Beachtung unterschiedlicher, länderspezifischer Sicherheitsvorschriften.<br />
Genau da setzen wir bei SMC an. Dank unserer umfangreichen Produktauswahl<br />
und hohen Expertise entwickeln wir Lösungen optimal abgestimmt auf die<br />
Anforderungen unserer Kunden hinsichtlich Sicherheit, Effizienz und smarter<br />
Kompatibilität.
KLARTEXT<br />
SVEN SEIBERT<br />
Leiter Produktmanagement, TKD Kabel GmbH, Nettetal<br />
Roboter und Cobots bedeuten Stress pur – auch für die eingesetzten Kabel. Bewegungen<br />
auf engstem Raum, Dynamik in alle Richtungen und Torsion ohne Ende sind und bleiben<br />
an der Tagesordnung. Diesen speziellen Anforderungen begegnen wir auch künftig mit<br />
hochagilen Spezialkabeln, die von A bis Z auf den mechanischen Megastress hin konzipiert<br />
sind. Langlebigkeit und Funktionssicherheit haben höchste Priorität, da Kabel und Leitungen<br />
auch im Zeitalter von Robotik 2.0 ihren Status als unverzichtbare Lebensadern beibehalten.<br />
Mehr denn je spielt Outdoor-Kompatibilität eine Rolle, da Cobots immer häufiger auch im<br />
Außeneinsatz zu finden sein werden. Während Schlankheit von Haus aus eine feste Größe<br />
bei Roboterleitungen bildet, wird sich der Trend zu Miniaturisierung nochmal verstärken.<br />
Filigrane Kabel mit noch höherer Packungsdichte passen einfach noch besser zu den immer<br />
kompakter werdenden Cobots!<br />
KABEL MÜSSEN FÜR<br />
MECHANISCHEN MEGASTRESS<br />
KONZIPIERT SEIN<br />
<strong>DER</strong> COBOT MUSS DAS<br />
SMARTPHONE UNTER<br />
DEN ROBOTERN WERDEN<br />
ALEXAN<strong>DER</strong> BARTH<br />
Sales Manager Europe, KEBA, Linz (A)<br />
Damit Cobots tatsächlich im Alltag als flexible Assistenten eingesetzt werden können,<br />
müssen zwei Bereiche noch wesentlich verbessert werden: die Sensorik und die Art, wie<br />
sie zu ihren Fähigkeiten bzw. Fertigkeiten kommen. Anders gesagt: Der Cobot muss das<br />
Smartphone unter den Robotern werden! Ein Smartphone ist mit bester Sensorik, einem<br />
durchgängigen Betriebssystem und mit Apps ausgestattet. Letztere sorgen dafür, dass in<br />
kürzester Zeit „Aufgaben“ ausgeführt werden, die dem Smartphone zuvor unbekannt<br />
waren. Auch in der Cobotic müssen wir uns von vielen herstellerspezifischen Lösungen<br />
hin zum „Android für die Robotik“ entwickeln. Cobots benötigen ein Betriebssystem, das<br />
die Funktionen von Cobot-Mechaniken und deren Sensorik in gleicher Weise und einfach<br />
verwendbar zur Verfügung stellt. Experten könnten so Fertigkeiten und Fähigkeiten für<br />
Cobots entwickeln, die bequem via Download genutzt werden können. Zubehör wie<br />
Greifer oder andere Werkzeuge werden vom Betriebssystem auch via Plug-and-run<br />
übernommen.<br />
www.derkonstrukteur.de <strong>DER</strong> <strong>KONSTRUKTEUR</strong> <strong>2020</strong>/05 33
ROBOTIK<br />
HOHL –<br />
ABER OHO<br />
SPECIAL<br />
Multiturn-Funktionalität beim Motorfeedback in<br />
hochdynamischen Roboterarmen – was bislang<br />
kaum möglich war, ist ein Kinderspiel mit<br />
kapazitativen Hohlwellen-Kits. Dabei gibt es die<br />
präzisen Montage-Kits mit einer Zählelektronik,<br />
die dank Energy Harvesting ohne Batterien oder<br />
aufwendige Getriebe auskommt und komplett<br />
wartungsfrei ist.<br />
Installiert sind die Hollow-Shaft-Kits direkt in den Gelenken der<br />
Knickarmroboter. Von hier überwachen und steuern sie minutiös<br />
und detailliert die dreidimensionalen Bewegungsabläufe der<br />
einzelnen Roboterarme. Wie hoch die Messlatte in Sachen Präzision<br />
und Positionierung liegt, wird daran deutlich, dass moderne<br />
Industrieroboter mit Wiederholgenauigkeiten von bis zu 0,1 mm<br />
arbeiten. Während die kapazitative Messtechnik, die Platine mit der<br />
Auswerteelektronik sowie das Multiturn-System mit dem Wiegand-<br />
Harvester auf engstem Raum in den gegenüberliegenden Rotorbzw.<br />
Statorscheiben integriert sind, wird die zentrale Öffnung<br />
(wahlweise 30 und 50 mm) für die Führung von Kabeln und<br />
Medienschläuchen im Innern des Roboters genutzt.<br />
KAUM SCHWERER ALS EINE TAFEL SCHOKOLADE<br />
Orientiert sich der Außendurchmesser des Hollow Shaft-Kits mit<br />
80 mm gezielt an klassischen Standardmaßen von Hohlwellen-<br />
Drehgebern für die Robotik, fallen das geringe Gewicht und die<br />
minimale Bauhöhe auf. Mit gerade mal 110 g wiegt das komplette<br />
Kit, das mit einem Schutzgehäuse umhaust ist, kaum mehr als eine<br />
Autor: Jörg Paulus, General Manager, Sales – Europe, Posital-Fraba, Köln<br />
Tafel Schokolade. Mit einer Bauhöhe von 17,8 mm steht der neue<br />
Hohlwellen-Encoder überaus schlank da und sorgt laut Hersteller<br />
für eine neue Richtgröße in diesem Segment.<br />
Was sich mit den neuen Kits tatsächlich einsparen lässt, zeigt ein<br />
Blick auf die Ist-Situation. Während für die Drehzahlüberwachung<br />
und Positionssteuerung bislang zwei parallel arbeitende Singleturngeber<br />
– plus Getriebe für die Synchronisation – nötig sind,<br />
schafft der neue Kit-Encoder dies im Alleingang. Aus zwei mach<br />
eins – lautet die Devise.<br />
Prädestiniert sind die kapazitativen Hohlwellen-Kits für klassische<br />
Industrieroboter wie für die hochflexiblen, kleineren Cobots,<br />
die stark auf dem Vormarsch sind. Über mechanische Adapterplatten<br />
lassen sich die Hollow-Shaft-Geräte problemlos in verschieden<br />
große Robotergelenke einpassen. Montage wie Inbetriebnahme<br />
sind ein Kinderspiel. Wenige Schrauben reichen, und das System ist<br />
einsatzbereit – ganz ohne komplizierte Kalibrierung.<br />
Während Posital seit Jahren bei Gebern mit Vollwelle für den erfolgreichen<br />
Switch von optischer zu magnetischer Messtechnik, bei<br />
der robuste Präzision kostengünstig über Rechenpower und Algorithmen<br />
generiert wird, steht, wurde bei der Hollow-Shaft-Serie<br />
gezielt ein alternativer Weg eingeschlagen. Da sich magnetische<br />
Erfassungsprinzipien nur mit sehr großem Aufwand in Hohlwellen-<br />
Designs umsetzen lassen, gab man, ganz pragmatisch, der kapazitativen<br />
Messtechnik den Vorzug. Auch sie steht für Zuverlässigkeit<br />
und Präzision – zu moderaten Kosten. Dies zeigt sich in Performancedaten<br />
wie einer elektronischen Singleturn Auflösung von<br />
18 Bit, gepaart mit einer Genauigkeit von ± 0,02 °.<br />
Schlüsselkomponenten der kapazitativen Messtechnik sind die<br />
mit unterschiedlichen Mustern bzw. Rastern gestalteten leitfähigen<br />
Oberflächen von Rotor und Stator. Sie erzeugen elektrische Hochfrequenzsignale,<br />
die über spezielle ASIC-Prozessoren erfasst und<br />
gescannt werden. Dabei wird die aktuelle Weg- und Winkelposition<br />
ermittelt und als eindeutiger Positionswert über die Open Source-<br />
Schnittstellen SSI bzw. BiSS C an die zentrale Steuerung weitergegeben.<br />
Da beim Scannen immer die komplette Oberfläche erfasst<br />
wird, lässt sich das neue Hohlwellen-Kit auch von punktuellen<br />
Verschmutzungen nicht aus dem Takt bringen.<br />
34 <strong>DER</strong> <strong>KONSTRUKTEUR</strong> <strong>2020</strong>/05 www.derkonstrukteur.de
ROBOTIK<br />
ENERGY HARVESTING STATT BATTERIEN<br />
Der eigentliche USP ist die Multiturn-Auslegung der Hollow Shaft-<br />
Serie. Bislang gab es Durchgangs- bzw. Hohlwellen-Geber fast ausschließlich<br />
als Singleturn-Lösung, da die richtige Multiturn-Technologie<br />
noch gefehlt hat. Diese Lücke konnte jetzt mit einer Variante des<br />
Wiegand-Sensors geschlossen werden. Statt Batteriepower sorgen<br />
hier Impulse aus einem von Posital in Eigenregie gefertigten Wiegand-<br />
Draht für die Energie-Ernte. Während der klassische Wiegand-Harvester,<br />
der seit 2005 erfolgreich bei Vollwellen-Gebern im Einsatz ist,<br />
im Tandem mit einem zentralen Permanentmagneten operiert,<br />
musste für das Hohlwellen-Design ein komplett neues Set-Up gefunden<br />
werden. Über intensive Magnetfeldsimulation und in praktischen<br />
Feldtests wurde im Aachener F&E-Zentrum eine zuverlässige<br />
<strong>DER</strong> ENCO<strong>DER</strong> SPIELT SEINE<br />
STÄRKEN VOR ALLEM BEI <strong>DER</strong><br />
HOCHPRÄZISEN POSITIONIE-<br />
RUNG UND STEUERUNG VON<br />
ROBOTERARMEN AUS<br />
Lösung mit vier Diametralmagneten entwickelt, die gleichmäßig im<br />
Rotor platziert wurden. Die vier Magneten sorgen für ein stabiles Magnetfeld,<br />
das von dem fest auf dem Stator installierten Wiegand-Sensor<br />
detektiert und genutzt werden kann. Mit jeder 360°-Rotation des<br />
externen Magnetfeldes erzeugt der haarfeine Wiegend-Draht, der in<br />
eine Kupferspule eingebettet ist, einen Spannungsimpuls. Er weckt<br />
die Zählelektronik auf, die jede einzelne Umdrehung exakt erfasst.<br />
Der Multiturn-Zähler verfügt über einen 43-Bit-Speicher für einen<br />
Messbereich von fast neun Billionen Umdrehungen.<br />
Die Bemusterung mit den neuen Hollow-Shaft-Kits erfolgt seit<br />
Mitte letzten Jahres. „Das Echo ist riesig, wobei wir den größten<br />
Schub vor allem bei Neuentwicklungen sehen, die im rasant schneller<br />
werdenden Robotergeschäft in immer kürzeren Intervallen auf dem<br />
Plan stehen,“ so Posital-Fraba-CEO Christian Leeser.<br />
Bilder: Posital Fraba Europe<br />
www.posital.de<br />
Rotor und Stator – die kapazitative Messtechnik setzt<br />
auf verschieden gestaltete leitfähige Oberflächen<br />
iSync® ® BELTS<br />
Designed for<br />
Performance,<br />
Engineered for Excellence.<br />
LEISTUNG UND PRÄZISION UNTER KONTROLLE<br />
Bis zu 30% höhere Leistung als herkömmliche Riemen,<br />
Hochpräzise endlose Hochleistungsriemen<br />
Verfügbare Profile:<br />
• T2,5, T5, T10<br />
• AT5, AT10<br />
• L, XL<br />
Doppelverzahnung:<br />
• DT5, DT10<br />
Leistung (%)<br />
140<br />
120<br />
100<br />
80<br />
60<br />
40<br />
20<br />
0<br />
Polyurethan<br />
T-AT<br />
iSync ® T-AT<br />
iSync® T- AT<br />
+30%<br />
Leistungssteigerung<br />
www.elatech.com<br />
SIT Antriebselemente GmbH - Rieseler Feld 9 (Gewerbegebiet West) D-33034 Brakel<br />
Tel. +49.5272.3928.0 - Fax +49.5272.392890 info@sit-antriebselemente.de<br />
Banner iSync <strong>2020</strong> DE_R1.0.indd 1 15/04/<strong>2020</strong> 15:49:27<br />
www.derkonstrukteur.de <strong>DER</strong> <strong>KONSTRUKTEUR</strong> <strong>2020</strong>/05 35
ROBOTIK<br />
PERFEKTE KOMBINATION<br />
SPECIAL<br />
Ein einfach zu bedienender Industrieroboter,<br />
der leistungsfähig und zugleich preiswert ist –<br />
mit dieser scheinbar einfachen Geschäftsidee<br />
sorgt ein Roboterhersteller für Bewegung am<br />
Robotik-Markt. Möglich wird das auch durch ein<br />
neuartiges Antriebskonzept des Roboters, das<br />
Viergelenkketten mit Planetengetrieben<br />
kombiniert.<br />
Die Fruitcore Robotics GmbH mit Sitz in Konstanz ist spezialisiert<br />
auf die Entwicklung, Herstellung und Vermarktung<br />
technisch herausragender und einfach zu bedienender<br />
Industrieroboter. Im Fokus steht dabei ein selbst entwickeltes<br />
System, das Unternehmen aller Größen die Automatisierung<br />
erleichtert. 2017 gegründet, beschäftigt die junge Firma inzwischen<br />
rund 50 Mitarbeiter, darunter hochspezialisierte Fachleute für<br />
Konstruktion, Elektronik sowie Softwareentwicklung.<br />
Das modulare Portfolio umfasst neben dem Industrieroboter<br />
Horst (der Name steht für Highly Optimized Robotic Systems Technology)<br />
und der intuitiv bedienbaren Software HorstFX auch passendes<br />
Zubehör wie Greifer und eine mobile Roboter Basis. Der<br />
Autor: Marcel Geurts, Produktmanagement, Neugart GmbH, Kippenheim<br />
6-Achs-Industrieroboter mit einer Reichweite von 905 mm, einer<br />
Traglast von bis zu 5 kg und einer Wiederholgenauigkeit von ± 0,05 mm<br />
basiert auf einem für die Robotik völlig neuartigen Antriebskonzept<br />
mit Viergelenkketten. Durch den Verzicht auf sonst übliche, kostenintensive<br />
Well- oder Zykloidgetriebe bietet Horst damit ein optimales<br />
Verhältnis von Reichweite und Traglast zu einem vergleichsweise<br />
geringen Preis.<br />
GETRIEBE ALS ZENTRALE KOMPONENTE<br />
Viergelenkketten, auch Koppelgetriebe genannt, haben ein nicht<br />
lineares und somit positionsabhängiges Übersetzungsverhältnis.<br />
Was das konkret in Bezug auf einen Roboterarm bedeutet, erklärt<br />
Manuel Frey, Mitgründer und Entwicklungsleiter von Fruitcore<br />
Robotics: „Durch das hohe Übersetzungsverhältnis der Viergelenkkette<br />
bei ausgestrecktem Arm, fällt die Drehmomentspitze, die zur Beschleunigung<br />
dieses ausgestreckten Armes inklusive Last aufzubringen<br />
wäre, deutlich geringer aus als bei herkömmlichen Robotern.“<br />
Der Vorteil besteht darin, dass dadurch kleinere Motoren eingesetzt<br />
werden können, was den Preis des Roboters reduziert. Allerdings<br />
zeigte sich im Laufe der Entwicklungsarbeit: Die Übersetzung<br />
der Viergelenkkette allein reicht nicht aus. Als Lösung werden deshalb<br />
noch zusätzliche Getriebe an den Achsen eingesetzt. Diese<br />
Kombination macht die Einzigartigkeit von Horst aus.<br />
Als perfekte Getriebeform für diese spezielle Anwendung erwiesen<br />
sich dabei einstufige Planetengetriebe. Um bei der hohen Dynamik<br />
der Roboterbewegungen das Optimum in Bezug auf Traglast und<br />
Reichweite sicherzustellen, muss der gesamte Antriebsstrang effizient<br />
ausgelegt sein. Das richtige Übersetzungsverhältnis dient hierbei<br />
als Grundlage und wird maßgeblich durch das Planetengetriebe<br />
36 <strong>DER</strong> <strong>KONSTRUKTEUR</strong> <strong>2020</strong>/05 www.derkonstrukteur.de
ROBOTIK<br />
bestimmt. „Ohne die Viergelenkketten hätten wir theoretisch zweistufige<br />
Getriebe einsetzen müssen, die wiederum ein höheres Verdrehspiel<br />
haben und somit für den Einsatz im Knickarm-Roboter<br />
nachteilig wären“, beschreibt Frey die wenig praktikable Alternative.<br />
HOHE PRÄZISION ZEICHNET SICH AUS<br />
Die Suche nach einem geeigneten Hersteller machten sich die<br />
Verantwortlichen bei Fruitcore Robotics nicht leicht, wie sich Frey<br />
erinnert: „Wir haben nach einem geeigneten Anbieter von Planetengetrieben<br />
gesucht, die exakt zu unserem System passen oder<br />
dementsprechend angepasst werden können – und die nicht zuletzt<br />
aus deutscher Fertigung stammen sollten.” Vor diesem Hintergrund<br />
fiel die Wahl auf den Getriebespezialisten Neugart im badischen<br />
Kippenheim. Das wichtigste Kriterium für Entwicklungsleiter Frey<br />
und seine Kollegen war eine hohe Präzision bzw. ein sehr geringes<br />
Verdrehspiel der Getriebe. Auch die Dauerfestigkeit der Getriebe ist<br />
durch den Betrieb im Nennbereich sichergestellt und eine hohe<br />
Lebensdauer des Roboters gewährleistet.<br />
Konkret kommen an den sechs Roboter-Achsen vier Neugart-<br />
Planetengetriebe in unterschiedlichen Baugrößen zum Einsatz.<br />
Diese sind besonders leicht, sehr leistungsstark und dank ihres<br />
WICHTIGSTES KRITERIUM WAR<br />
DIE HOHE PRÄZISION UND<br />
DAS GERINGE VERDREHSPIEL<br />
<strong>DER</strong> GETRIEBE<br />
reibungsarmen Lagerkonzepts und der optimierten Schmierung<br />
auch für anspruchsvolle, dynamische Lastzyklen geeignet.<br />
Neben den Produkteigenschaften sprach für Neugart nicht zuletzt<br />
auch die reibungslose Zusammenarbeit: „Die Implementierung der<br />
Getriebe lief absolut problemlos“, bestätigt Manuel Frey. „Neugart hat<br />
während der Entwicklungsphase immer schnell auf unsere Anpassungswünsche<br />
reagiert. Zudem waren alle von Neugart von Anfang an<br />
zur Verfügung gestellten Daten und Informationen – im Katalog und<br />
in den Konfigurationstools TDF oder NCP – sehr hilfreich und so<br />
Die Planetengetriebe sind besonders leicht, leistungsstark<br />
und dank ihres reibungsarmen Lagerkonzepts auch für<br />
anspruchsvolle, dynamische Lastzyklen geeignet<br />
umfangreich, dass wir gleich starten konnten. Natürlich gab es die eine<br />
oder andere technische Fragestellung, die aber in enger gegen seitiger<br />
Abstimmung immer schnell und einfach geklärt wurde.“<br />
WEITERE ROBOTER IN PLANUNG<br />
Der von Fruitcore Robotics entwickelte Industrieroboter Horst bietet<br />
ein herausragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Die Voraussetzung<br />
dafür schafft die bisher in der Robotik noch nicht genutzte Kombination<br />
aus Viergelenkketten und Planetengetrieben.<br />
Für Neugart als Lieferant sprachen dabei zum einen die Qualität<br />
der in Deutschland gefertigten Planetengetriebe. Zum anderen ist<br />
der Hersteller mit seinem großen Portfolio schon auf künftige Anforderungen<br />
vorbereitet: „Es soll weitere Robotergrößen geben“,<br />
blickt Manuel Frey voraus. „Durch die große Auswahl an Getriebemodellen<br />
steht diesem Plan – und einer weiteren erfolgreichen<br />
Zusammenarbeit mit Neugart – nichts im Weg.“<br />
Bilder: Neugart GmbH<br />
www.neugart.com<br />
KABEL MACHEN ROBOTER FIT FÜR GLEICHSTROM<br />
Lapp stellt erstmals eine Roboterleitung vor, die sich explizit für den Einsatz<br />
mit Gleichstrom eignet. Die Anschlussleitung Ölflex DC Robot 900 zeichnet<br />
sich vor allem durch ihre Torsions- und Biegefähigkeit aus. Sichtbarer Unterschied<br />
zu herkömmlichen Ölflex-Leitungen ist die andere Farbcodierung der<br />
Adern: rot, weiß und grün-gelb, entsprechend der Norm DIN EN 60445 (VDE<br />
0197):2018-02 für DC-Leitungen. Nicht weniger wichtig sind die verwendeten<br />
Materialien: Die Isolation der Adern besteht aus TPE, der Mantel aus PUR.<br />
Damit ist die Leitung halogenfrei und geeignet für Orte, wo sich Menschen<br />
aufhalten, denn im Fall eines Brands entweichen dem Kunststoff keine ätzenden<br />
Dämpfe. Außerdem ist das Material UV- und witterungsbeständig, wasserbeständig<br />
und kälteflexibel.<br />
Leitungen wie die Ölflex DC Robot 900 sind ein wichtiger Baustein für die<br />
künftige Gleichstrom-Infrastruktur in Fabriken. Ohne das bisher notwendige hin und her Wandeln zwischen Gleich- und Wechselstrom<br />
lassen sich enorme Mengen Energie sparen. Energieexperten plädieren deshalb für den Bau von Gleichstromnetzen. Die Industrie<br />
hat bereits damit begonnen, Fertigungszellen damit auszurüsten. Eine Umstellung auf Gleichstrom (DC) in der Industrie könnte<br />
20 % und mehr Energie einsparen. Noch sind etliche technische Herausforderungen zu meistern, bis eine Infrastruktur aus Gleichstrom<br />
Realität werden kann.<br />
www.lappkabel.de<br />
www.derkonstrukteur.de <strong>DER</strong> <strong>KONSTRUKTEUR</strong> <strong>2020</strong>/05 37
ROBOTIK<br />
KOORDINATEN<br />
IM BLICK<br />
SPECIAL<br />
Kollaborierende Roboter, sogenannte Cobots,<br />
unterstützen die Automatisierung von<br />
Handarbeit, mussten aber bislang manuell<br />
kalibriert werden. Durch einen automatischen<br />
Koordinatenabgleich per Vision Sensor sind sie<br />
jetzt innerhalb kurzer Zeit einsatzbereit.<br />
Ich sehe, was ich mache – für Menschen einfach, für Roboter eine<br />
Herausforderung. Um Robotik-Applikationen in immer mehr<br />
Bereichen der Automatisierung zu verankern, nimmt Bildverarbeitung<br />
eine Schlüsselrolle ein. Vision Sensoren wie die Baumer<br />
Verisens Modelle XF900 und XC900 können hier entscheidend<br />
unterstützen. Sie vereinen ein komplettes Bildverarbeitungssystem<br />
in einem kompakten, industrietauglichen Gehäuse und lassen sich<br />
zudem gut parametrieren. Bildverarbeitung wird für die Anwender<br />
damit deutlich einfacher. Es ist daher naheliegend, einen Verisens<br />
Vision Sensor und einen Universal Robots Cobot zu einem „sehenden“<br />
Roboter zu vereinen, der einfacher, schneller und genauer einzurichten<br />
ist, als bisherige Lösungen.<br />
BILDVERARBEITUNG FÜR ROBOTER<br />
Roboter orientieren sich an eingelernten, festen Wegpunkten und<br />
fahren diese nacheinander ab. Bildverarbeitung erweitert diese<br />
Funktionalität enorm. Ein einfach mitgeführter Vision Sensor versetzt<br />
Autor: Michael Steinicke, Produktmanager, Vision Competence Center,<br />
Baumer Optronic GmbH, Radeberg<br />
den Roboter bereits in die Lage, Objekte sicher zu identifizieren.<br />
Gleichzeitig oder alternativ ist auch eine Qualitätskontrolle realisierbar,<br />
die der Roboter durch Verfahren des Sensors an festgelegten<br />
Positionen unterstützt. Objekte können anschließend auch automatisch<br />
sortiert werden.<br />
Die Königsdisziplin ist jedoch das Steuern des Roboters, bei der<br />
die Bildverarbeitung die Position von Objekten ermittelt, an den<br />
Roboter übergibt und ihm damit ein freies Greifen jenseits fester<br />
Wegpunkte ermöglicht. Objekte können dabei in beliebiger Orientierung<br />
auf einer Fläche liegen. Position, Rotation und optional weitere<br />
Daten, werden durch die Bildverarbeitung ermittelt und übergeben.<br />
SCHNITTSTELLE ZWISCHEN SENSOR UND COBOT<br />
Ähnlich dem von Smartphones bekannten App-Konzept nutzt<br />
Universal Robots für zertifiziertes Zubehör sogenannte Caps: Software-Plug-ins,<br />
die Anbauten wie einen Verisens Vision Sensor in<br />
der Universal Robots Programmierumgebung PolyScope nutzbar<br />
machen. Die Bildverarbeitungsaufgabe selbst wird komplett und<br />
wie gewohnt über die Verisens Application Suite parametriert – unabhängig<br />
vom Cobot in der dafür am besten geeigneten Umgebung.<br />
Die Funktionen des Verisens URCaps sind generisch und adressieren<br />
so alle denkbaren Applikationen einschließlich mitgeführter oder<br />
stationärer Anordnung des Vision Sensors.<br />
Neben der im URCap abgebildeten Routine zur Installation, werden<br />
für die Programmierung des Universal Robot lediglich zwei zusätzliche<br />
Knoten (Kommandos) in der Roboterprogrammierung benötigt.<br />
Für die Objektidentifizierung oder Qualitätskontrolle genügt bereits<br />
ein Knoten, um im Roboterprogramm einen Bildverarbeitungsjob<br />
auf dem Verisens auszulösen und die Ergebnisse als Variable im<br />
Programmablauf zur Entscheidungsfindung bereitzustellen. Damit<br />
kann der Cobot nun bereits Objekte sortieren.<br />
Für das bildbasierte Greifen kommt der zweite Knoten hinzu, der<br />
die festen Wegpunkte durch dynamische, bildbasierte ergänzt. Bei<br />
38 <strong>DER</strong> <strong>KONSTRUKTEUR</strong> <strong>2020</strong>/05 www.derkonstrukteur.de
ROBOTIK<br />
der einfachen Realisierung von Pick-und-Place Applikationen hilft<br />
optional ein speziell dafür geschaffener Assistent.<br />
<strong>DER</strong> CLOU: AUTOMATISCHE KALIBRIERUNG<br />
Roboter und Vision Sensor arbeiten in eigenen Koordinatensystemen,<br />
was funktionell erst bei der Übergabe von Objektpositionen<br />
vom Verisens an den Cobot relevant wird. Die Koordinaten des<br />
Vision Sensors müssen umgerechnet werden, um dem Roboterkoordinatensystem<br />
zu entsprechen. Die Ermittlung der notwendigen<br />
Koordinatentransformation wurde bisher als Hand-Auge-Kalibrierung<br />
durch das mehrfache manuelle Positionieren des Cobots mit<br />
einer Tastspitze auf einem speziellen Kalibriertarget gelöst. In<br />
v ielen Einzelschritten wird so eine vom Hersteller vorgegebene<br />
Prozedur durchlaufen. Dies ist mühsam und durch den händischen<br />
Eingriff, im Sinne der menschlichen Steuerung der Tastspitze, auch<br />
ungenau und fehleranfällig.<br />
Mit dem Smartgrid geht Baumer für seine Verisens Vision Sensoren<br />
den neuen Weg einer automatischen Kalibrierung. Der Clou liegt<br />
im intelligenten Bitmuster, das sich im üblichen Schachbrett-<br />
Format versteckt. Es liefert wertvolle Zusatzinformationen, die Verisens<br />
als intelligentes Bildverarbeitungsgerät lesen kann. Eine dieser<br />
Informationen ist die Position des Vision Sensors über dem Muster.<br />
Da der Cobot seine Koordinaten immer kennt, genügen wenige<br />
Linear- und Rotationsbewegungen, um die Koordinatensysteme<br />
automatisch miteinander abzugleichen. Diese Prozedur ist nicht<br />
nur sehr genau und frei von manuellen Fehlern – sie ist auch ganz<br />
einfach am Touchscreen des Cobots durchführbar.<br />
01 Die Vision-Sensoren<br />
steuern die Cobots schon<br />
nach wenigen Minuten<br />
Einrichtung<br />
02 Der Sensor erkennt das<br />
Bitmuster und unterstützt<br />
den automatischen Abgleich<br />
des Koordinatensystems<br />
01<br />
02<br />
2D-VISON SENSOR FÜR 3D-ROBOTER<br />
Das Finden von Objekten ist aus Sicht der Koordinaten gelöst. Per<br />
Smartgrid wird jedoch viel mehr erreicht: Verisens nutzt auch das<br />
Raster, um ein ideales Bild zu lernen. Die Vision Sensoren können<br />
anschließend aufgenommene Bilder in Echtzeit entzerren, um u. a.<br />
die Objektiv-Verzeichnung zu korrigieren. Da das Bitmuster auch<br />
TRAUMPAAR <strong>DER</strong><br />
AUTOMATION<br />
Im Bereich Qualitätskontrolle oder Handling<br />
sind sie ein Traumpaar: Cobots und<br />
Bildverarbeitungssysteme unterstützen<br />
den Menschen bei routinemäßigen Arbeitsabläufen<br />
und verringern das Fehlerrisiko in<br />
der Fertigung auf ein Minimum. Die Möglichkeit<br />
statt eingelernter Wege freie Positionen<br />
anzufahren, erhöht die Flexibilität<br />
und das Aufgabenspektrum der Cobots.<br />
Und auch der großen Herausforderung, den<br />
Roboter bis zum letzten Millimeter seines<br />
Einsatzes sicher und kontrollierbar zu<br />
machen, kommt die Industrie durch die<br />
Verwendung von intelligenten Bildverarbeitungssystemen<br />
wieder einen Schritt näher.<br />
Schön, wenn sich zwei so gut verstehen.<br />
INGA RONSDORF, Redakteurin<br />
Daten zur Größe vom jeweilig verwendeten Smartgrid liefert, liegen<br />
für Verisens nun alle Informationen zur Skalierung vor. Eine Umrechnung<br />
in Weltkoordinaten ist damit bereits automatisch eingestellt.<br />
Das Smartgrid unterstützt zusätzlich eine halbautomatische<br />
Z-Kalibrierung, mit der Verisens seine Position im Raum lernt und<br />
die Daten aus der Bildentzerrung auch im Raum anwenden kann.<br />
Damit wird eine letzte Herausforderung für Vision Guided Robotics<br />
gelöst: Der 2D-Vision Sensor muss einem 3D-Roboter Daten liefern.<br />
Es wäre nicht sehr nutzerfreundlich nur die Koordinaten der<br />
Bildebene nutzen zu können. Gerade ein Roboter benötigt auch<br />
Koordinaten in der Z-Achse, z. B. für den Greifer-Zugriff oder zur<br />
Erkennung von Markierungen. Dank Z-Kalibrierung ist die automatische<br />
Anpassung der Koordinaten in anderen Höhen möglich.<br />
Mit diesem innovativen Ansatz des automatischen Koordinatenabgleichs,<br />
der automatisieren Echtzeit-Bildentzerrung, der<br />
Umrechnung in Weltkoordinaten und Z-Kalibrierung, sind Vision<br />
Guided Robotics Anwendungen nun einfach realisierbar.<br />
Bilder: Aufmacher: attaphong – stock.adobe.com, Sonstige: Baumer Optronic GmbH<br />
www.baumer.com<br />
www.derkonstrukteur.de <strong>DER</strong> <strong>KONSTRUKTEUR</strong> <strong>2020</strong>/05 39
ROBOTIK<br />
ANTRIEB FÜR<br />
DR. ROBOTER<br />
Ob in der Fertigungstechnik, der Logistik oder im<br />
Haushalt – Roboter unterstützen den Menschen<br />
heute an verschiedenster Stelle. Den eingesetzten<br />
Antrieben wird dabei einiges abverlangt. Besonders<br />
hoch sind die Anforderungen in der Medizintechnik,<br />
schließlich führt Dr. Roboter immer öfter als Assistent<br />
des Arztes am Patienten Operationen durch. Es<br />
versteht sich von selbst, dass hier allerhöchste<br />
Präzision und Zuverlässigkeit gefragt sind.<br />
Um etwas zu bewegen, brauchen Roboter Antriebe, die<br />
allerdings vielseitige Anforderungen erfüllen müssen. Fast<br />
allen Anwendungen gemeinsam ist der geringe Einbauplatz<br />
und damit die Forderung nach kompakten und oft<br />
auch leichten Antriebseinheiten. Von den kleinen Antrieben werden<br />
meist dennoch hohe Drehmomente, gute Wiederholgenauigkeiten,<br />
große Dynamik und maximale Leistungsdichte gefordert. Gerade in<br />
der Zusammenarbeit mit menschlichen Kollegen müssen sie geräuscharm<br />
arbeiten, um die Konzentration nicht zu stören. Zudem<br />
sollen sie kommunikationsfreudig sein, damit sie sich mit anderen<br />
Komponenten im Roboter-Antriebsverbund zuverlässig „austauschen“<br />
können. Besondere Anwendungen fordern zudem zum Beispiel<br />
Unempfindlichkeit gegenüber Magnetfeldern, Vakuumfestigkeit<br />
oder geringen Energieverbrauch für den mobilen, batteriebetriebenen<br />
Einsatz. In manchen Fällen ist der zuverlässige Umgang mit Überlast<br />
bei hohen Drehzahlen gefragt. Je nach Anwendung müssen<br />
lange Verfahrwege oder Rotationen realisiert werden, sind selbsthemmende<br />
Antriebe gefordert oder solche mit extrem geringem<br />
Spiel. Andernorts ist die Sterilisierbarkeit der Antriebe essentiell.<br />
Kurz: die Anforderungen sind sehr vielfältig.<br />
Die Antriebsexperten von Faulhaber kennen all diese Ansprüche<br />
aus jahrelanger Praxiserfahrung und haben mittlerweile bei den<br />
unterschiedlichsten Robotiklösungen mitgewirkt. Die Einsatzbereiche<br />
der Antriebe gehen von Kanalisationsrobotern über Roboter für<br />
Handling und Logistik bis hin zu OP-Anwendungen.<br />
auch bei Operationen am Herz oder im Auge. Auch vor Haartransplantationen<br />
mach die Robotik nicht halt.<br />
Was für den Einsatz von Robotern im OP-Saal spricht, liegt auf der<br />
Hand: Ein Roboter wird nicht müde, bietet höchste Präzision und<br />
Schnelligkeit. Experten gehen davon aus, dass sie die Arbeit im OP<br />
künftig revolutionieren werden: Der Chirurg steuert dann von einer<br />
OP-Konsole via Joysticks die Roboterarme, die für den Eingriff am OP-<br />
Tisch eingesetzt werden. Auch nach einer 24-h-Schicht schneidet der<br />
Roboter absolut präzise und ohne Zittern. Rechnergestützt kann der<br />
Roboter jederzeit prüfen, ob der Arzt noch genau da operiert, wo es<br />
notwendig ist. Im Zweifel kann das System den Arzt stoppen und so<br />
potenzielle Behandlungsfehler verhindern. Hochdynamische, präzise<br />
Antriebssysteme sind für diesen Anwendungsfall gefragt. Faulhaber<br />
Antriebssysteme bieten hier dank ihrer eisenlosen Wicklungstechnik<br />
und flacher Drehzahl-/Drehmomentkennlinie die erforderlichen Eigenschaften<br />
wie etwa exakte Positionierung und Drehzahlkontrolle.<br />
0,1 MM<br />
OP-SCHNITTE<br />
HOCHDYNAMISCHE<br />
SYSTEME<br />
WENIGER<br />
BEHANDLUNGSFEHLER<br />
SPECIAL<br />
EINSATZBEREICH OP<br />
Mittlerweile gibt es kaum einen medizinischen Eingriff, bei dem ein<br />
roboter-unterstütztes Operieren nicht möglich wäre. Schon heute<br />
bieten mehr als 70 Unternehmen Systeme für verschiedenste Eingriffe<br />
an. So z. B. bei Eingriffen an der Wirbelsäule, dem Knie, der<br />
Hüfte, im Bauchraum, in der Neuro-Chirurgie, im Hals-Nasen-<br />
Ohren-Bereich, bei Biopsien, in der Gynäkologie und Urologie oder<br />
Autor: Dipl.-Ing. (BA) Andreas Seegen, Dr. Fritz Faulhaber GmbH & Co. KG,<br />
Schönaich und Dipl.-Ing. (FH) Nora Crocoll, Redaktionsbüro Stutensee<br />
DEUTLICH MEHR<br />
BEWEGUNGSFREIHEIT<br />
24/7<br />
ZITTERFREI<br />
UND PRÄZISE<br />
Bürstenlose DC-Flachmotoren mit integriertem Encoder Serie 3216 …<br />
BXT IEF3-4096 (1); sterilisierbare, bürstenlose DC-Servomotoren der<br />
Serie 2057… BA (2); DC-Kleinstmotoren Serie 1024 … SR (3)<br />
40 <strong>DER</strong> <strong>KONSTRUKTEUR</strong> <strong>2020</strong>/05 www.derkonstrukteur.de
ROBOTIK<br />
ANTRIEBSLÖSUNG FLEXIBEL ANGEPASST<br />
Leistungsstarke Motorfamilien wie die BX4 oder BP4 sowie<br />
die neue BXT-Baureihe von Faulhaber lassen sich kombiniert<br />
mit weiteren Komponenten wie verschiedenen Getrieben,<br />
optischen, magnetischen oder absoluten Encodern sowie<br />
Speed bzw. Motion Controllern flexibel an anspruchsvolle<br />
Robotikanwendungen anpassen. Einsatzgebiete finden sich<br />
in der Medizintechnik aber auch in vielen weiteren Bereichen.<br />
JAHRELANGE ERFAHRUNG SCHAFFT<br />
PRAXISGERECHTE LÖSUNGEN<br />
Je mehr robotergestütztes Operieren in unterschiedlichsten Disziplinen<br />
eingesetzt wird, desto mehr steigt auch der Bedarf an Antriebssystemen,<br />
etwa für die Positionierung von Roboterarmen. Hier<br />
sind hochdynamische Systeme gefragt, die in kürzester Zeit die volle<br />
Drehzahl liefern. Dass die Experten für Kleinstantriebe über ein riesiges<br />
Portfolio an innovativer Miniatur- und Mikroantriebstechnologie<br />
verfügen, kommt Anwendern zugute. Dank eines Baukastensystems<br />
lassen sich im Standardprogramm rasch individuell passende Lösungen<br />
bestehend aus Antrieb, Getriebeeinheit und Motion Controller<br />
zusammenstellen. Die Kleinstmotoren stehen mit Durchmessern<br />
von 6 bis 22 mm zur Verfügung und lassen sich für besondere Anforderungen<br />
zudem noch modifizieren. Zu den häufigsten Anpassungen<br />
gehören beispielsweise Vakuumtauglichkeit, Erweiterung des<br />
Temperaturbereichs, modifizierte Wellen, andere Spannungstypen<br />
sowie kundenspezifische Anschlüsse oder Stecker.<br />
Bilder: FAULHABER<br />
www.faulhaber.de<br />
PASSGENAUE MOTION-CONTROL-<br />
GESAMTLÖSUNGEN BIETEN<br />
ANWEN<strong>DER</strong>N EINEN MEHRWERT<br />
Entwicklungszyklen werden heute immer kürzer. Unsere<br />
Kunden haben selten Zeit, sich mit der Konzeption von<br />
Reglern oder der Integration von Encodern auseinanderzusetzen.<br />
Viele Robotikhersteller wissen es daher zu<br />
schätzen, dass sie in unserem Standardprogramm, das<br />
wie ein Baukastensystem aufgebaut ist, eine passgenaue<br />
Motion-Control-Gesamtlösung finden können.<br />
DIPL.-ING. (BA) ANDREAS SEEGEN, FAULHABER<br />
IMPRESSUM<br />
erscheint <strong>2020</strong> im 51. Jahrgang, ISSN 0344-4570<br />
Redaktion<br />
Chefredakteurin: Dipl.-Ing. (FH) Nicole Steinicke (ni),<br />
Tel.: 06131/992-350, E-Mail: n.steinicke@vfmz.de<br />
(verantwortlich für den redaktionellen Inhalt)<br />
Stv. Chefredakteurin: Dipl.-Ing. (FH) Martina Klein (mak),<br />
Tel.: 06131/992-201, E-Mail: m.klein@vfmz.de<br />
Redakteurin: Dipl.-Ing. (FH) Inga Ronsdorf (iro),<br />
Tel.: 06131/992-259, E-Mail: i.ronsdorf@vfmz.de<br />
Redaktionsassistenz: Doris Buchenau, Ulla Winter<br />
Tel.: 06131/992-347, E-Mail: u.winter@vfmz.de,<br />
Melanie Lerch, Petra Weidt,<br />
(Redaktionsadresse siehe Verlag)<br />
Gestaltung<br />
Mario Wüst, Sonja Daniel, Anette Fröder,<br />
Anna Schätzlein<br />
Chef vom Dienst<br />
Dipl.-Ing. (FH) Winfried Bauer<br />
Sales<br />
Oliver Jennen, Tel.: 06131/992-262,<br />
E-Mail: o.jennen@vfmz.de<br />
Andreas Zepig, Tel.: 06131/992-206,<br />
E-Mail: a.zepig@vfmz.de<br />
Heike Rauschkolb, Auftragsdisposition,<br />
Tel. 06131/992-241, E-Mail: h.rauschkolb@vfmz.de<br />
Anzeigenpreisliste Nr. 50: gültig ab 1. Oktober 2019<br />
Leserservice:<br />
vertriebsunion meynen GmbH & Co. KG,<br />
Große Hub 10, 65344 Eltville, Tel.: 06123/9238-266<br />
Bitte teilen Sie uns Anschriften- und sonstige<br />
Änderungen Ihrer Bezugsdaten schriftlich mit<br />
(Fax: 06123/9238-267, E-Mail: vfv@vertriebsunion.de).<br />
Preise und Lieferbedingungen:<br />
Einzelheftpreis: € 13,50 (zzgl. Versandkosten)<br />
Jahresabonnement: Inland: € 95,- (inkl. Versandkosten)<br />
Ausland: € 111,- (inkl. Versandkosten)<br />
Abonnements verlängern sich automatisch um ein<br />
weiteres Jahr, wenn sie nicht spätestens vier Wochen vor<br />
Ablauf des Bezugsjahres schriftlich gekündigt werden.<br />
Verlag<br />
Vereinigte Fachverlage GmbH<br />
Lise-Meitner-Straße 2, 55129 Mainz<br />
Postfach 100465, 55135 Mainz<br />
Tel.: 06131/992-0, Fax: 06131/992-100<br />
E-Mail: info@vfmz.de,<br />
www.vereinigte-fachverlage.de<br />
Handelsregister-Nr.: HRB 2270, Amtsgericht Mainz<br />
Umsatzsteuer-ID: DE149063659<br />
Ein Unternehmen der Cahensly Medien<br />
Geschäftsführer: Dr. Olaf Theisen<br />
Verlagsleiter: Dr. Michael Werner, Tel.: 06131/992-401<br />
Head of Sales: Beatrice Thomas-Meyer<br />
Tel.: 06131/992-265, E-Mail: b.thomas-meyer@vfmz.de<br />
(verantwortlich für den Anzeigenteil)<br />
Vertrieb: Sarina Grazin, Tel.: 06131/992-148,<br />
E-Mail: s.granzin@vfmz.de<br />
Druck und Verarbeitung<br />
Westdeutsche Verlags- und Druckerei GmbH<br />
Kurhessenstraße 4 - 6, 64546 Mörfelden-Walldorf<br />
Datenspeicherung<br />
Ihre Daten werden von der Vereinigte Fachverlage GmbH<br />
gespeichert, um Ihnen berufsbezogene, hochwertige Informationen<br />
zukommen zu lassen. Sowie möglicherweise<br />
von ausgewählten Unternehmen genutzt, um Sie<br />
über berufsbezogene Produkte und Dienstleistungen zu<br />
informieren. Dieser Speicherung und Nutzung kann jederzeit<br />
schriftlich beim Verlag widersprochen werden<br />
(vertrieb@vfmz.de).<br />
Die Zeitschrift sowie alle in ihr enthaltenen Beiträge<br />
und Abbildungen sind urheberrechtlich geschützt. Mit<br />
der Annahme des redaktionellen Contents (Texte, Fotos,<br />
Grafiken etc.) und seiner Veröffentlichung in dieser<br />
Zeitschrift geht das umfassende, ausschließliche, räumlich,<br />
zeitlich und inhaltlich unbeschränkte Nutzungsrecht<br />
auf den Verlag über. Dies umfasst insbesondere<br />
das Recht zur Veröffentlichung in Printmedien aller Art<br />
sowie entsprechender Vervielfältigung und Verbreitung,<br />
das Recht zur Bearbeitung, Umgestaltung und<br />
Übersetzung, das Recht zur Nutzung für eigene Werbezwecke,<br />
das Recht zur elektronischen/digitalen Verwertung,<br />
z. B. Einspeicherung und Bearbeitung in elektronischen<br />
Systemen, zur Veröffentlichung in Datennetzen<br />
sowie Datenträger jedweder Art, wie z. B. die Darstellung<br />
im Rahmen von Internet- und Online-Dienstleistungen,<br />
CD-ROM, CD und DVD und der Datenbanknutzung<br />
und das Recht, die vorgenannten Nutzungsrechte<br />
auf Dritte zu übertragen, d. h. Nachdruckrechte einzuräumen.<br />
Eine Haftung für die Richtigkeit des redaktionellen<br />
Contents kann trotz sorgfältiger Prüfung durch<br />
die Redaktion nicht übernommen werden. Signierte<br />
Beiträge stellen nicht unbedingt die Ansicht der Redaktion<br />
dar. Für unverlangt eingesandte Manuskripte kann<br />
keine Gewähr übernommen werden. Grundsätzlich<br />
dürfen nur Werke eingesandt werden, über deren Nutzungsrechte<br />
der Einsender verfügt, und die nicht gleichzeitig<br />
an anderer Stelle zur Veröffentlichung eingereicht<br />
oder bereits veröffentlicht wurden.<br />
Datenschutzerklärung: ds-vfv.vfmz.de<br />
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen.<br />
Mitglied der Informations-Gemeinschaft<br />
zur Feststellung der Verbreitung von<br />
Werbeträgern e. V. (IVW), Berlin.<br />
www.derkonstrukteur.de <strong>DER</strong> <strong>KONSTRUKTEUR</strong> <strong>2020</strong>/05 41
ROBOTIK<br />
NEUE HORIZONTE<br />
SPECIAL<br />
Kleine, leichte, kollaborierende Roboter – die<br />
sogenannten Cobots – sind auf dem Vormarsch.<br />
Mit zunehmender Automatisierung haben sie<br />
sich für verschiedenste Handhabungs- und<br />
Bearbeitungsaufgaben bewährt. Eine horizontale<br />
Achse soll jetzt ihren Aktionsradius erweitern<br />
und so ihr Einsatzgebiet noch um ein Vielfaches<br />
steigern.<br />
Cobots haben sich in der Automatisierungswelt als tatkräftige<br />
Mitarbeiter etabliert. Doch in der Regel sind sie nicht mobil<br />
und damit ist ihr Aktionsradius begrenzt. Diese Grenzen<br />
will Schaeffler nun verschieben. Der Antriebsspezialist hat<br />
eine Linearachse als Reichweitenverlängerung für die kleinen<br />
Roboterkollegen entwickelt. Schaeffler bietet sein Linearmodul als<br />
individuelle Komplettlösung an. Die kompakte, einbaufertige Linearachse<br />
besteht aus einem Tandemmodul MDKUVE, einer passenden<br />
Adapterplatte für den Cobot, einer passenden Motorgetriebe-<br />
Einheit, konfektionierten Motorkabeln, einer Schleppkette für alle<br />
Versorgungsleitungen des Cobots und dem Motorcontroller. Zur<br />
Anbindung an die Steuerung des Anwenders stehen die Schnittstellen<br />
Profibus, Profinet oder Ethercat zur Verfügung. Die Linearachse<br />
verfügt dabei über variable Anschlussmöglichkeiten für die Motor-/<br />
Getriebe-Einheit. Optional kann der Anwender neben der Schaeffler-<br />
Lösung auch seine eigene Antriebstechnik einsetzen.<br />
ANTRIEBE UND FÜHRUNGEN<br />
Die Linearachse ist, je nach Anforderung, in unterschiedlichen<br />
Längen, mit einem Kugelgewindeantrieb MDKUVE-KGT, einem<br />
Zahnriemenantrieb MDKUVE-3ZR oder optional auch mit einem<br />
Linearmotor als Antriebselement erhältlich.<br />
Bei dem Tandemmodul, Basis der Linearachse, wird der Führungsschlitten<br />
auf zwei parallel angeordneten Profilschienenführungen<br />
vom Typ KUVE (vierreihige Kugelumlaufeinheit) geführt. Aufgrund<br />
seiner kompakten Bauform ist es für den Einsatz unter hohen Tragund<br />
Momentenbelastungen und daher für den Einsatz im Bereich<br />
kollaborativer Roboter bestens geeignet. Verbunden mit einem<br />
Dreifach-Zahnriemenantrieb bieten Tandemmodule die höchstmögliche<br />
Zuverlässigkeit in der Anwendung.<br />
Bei höchsten Anforderungen an Tragfähigkeit und Momentenbelastbarkeit<br />
gibt es optional die Möglichkeit, den Führungsschlitten<br />
mit der sechsreihigen Kugelumlaufeinheit KUSE..-XL in X-life-<br />
Qualität als Führungssystem einzusetzen.<br />
VERFAHRWEGE, GESCHWINDIGKEITEN,<br />
WIE<strong>DER</strong>HOLGENAUIGKEITEN<br />
Je nach Antrieb sind die Linearachsen in verschiedenen Längen erhältlich.<br />
Es lassen sich sogar mehrteilige Achsen realisieren, um bei<br />
Bedarf längere Strecken abdecken zu können. Somit lässt sich die<br />
kompakte Linearachse problemlos in neue oder bestehende Automatisierungslösungen<br />
einbinden. Optional bietet Schaeffler dazu<br />
auch einen Montage- und Installationsservice an.<br />
Tandemmodule mit Kugelgewindeantrieb sind bis zu einer Länge<br />
von max. 5,9 m erhältlich. Die Wiederholgenauigkeit liegt bei<br />
0,025 mm und die erreichbare Geschwindigkeit bei 1,7 m/s. Mit<br />
dem Zahnriemenantrieb lassen sich sogar bis zu 18 m lange,<br />
ALS MEHRTEILIGE KONSTRUKTION<br />
SIND VERFAHRWEGE BIS ZU<br />
18 METERN MÖGLICH<br />
mehrteilige Linearachsen realisieren, um besonders lange Verfahrwege<br />
zu ermöglichen. Hier können hohe Geschwindigkeiten<br />
von bis zu 5 m/s erzielt werden. Die Wiederholgenauigkeit beträgt<br />
± 0,1 mm.<br />
NICHT NUR FÜR ROBOTER<br />
Die einbaufertigen Linearachsen können aber nicht nur den Aktionsradius<br />
von Robotern erweitern. Aufgrund ihrer kompakten Bauart<br />
und ihrer Leistungsstärke kommen sie z. B. auch in der Peripherie<br />
von Handhabungs- und Montagevorrichtungen sowie in der Fabrik -<br />
automation zum Einsatz.<br />
Bild: Schaeffler, Hintergund: DrHitch – stock.adobe.com<br />
www.schaeffler.de<br />
42 <strong>DER</strong> <strong>KONSTRUKTEUR</strong> <strong>2020</strong>/05 www.derkonstrukteur.de
VORSCHAU<br />
IM NÄCHSTEN HEFT: 06/<strong>2020</strong><br />
ERSCHEINUNGSTERMIN: 03. 06. <strong>2020</strong> • ANZEIGENSCHLUSS: 15. 05. <strong>2020</strong><br />
01<br />
03<br />
04<br />
02<br />
01 Linearführungen, Rundtischlager und Energieketten aus<br />
Hochleistungskunststoff machen Schweißroboter wartungsfrei<br />
Bild: igus GmbH<br />
02 Ein Sondermaschinenbauer und Systemintegrator setzt<br />
auf die Automatisierung mit Cobots<br />
Bild: Universal Robots GmbH<br />
<strong>DER</strong> DIREKTE WEG<br />
INTERNET:<br />
www.DerKonstrukteur.de<br />
E-PAPER:<br />
digital.derkonstrukteur.de<br />
REDAKTION:<br />
n.steinicke@vfmz.de<br />
WERBUNG:<br />
sales@vfmz.de<br />
SOZIALE NETZWERKE:<br />
www.Facebook.com/DerKonstrukteur<br />
www.twitter.com/derkonstrukteu<br />
03 Induktive Näherungsschalter sind mehr als messende<br />
oder schaltende Schrauben<br />
Bild: Balluff GmbH<br />
04 Nichts ist unmöglich: Ein Spezialist für Industrie- und<br />
Präzisionskupplungen löst auch knifflige Kupplungsaufgaben<br />
Bild: R+W Antriebselemente GmbH<br />
(Änderungen aus aktuellem Anlass vorbehalten)<br />
www.derkonstrukteur.de <strong>DER</strong> <strong>KONSTRUKTEUR</strong> <strong>2020</strong>/05 43
MULTIMEDIAL VERNETZT<br />
KUNDEN GEWINNEN!<br />
FÖR<strong>DER</strong>TECHNIK<br />
MATERIALFLUSS<br />
LOGISTIK<br />
FLUIDTECHNIK<br />
Profitieren Sie von unserem<br />
einmaligen Mediennetzwerk!<br />
Bitte kontaktieren Sie mich, ich berate Sie gerne!<br />
Carmen Nawrath<br />
Leitung Zentrales Marketing<br />
& Corporate Services<br />
Telefon: 0049/6131/992-245<br />
c.nawrath@vfmz.de