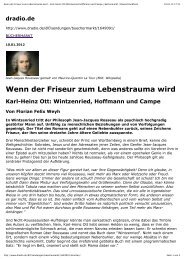Geistiges Eigentum und die Entwicklung der ... - Florian Felix Weyh
Geistiges Eigentum und die Entwicklung der ... - Florian Felix Weyh
Geistiges Eigentum und die Entwicklung der ... - Florian Felix Weyh
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
520 <strong>Florian</strong> <strong>Felix</strong> <strong>Weyh</strong><br />
2. Kein Zufall ist es, daß <strong>die</strong> <strong>Entwicklung</strong> von <strong>der</strong> schreibenden Zunft ausgeht,<br />
von Verlegern <strong>und</strong> Buchhändlern, Schriftstellern, Philosophen <strong>und</strong> Theologen.<br />
Musik <strong>und</strong> Malerei, <strong>die</strong> prinzipiell unter den gleichen Bedingungen leiden, werden<br />
von <strong>der</strong> technischen <strong>Entwicklung</strong> weniger schnell unter Druck gesetzt. Die schöpferische<br />
Arbeit eines Malers schlägt sich im einzelnen Werkstück nie<strong>der</strong> <strong>und</strong> wird<br />
mit <strong>die</strong>sem zusammen als Einheit verkauft; wie käme er auf <strong>die</strong> Idee, daß ihm<br />
nach dem Verkauf etwas zurückbleibe? Diese Überlegung taucht erst bei Walter<br />
Benjamin auf, dem das „Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit"<br />
substantiell bedroht scheint. Auch dem Komponisten bedeutet <strong>die</strong> Arbeit<br />
des Notenverlegers zunächst wenig. Sie erweitert seinen Bekanntheitsgrad, nicht<br />
seinen Reichtum; <strong>die</strong> großen Werke <strong>der</strong> Zeit entstehen als Auftragsarbeiten von<br />
Klerus <strong>und</strong> Adel. Erst mit <strong>der</strong> Erfindung veristischer Aufzeichnungsme<strong>die</strong>n<br />
- Schallplatte <strong>und</strong> Fotografie - holt <strong>die</strong> Problematik <strong>die</strong>se beiden Kunstgattungen<br />
ein.<br />
Diejenigen, <strong>die</strong> gegen ein Urheberrecht in jeglicher Form opponieren - das<br />
sind nicht wenige -, wissen gute Argumente auf ihrer Seite. Sie verteidigen <strong>die</strong><br />
Trias Weisheit-Wahrheit-Erkenntnis, <strong>die</strong> man nicht an <strong>die</strong> kurze Leine eines Besitzverhältnisses<br />
legen dürfe. Ein fast manichäisches Bild: Hie <strong>die</strong> Wahrheit, traditionelle<br />
Bestimmung allen Denkens, da <strong>der</strong> Warencharakter, neue Zielvorstellung<br />
<strong>der</strong> Copyright Industries.<br />
Früh legt sich <strong>der</strong> materialistische Schleier <strong>der</strong> industriellen Revolution über<br />
<strong>die</strong> gewachsenen Werte. Um wenigstens einen Teil <strong>der</strong> Wahrheit vor dem Ausverkauf<br />
zu schützen, einigt man sich auf das „Prinzip <strong>der</strong> unvollständigen Veräußerung"<br />
als Theorie des Transfers. Danach gibt <strong>der</strong> Autor <strong>die</strong> Früchte seiner<br />
Arbeit weg, doch bleibt ihm <strong>der</strong> Geist des Werkes zurück. Dieser ist nicht dingfest<br />
zu machen, damit unübertragbar <strong>und</strong> durchzieht <strong>die</strong> nachfolgenden Urheberrechtsdiskussionen<br />
in vielfältiger Gestalt. Mal juristisch, wie im kontinentalen<br />
Urheberrecht als Persönlichkeitsrecht; mal philosophisch als Erkenntnisanteil, <strong>der</strong><br />
sich durch <strong>die</strong> Vermittlung von Zeichen nicht auf den Empfänger überträgt. Verblüffend<br />
mo<strong>der</strong>n, nämlich <strong>der</strong> Semiotik unserer Tage angenähert, klingen <strong>die</strong> Sätze<br />
des Politik- <strong>und</strong> Finanzwissenschaftlers Johann August Schlettwein aus dem Jahre<br />
1784:<br />
„Der Gedanke, den <strong>der</strong> andre durch meine Mittheilung o<strong>der</strong> durch das Zeichen, das ich<br />
seinen Organen darstelle, in seiner Seele empfängt, ist nicht <strong>der</strong> nehmliche Gedanke, den<br />
ich hatte: den behalte ich, wie ich ihn hatte. (...) Meine denkende Kraft wirkt nicht den<br />
Gedanken in <strong>der</strong> Seele des an<strong>der</strong>n, seine eigene Denkkraft wirkt ihn. Also ist <strong>die</strong>ser<br />
Gedanke in <strong>der</strong> Seele des An<strong>der</strong>n nicht mein Eigenthum. (...) Ich lege ihm nur ein Zeichen<br />
meines Gedankens hin, <strong>und</strong> seine eigene Denkungsart bildet daraus einen Gedanken, <strong>der</strong><br />
dem meinigen ähnlich ist, o<strong>der</strong> Kopie von dem meinigen darstellt." 3<br />
Selbst <strong>die</strong> Vererbung geistigen Besitzes bezieht sich implizit auf <strong>die</strong>ses Prinzip.<br />
Während je<strong>der</strong> karge Acker über Generationen unangefochten an Kin<strong>der</strong> <strong>und</strong><br />
3 Zit. in Bosse, S. 57.