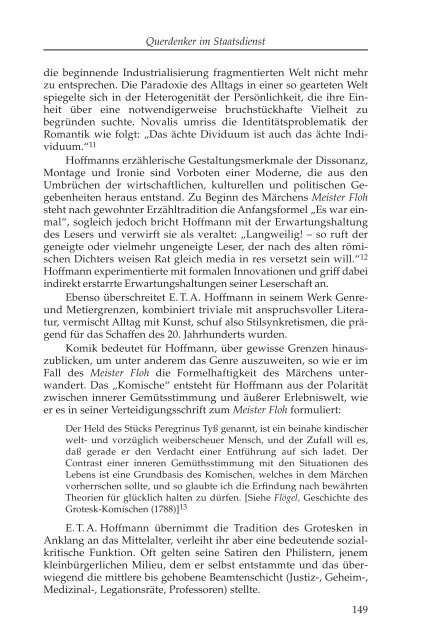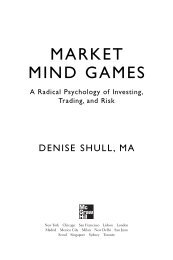ETA Hoffmann (1776 – 1822): Querdenker im Staatsdienst - Manz
ETA Hoffmann (1776 – 1822): Querdenker im Staatsdienst - Manz
ETA Hoffmann (1776 – 1822): Querdenker im Staatsdienst - Manz
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
<strong>Querdenker</strong> <strong>im</strong> <strong>Staatsdienst</strong><br />
die beginnende Industrialisierung fragmentierten Welt nicht mehr<br />
zu entsprechen. Die Paradoxie des Alltags in einer so gearteten Welt<br />
spiegelte sich in der Heterogenität der Persönlichkeit, die ihre Einheit<br />
über eine notwendigerweise bruchstückhafte Vielheit zu<br />
begründen suchte. Novalis umriss die Identitätsproblematik der<br />
Romantik wie folgt: „Das ächte Dividuum ist auch das ächte Individuum.“<br />
11<br />
<strong>Hoffmann</strong>s erzählerische Gestaltungsmerkmale der Dissonanz,<br />
Montage und Ironie sind Vorboten einer Moderne, die aus den<br />
Umbrüchen der wirtschaftlichen, kulturellen und politischen Gegebenheiten<br />
heraus entstand. Zu Beginn des Märchens Meister Floh<br />
steht nach gewohnter Erzähltradition die Anfangsformel „Es war einmal“,<br />
sogleich jedoch bricht <strong>Hoffmann</strong> mit der Erwartungshaltung<br />
des Lesers und verwirft sie als veraltet: „Langweilig! <strong>–</strong> so ruft der<br />
geneigte oder vielmehr ungeneigte Leser, der nach des alten römischen<br />
Dichters weisen Rat gleich media in res versetzt sein will.“ 12<br />
<strong>Hoffmann</strong> exper<strong>im</strong>entierte mit formalen Innovationen und griff dabei<br />
indirekt erstarrte Erwartungshaltungen seiner Leserschaft an.<br />
Ebenso überschreitet E. T. A. <strong>Hoffmann</strong> in seinem Werk Genreund<br />
Metiergrenzen, kombiniert triviale mit anspruchsvoller Literatur,<br />
vermischt Alltag mit Kunst, schuf also Stilsynkretismen, die prägend<br />
für das Schaffen des 20. Jahrhunderts wurden.<br />
Komik bedeutet für <strong>Hoffmann</strong>, über gewisse Grenzen hinauszublicken,<br />
um unter anderem das Genre auszuweiten, so wie er <strong>im</strong><br />
Fall des Meister Floh die Formelhaftigkeit des Märchens unterwandert.<br />
Das „Komische“ entsteht für <strong>Hoffmann</strong> aus der Polarität<br />
zwischen innerer Gemütsst<strong>im</strong>mung und äußerer Erlebniswelt, wie<br />
er es in seiner Verteidigungsschrift zum Meister Floh formuliert:<br />
Der Held des Stücks Peregrinus Tyß genannt, ist ein beinahe kindischer<br />
welt- und vorzüglich weiberscheuer Mensch, und der Zufall will es,<br />
daß gerade er den Verdacht einer Entführung auf sich ladet. Der<br />
Contrast einer inneren Gemüthsst<strong>im</strong>mung mit den Situationen des<br />
Lebens ist eine Grundbasis des Komischen, welches in dem Märchen<br />
vorherrschen sollte, und so glaubte ich die Erfindung nach bewährten<br />
Theorien für glücklich halten zu dürfen. [Siehe Flögel, Geschichte des<br />
Grotesk-Komischen (1788)] 13<br />
E. T. A. <strong>Hoffmann</strong> übern<strong>im</strong>mt die Tradition des Grotesken in<br />
Anklang an das Mittelalter, verleiht ihr aber eine bedeutende sozialkritische<br />
Funktion. Oft gelten seine Satiren den Philistern, jenem<br />
kleinbürgerlichen Milieu, dem er selbst entstammte und das überwiegend<br />
die mittlere bis gehobene Beamtenschicht (Justiz-, Gehe<strong>im</strong>-,<br />
Medizinal-, Legationsräte, Professoren) stellte.<br />
149