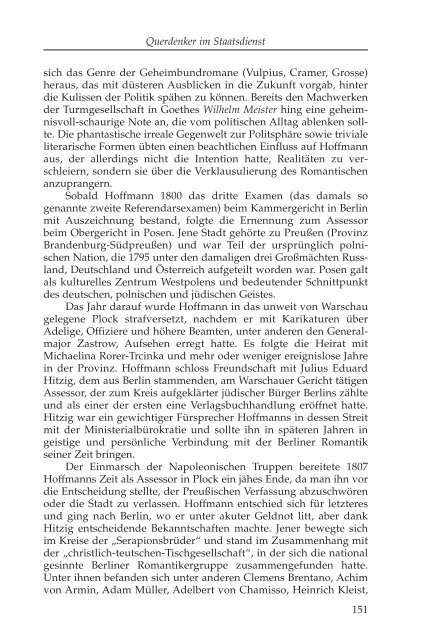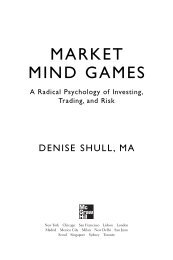ETA Hoffmann (1776 – 1822): Querdenker im Staatsdienst - Manz
ETA Hoffmann (1776 – 1822): Querdenker im Staatsdienst - Manz
ETA Hoffmann (1776 – 1822): Querdenker im Staatsdienst - Manz
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
<strong>Querdenker</strong> <strong>im</strong> <strong>Staatsdienst</strong><br />
sich das Genre der Gehe<strong>im</strong>bundromane (Vulpius, Cramer, Grosse)<br />
heraus, das mit düsteren Ausblicken in die Zukunft vorgab, hinter<br />
die Kulissen der Politik spähen zu können. Bereits den Machwerken<br />
der Turmgesellschaft in Goethes Wilhelm Meister hing eine gehe<strong>im</strong>nisvoll-schaurige<br />
Note an, die vom politischen Alltag ablenken sollte.<br />
Die phantastische irreale Gegenwelt zur Politsphäre sowie triviale<br />
literarische Formen übten einen beachtlichen Einfluss auf <strong>Hoffmann</strong><br />
aus, der allerdings nicht die Intention hatte, Realitäten zu verschleiern,<br />
sondern sie über die Verklausulierung des Romantischen<br />
anzuprangern.<br />
Sobald <strong>Hoffmann</strong> 1800 das dritte Examen (das damals so<br />
genannte zweite Referendarsexamen) be<strong>im</strong> Kammergericht in Berlin<br />
mit Auszeichnung bestand, folgte die Ernennung zum Assessor<br />
be<strong>im</strong> Obergericht in Posen. Jene Stadt gehörte zu Preußen (Provinz<br />
Brandenburg-Südpreußen) und war Teil der ursprünglich polnischen<br />
Nation, die 1795 unter den damaligen drei Großmächten Russland,<br />
Deutschland und Österreich aufgeteilt worden war. Posen galt<br />
als kulturelles Zentrum Westpolens und bedeutender Schnittpunkt<br />
des deutschen, polnischen und jüdischen Geistes.<br />
Das Jahr darauf wurde <strong>Hoffmann</strong> in das unweit von Warschau<br />
gelegene Plock strafversetzt, nachdem er mit Karikaturen über<br />
Adelige, Offiziere und höhere Beamten, unter anderen den Generalmajor<br />
Zastrow, Aufsehen erregt hatte. Es folgte die Heirat mit<br />
Michaelina Rorer-Trcinka und mehr oder weniger ereignislose Jahre<br />
in der Provinz. <strong>Hoffmann</strong> schloss Freundschaft mit Julius Eduard<br />
Hitzig, dem aus Berlin stammenden, am Warschauer Gericht tätigen<br />
Assessor, der zum Kreis aufgeklärter jüdischer Bürger Berlins zählte<br />
und als einer der ersten eine Verlagsbuchhandlung eröffnet hatte.<br />
Hitzig war ein gewichtiger Fürsprecher <strong>Hoffmann</strong>s in dessen Streit<br />
mit der Ministerialbürokratie und sollte ihn in späteren Jahren in<br />
geistige und persönliche Verbindung mit der Berliner Romantik<br />
seiner Zeit bringen.<br />
Der Einmarsch der Napoleonischen Truppen bereitete 1807<br />
<strong>Hoffmann</strong>s Zeit als Assessor in Plock ein jähes Ende, da man ihn vor<br />
die Entscheidung stellte, der Preußischen Verfassung abzuschwören<br />
oder die Stadt zu verlassen. <strong>Hoffmann</strong> entschied sich für letzteres<br />
und ging nach Berlin, wo er unter akuter Geldnot litt, aber dank<br />
Hitzig entscheidende Bekanntschaften machte. Jener bewegte sich<br />
<strong>im</strong> Kreise der „Serapionsbrüder“ und stand <strong>im</strong> Zusammenhang mit<br />
der „christlich-teutschen-Tischgesellschaft“, in der sich die national<br />
gesinnte Berliner Romantikergruppe zusammengefunden hatte.<br />
Unter ihnen befanden sich unter anderen Clemens Brentano, Ach<strong>im</strong><br />
von Armin, Adam Müller, Adelbert von Chamisso, Heinrich Kleist,<br />
151