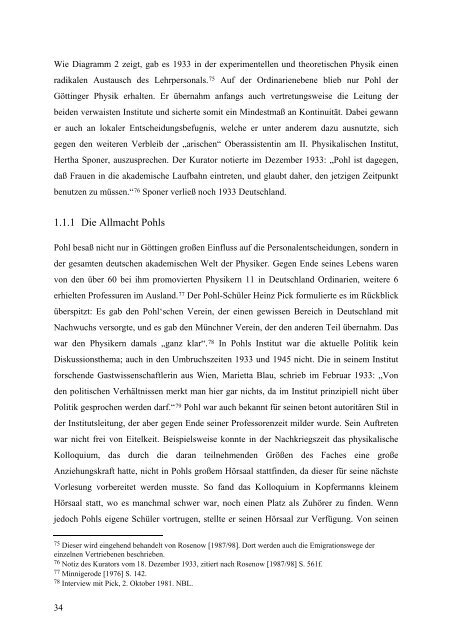- Seite 1 und 2: Die Nazifizierung und Entnazifizier
- Seite 3 und 4: Inhaltsverzeichnis 0 Einleitung ...
- Seite 5 und 6: 5.4 Entnazifizierung des Instituts
- Seite 7 und 8: dann auch der Begriff Entnazifizier
- Seite 9 und 10: Professorenschaft aufweist. 18 Die
- Seite 11 und 12: mit unzulässigen Abweichungen fert
- Seite 13 und 14: Verhältnis der deutschen und ameri
- Seite 15 und 16: die Personalentwicklung, insbesonde
- Seite 17 und 18: wirkten. 42 Das Geschehen an den Ph
- Seite 19 und 20: Auf Grund dieser Ausgangslage ergeb
- Seite 21 und 22: Doktoranden. Er entschied über all
- Seite 23 und 24: Ministerium und andere Verbindungen
- Seite 25 und 26: � fachliche Betreuung bei Habilit
- Seite 27 und 28: 1 Der Lehrkörper - eine kollegiale
- Seite 29 und 30: � Erstes Physikalisches Institut
- Seite 31 und 32: I. Physikalisches Institut II. Phys
- Seite 33: 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
- Seite 37 und 38: Professur an der Berliner Universit
- Seite 39 und 40: diskutierten universitären Anträg
- Seite 41 und 42: Nationalsozialismus gegenüber zu b
- Seite 43 und 44: darin gar nicht erwähnt, stattdess
- Seite 45 und 46: Bekräftigung wird am Ende der Beru
- Seite 47 und 48: Aus der Sicht des Ministeriums gab
- Seite 49 und 50: hatten. Darauf wird noch näher ein
- Seite 51 und 52: für fast alle Lehrstühle in Deuts
- Seite 53 und 54: sein Urteil vorsichtiger und hielt
- Seite 55 und 56: Plastizität und Kondensation. Beka
- Seite 57 und 58: Die Gewichtung dieser Faktoren fiel
- Seite 59 und 60: diesen Aufgaben aufgeht und daß es
- Seite 61 und 62: Physik, so zum Beispiel über elekt
- Seite 63 und 64: Das Ergebnis war, dass sich die Ver
- Seite 65 und 66: Pflichtauffassung, obwohl Mattauch
- Seite 67 und 68: sondern auch auf die Kollegen packe
- Seite 69 und 70: Nach der Promotion wechselte er ins
- Seite 71 und 72: auftrat. Kopfermann war in der Verf
- Seite 73 und 74: Sonderauftrag reklamiert und forsch
- Seite 75 und 76: hängigkeit der lichtelektrischen L
- Seite 77 und 78: die TH Danzig vorausgegangen, von d
- Seite 79 und 80: Eisenkristallen, die er mit Hilfe v
- Seite 81 und 82: politische Betätigung Hellweges wu
- Seite 83 und 84: Partei überführt. Dem NSDStB geh
- Seite 85 und 86:
führten. Im Protokoll heißt es:
- Seite 87 und 88:
Assistentinnen in Elektrophysik, au
- Seite 89 und 90:
RM für wissenschaftliche Hilfstät
- Seite 91 und 92:
schaftlichen und charakterlichen An
- Seite 93 und 94:
etten ist, findet sich eine Fülle
- Seite 95 und 96:
mathematisch-naturwissenschaftliche
- Seite 97 und 98:
Die Selbstdefinitionen der Götting
- Seite 99 und 100:
noch besäßen. 347 Tatsächlich wu
- Seite 101 und 102:
Kreisausschuss. 354 Hier wurde der
- Seite 103 und 104:
1.3.2.1 Die Entlassung Hellweges He
- Seite 105 und 106:
in Folge persönlicher Verschiedenh
- Seite 107 und 108:
espektiere die Forschungsergebnisse
- Seite 109 und 110:
Neben dem allgemeinen Bemühen nach
- Seite 111 und 112:
eine Stelle nur dann verliehen werd
- Seite 113 und 114:
damaligen Aufenthaltsort, weshalb s
- Seite 115 und 116:
zu verstehen: mental und räumlich.
- Seite 117 und 118:
„automatisch“ Parteigenosse und
- Seite 119 und 120:
kollegiale Netz fand Jordan seine e
- Seite 121 und 122:
Studienzeit war er nach eigenen Ang
- Seite 123 und 124:
„H. ist Mischling 2. Grades, ehem
- Seite 125 und 126:
und klassifizierten ihn folglich al
- Seite 127 und 128:
haben kommen lassen, nicht aus poli
- Seite 129 und 130:
dass das Nachdenken über die Betei
- Seite 131 und 132:
angewandte Mechanik (siehe Abschnit
- Seite 133 und 134:
Sympathien für die Erziehungsmetho
- Seite 135 und 136:
Mitverantwortung für die Entwicklu
- Seite 137 und 138:
1.3.4.8 Die Suche nach Stellen für
- Seite 139 und 140:
erwarteten sie sein Eintreffen. 547
- Seite 141 und 142:
eleuchtender Begriff, denn er beinh
- Seite 143 und 144:
Komponente in der Organisation der
- Seite 145 und 146:
Heidelberg wechselte, vertrat Pick
- Seite 147 und 148:
sichern. Auf Pohl hätte er vermutl
- Seite 149 und 150:
[Partei-] Vorträge in aussenpoliti
- Seite 151 und 152:
esonders dankbar, daß es mir verg
- Seite 153 und 154:
Entlassung] zu ergänzen.“ 611 Di
- Seite 155 und 156:
Auf den eigentlichen Inhalt der Arb
- Seite 157 und 158:
Der angewandte Physiker Erwin Meyer
- Seite 159 und 160:
ildeten eine Konstante in Kopferman
- Seite 161 und 162:
Anfang 1951 zum außerplanmäßigen
- Seite 163 und 164:
demgegenüber die ersten Schritte i
- Seite 165 und 166:
Gerechtigkeit und Heisenberg - der
- Seite 167 und 168:
erschien, 674 befürchtete man auf
- Seite 169 und 170:
Seite der Beziehung. Szenen einer F
- Seite 171 und 172:
Der Einladung voraus gegangen waren
- Seite 173 und 174:
Wirkung. Kemble nahm Abstand von ei
- Seite 175 und 176:
2 Die Studenten - der Familiennachw
- Seite 177 und 178:
und betrieb, 707 sondern auch in ih
- Seite 179 und 180:
140 120 100 80 60 40 20 0 SS 30 Dia
- Seite 181 und 182:
Der Vergleich der Gesamtstudentenza
- Seite 183 und 184:
ewirkte die Vertreibung der Juden u
- Seite 185 und 186:
Entwicklung nicht unverändert fort
- Seite 187 und 188:
Jahr 740 davon stu- gesamt dierwill
- Seite 189 und 190:
22 der damals 23 existierenden Hoch
- Seite 191 und 192:
Entgegen den allgemein sinkenden St
- Seite 193 und 194:
Studienverkürzung war die Einführ
- Seite 195 und 196:
vom Ministerium angeregten Studienb
- Seite 197 und 198:
Semester Universitäten Technische
- Seite 199 und 200:
2.3 Die Nachkriegszeit 2.3.1 Zur po
- Seite 201 und 202:
der Inhalt der Kritik, als der Char
- Seite 203 und 204:
Inhalt des Artikels. Der Fall zeigt
- Seite 205 und 206:
herrühren. Er warnt davor, in jede
- Seite 207 und 208:
Abiturzeugnisse der Bewerber kein g
- Seite 209 und 210:
Bahnhofsnähe befindlichen geologis
- Seite 211 und 212:
und den Entschluss zu stärken, fü
- Seite 213 und 214:
Im WS 1945/46 nahm die Universität
- Seite 215 und 216:
diese sich auch in Charakter und Pe
- Seite 217 und 218:
manchmal mit Tricks von Trawinski,
- Seite 219 und 220:
1946 eine scharfe Kritik mit dem Ti
- Seite 221 und 222:
1947 wieder aufgehoben. Eine sorgf
- Seite 223 und 224:
2.3.4 Abschreckung und formale Able
- Seite 225 und 226:
Die Richtlinien zeigen deutlich, da
- Seite 227 und 228:
ausländischer Studenten als unsach
- Seite 229 und 230:
Frau Schleichers Sohn sich wie alle
- Seite 231 und 232:
Universitäten studiert haben, fern
- Seite 233 und 234:
worden wären, wurde jedoch abgeleh
- Seite 235 und 236:
Chemiker mussten dagegen ein „gut
- Seite 237 und 238:
Studium Berufenen rechnen müssen!
- Seite 239 und 240:
werden. Die Frage der bevorzugten G
- Seite 241 und 242:
Leistungsprinzip. Es wurde nämlich
- Seite 243 und 244:
Prüfer, dass Eignung und Charakter
- Seite 245 und 246:
kapitulierte, Charakter und Wahrhaf
- Seite 247 und 248:
wichtigen Zweck dieser Sorgfalt hin
- Seite 249 und 250:
Mensch, der offen ist, erschütteru
- Seite 251 und 252:
„Die Haltung des größten Teiles
- Seite 253 und 254:
verschiedenen Fächer wurden demgeg
- Seite 255 und 256:
sich also vor allem um ältere Stud
- Seite 257 und 258:
Math.-Nat. Fakultät von 195 Bewerb
- Seite 259 und 260:
2.3.8 Die Normalisierung und das st
- Seite 261 und 262:
studierende Frauen vor allem unter
- Seite 263 und 264:
Der Rückgang der Studentinnenzahle
- Seite 265 und 266:
1935 wurde ein Reichsarbeitsdienst-
- Seite 267 und 268:
eiche Eltern leisteten sich ein Stu
- Seite 269 und 270:
Verheiratete Frauen wurden bis 1938
- Seite 271 und 272:
dem Überfall auf Polen im Septembe
- Seite 273 und 274:
erichtet Rektor Plischke im Sommer
- Seite 275 und 276:
Frauenanteil an allen Fächern, der
- Seite 277 und 278:
Überhaupt gibt es kaum tiefer grei
- Seite 279 und 280:
Schon im Sommer 1945 wurden in der
- Seite 281 und 282:
das erste Nachkriegssemester gibt f
- Seite 283 und 284:
1 1 5 b M 3 M 1 A 1 1 P 1 B 1 1 1 1
- Seite 285 und 286:
lieben von den 27 sich im SS 1944 i
- Seite 287 und 288:
Es gibt zwar keine Studie über die
- Seite 289 und 290:
und jedes Denken überhaupt, es man
- Seite 291 und 292:
wurde, lässt auf eine gewisse Akze
- Seite 293 und 294:
nicht unbedingt wahrgenommen haben.
- Seite 295 und 296:
Physik gesamt Physik männlich Phys
- Seite 297 und 298:
Entwicklungen sichtbar werden.“ 1
- Seite 299 und 300:
Auch der erste Jahrgang der Physika
- Seite 301 und 302:
Einen ersten gedrängten aber doch
- Seite 303 und 304:
RLM. 1284 1943 war Pohl als Obmann
- Seite 305 und 306:
finanziellen Unterstützung lässt
- Seite 307 und 308:
Deutschland durchgeführten Forschu
- Seite 309 und 310:
physikalische Forschung als Ganzes
- Seite 311 und 312:
gebracht, wo sie bis Anfang 1946 in
- Seite 313 und 314:
Mitarbeitern Smythe, Gerard Kuiper
- Seite 315 und 316:
Anwendungen elektromagnetischer, in
- Seite 317 und 318:
3.2.3 Die Fortsetzung der Forschung
- Seite 319 und 320:
Kontrolloffizier Sutton, der sich m
- Seite 321 und 322:
durch Frenkel, Joffe und Nordheim.
- Seite 323 und 324:
eeinflusst werden. Eine technische
- Seite 325 und 326:
dieser Theorie gar kein tieferes In
- Seite 327 und 328:
im Text ein Name nur beiläufig erw
- Seite 329 und 330:
Rögener Glaser & Lehrfeldt [1936];
- Seite 331 und 332:
Witt [1950] Glaser & Lehfeldt [1936
- Seite 333 und 334:
Gudden, Bernhard [1934] Ergebn. exa
- Seite 335 und 336:
Smakula, Alexander [1927] Zeitschri
- Seite 337 und 338:
Fan, H. Y. & M. Becker [1949] Physi
- Seite 339 und 340:
Meyer, W. & H. Neldel [1937] Z. tec
- Seite 341 und 342:
Wagner, C. [1933]a Zeitschrift für
- Seite 343 und 344:
Forschung wurde, sich von Pohl schr
- Seite 345 und 346:
Bändermodell zu benutzen. Wir schl
- Seite 347 und 348:
eingefügten Kapitel 19 zur Quanten
- Seite 349 und 350:
Obwohl Pohl das Niveauschema als m
- Seite 351 und 352:
Arbeiten galten unter anderem der W
- Seite 353 und 354:
Krenzien [1949]a Krenzien [1949]b K
- Seite 355 und 356:
zwischen den de-Broglie-Wellenläng
- Seite 357 und 358:
nicht zitierte. Zur Veranschaulichu
- Seite 359 und 360:
untersuchte er zusammen mit Peter P
- Seite 361 und 362:
Apparat ausgebreitet. Auf der einen
- Seite 363 und 364:
vermeidet also, eine bestimmte bild
- Seite 365 und 366:
Endlose verdünnt würden. 1480 Bot
- Seite 367 und 368:
einfachen Zusammenhängen, nach kla
- Seite 369 und 370:
teilweise zu weit gegangen. 1502 Ab
- Seite 371 und 372:
Zentrums. 1511 Diese einfachere Erk
- Seite 373 und 374:
3.4.1 Behandlung grundsätzlicher p
- Seite 375 und 376:
Joos vertrage ich mich auch so weit
- Seite 377 und 378:
ehandelten vor allem die unterschie
- Seite 379 und 380:
Quanten-Biologie zu etablieren, lie
- Seite 381 und 382:
nach Göttingen geliefert werden. 1
- Seite 383 und 384:
Goudsmit wollte eines der deutschen
- Seite 385 und 386:
Branch unter der tatkräftigen Unte
- Seite 387 und 388:
neue physikalische Probleme erwarte
- Seite 389 und 390:
4 Das Lehrangebot: mehr als ein Spi
- Seite 391 und 392:
Göttingen berufene Mathmatiker Fra
- Seite 393 und 394:
Wegen der schlechten Mathematikkenn
- Seite 395 und 396:
potentiellen Energie »erfaßt«.
- Seite 397 und 398:
wurden. „Auf diese Weise entwicke
- Seite 399 und 400:
Naturwissenschaftlern das mathemati
- Seite 401 und 402:
Grundstrukturen zurückführt und d
- Seite 403 und 404:
erklären?« haben seine Mitarbeite
- Seite 405 und 406:
kurzzeitig einige Bedeutung erhielt
- Seite 407 und 408:
edurften. Während die Geisteswisse
- Seite 409 und 410:
Semester Vorlesungen für Hörer al
- Seite 411 und 412:
Errungenschaften der Naturwissensch
- Seite 413 und 414:
Programm. 1662 Die Universität ern
- Seite 415 und 416:
Die vorwiegend nationalkonservativ
- Seite 417 und 418:
daraus eine naturalisierende Rechtf
- Seite 419 und 420:
Die Liebe eröffne den Weg zur Buß
- Seite 421 und 422:
Massenmenschen, die Herrschaft eine
- Seite 423 und 424:
mathematisch-naturwissenschaftliche
- Seite 425 und 426:
und die Anwendung der Logik auf das
- Seite 427 und 428:
Die Ernennung wurde in beiden Fäll
- Seite 429 und 430:
unterschied sie sich schon allein i
- Seite 431 und 432:
Nachkriegszeit neu angebotenen Vorl
- Seite 433 und 434:
Aussicht, an der Universität Köln
- Seite 435 und 436:
Experimentelle und theoretische Phy
- Seite 437 und 438:
Vorlesungsgruppen 2. u. 3. TM 40 1.
- Seite 439 und 440:
Vorlesungsgruppen WS 49/50 SS 50 WS
- Seite 441 und 442:
Angewandte Physik Vorlesungsgruppen
- Seite 443 und 444:
Vorlesungsgruppen WS 42/43 SS 43 WS
- Seite 445 und 446:
5 Das Institut für angewandte Mech
- Seite 447 und 448:
In der 1897 neu hinzugekommenen Abt
- Seite 449 und 450:
Mechanik“. Max Schuler behauptete
- Seite 451 und 452:
Institut in Verbindung stand die vo
- Seite 453 und 454:
experimentellen Arbeiten erforschte
- Seite 455 und 456:
das Lehrbuch von Klein und Sommerfe
- Seite 457 und 458:
5.1.4.1 Schulers Weg nach Göttinge
- Seite 459 und 460:
einzuschlagen. Zum SS 1923 kam er i
- Seite 461 und 462:
auch eine Einteilung seiner Arbeite
- Seite 463 und 464:
Schuler. Die Verkürzung der Frist
- Seite 465 und 466:
Obwohl Schuler von seinen Physikerk
- Seite 467 und 468:
unter anderem Elastizitätstheorie,
- Seite 469 und 470:
5.2.1 Spannungen zwischen ’reiner
- Seite 471 und 472:
Mit der Geniehaftigkeit spielte Bor
- Seite 473 und 474:
Erteilung der venia legendi und rei
- Seite 475 und 476:
seiner wissenschaftlichen Interesse
- Seite 477 und 478:
zeitweilig mit dem Kommunismus symp
- Seite 479 und 480:
seien. 1877 Dadurch befand sich Pra
- Seite 481 und 482:
durch nichts von dem einmal als ric
- Seite 483 und 484:
wird, wirklich zuviel gutes Deutsch
- Seite 485 und 486:
Beschwerden von Pragers Rechtsanwä
- Seite 487 und 488:
„Jupp [= Kurt Hohenemser] ist ja
- Seite 489 und 490:
mitgeteilten Versuchsergebnisse von
- Seite 491 und 492:
verlieren wollte. Das Angebot auf d
- Seite 493 und 494:
Urteil ab, bestätigte aber die Not
- Seite 495 und 496:
Die Kritik, die Prandtl wegen seine
- Seite 497 und 498:
durchsetzen konnte. 1952 Belegt sin
- Seite 499 und 500:
Trotz Prandtls Unterstützung hatte
- Seite 501 und 502:
Verbindung zu Prandtl 1973 und vor
- Seite 503 und 504:
„der Bewegung gegenüber vor der
- Seite 505 und 506:
darauf an, durch ein richtiges und
- Seite 507 und 508:
Raketenforschungszentrum übernehme
- Seite 509 und 510:
Der langsame Aufstieg Schulers in s
- Seite 511 und 512:
wechselte 1936 ins Reichsluftfahrtm
- Seite 513 und 514:
Der einzige Assistent Schulers, der
- Seite 515 und 516:
von seinem Physikstudium in Wien we
- Seite 517 und 518:
war ab November 1939 Assistent am M
- Seite 519 und 520:
dachte. Hohenemser wurde zu einem P
- Seite 521 und 522:
weiterer Grund für die ablehnende
- Seite 523 und 524:
noch lange den Weg ins Leben bahnen
- Seite 525 und 526:
Ausgang: Bei Schuler glückte der V
- Seite 527 und 528:
verbaut habe. Zuletzt bestätigte e
- Seite 529 und 530:
diskreditieren, nicht ein. Das ist
- Seite 531 und 532:
Lebens eine überschwängliche Vere
- Seite 533 und 534:
Professor, und 3) Erteilung einer D
- Seite 535 und 536:
eurteilte Magnus als exzellenten Wi
- Seite 537 und 538:
zu emotionalem Stress. 2114 Es gibt
- Seite 539 und 540:
Dass er es als Angriff formulierte,
- Seite 541 und 542:
den er mit den Worten schloss: „M
- Seite 543 und 544:
erster Linie in das Gebiet der tech
- Seite 545 und 546:
kürzere vier Kompromisslösungen a
- Seite 547 und 548:
sondern an eine technische Hochschu
- Seite 549 und 550:
„Packen Sie Ihren Koffer und komm
- Seite 551 und 552:
Institutsdirektors wurde im August
- Seite 553 und 554:
Das Ministerium war im September 19
- Seite 555 und 556:
hätte, so besaßen auch die andere
- Seite 557 und 558:
ist die Weltpolitik nicht geeignet,
- Seite 559 und 560:
geschickt, und er hat einen sehr te
- Seite 561 und 562:
1957 wurde Hohenemser an der Washin
- Seite 563 und 564:
Zustimmung der Militärregierung er
- Seite 565 und 566:
werden. 2231 Nach mehrfachen Verlä
- Seite 567 und 568:
machen und wurde an die PTB nach Br
- Seite 569 und 570:
Politik dieser Stellenbesetzungen w
- Seite 571 und 572:
verweigert wurde. Mit Ausnahme von
- Seite 573 und 574:
fester Bestandteil des Netzes gewor
- Seite 575 und 576:
Ludwik Flecks untersucht. Die Grupp
- Seite 577 und 578:
vollständig zu erhalten, sondern a
- Seite 579 und 580:
Nazifizierung war. Diese Charakteri
- Seite 581 und 582:
Danksagung Mein ganz besonderer Dan
- Seite 583 und 584:
Verzeichnis der Lebensdaten der wic
- Seite 585 und 586:
Linde, Carl von (1842-1934) Listing
- Seite 587 und 588:
Quellenverzeichnis Interviews Alexa
- Seite 589 und 590:
Hauptstaatsarchiv Hannover Nds. 50:
- Seite 591 und 592:
Literaturverzeichnis Dieses Literat
- Seite 593 und 594:
Bode, Horst-Günther, Wolfgang Paul
- Seite 595 und 596:
Domanic, Fahri [1943] ’Zum lichte
- Seite 597 und 598:
Fritsch, Herbert [1941] ’Über di
- Seite 599 und 600:
Heisenberg, Werner [1944] ’Die be
- Seite 601 und 602:
Helwig, Gerhard [1952] ’Elektrisc
- Seite 603 und 604:
Joos, Georg [1932] Lehrbuch der the
- Seite 605 und 606:
Kelting, Heinke & Horst Witt [1949]
- Seite 607 und 608:
Koppe, Heinz [1949]b ’Die Energie
- Seite 609 und 610:
Laue, Max von [1948]d ’Supraleitu
- Seite 611 und 612:
Meyer, Erwin [1948] Rezension von:
- Seite 613 und 614:
Pohl, Robert Wichard [1940]d Rezens
- Seite 615 und 616:
Sauter, Fritz [1950]e Rezension von
- Seite 617 und 618:
Schuler, Max [1939]a ’Gangergebni
- Seite 619 und 620:
Timoféeff-Ressovsky, Nikolaj Wladi
- Seite 621 und 622:
Wirtz, Karl [1947]a ’Resonanz und
- Seite 623 und 624:
’Bericht über die Entwicklung de
- Seite 625 und 626:
Bruch, Rüdiger vom [1993] ’Profe
- Seite 627 und 628:
Dahms, Hans-Joachim [1986] ’Verlu
- Seite 629 und 630:
Federspiel, Ruth [2002] ’Mobilisi
- Seite 631 und 632:
Goldschmidt, Dietrich [1949] ’1 S
- Seite 633 und 634:
Heinemann, Manfred (Hrsg.) [1991] H
- Seite 635 und 636:
Hörisch, Jochen [1998] ’»Verhaf
- Seite 637 und 638:
Kertz, Walter (Hrsg.) [1995]a Techn
- Seite 639 und 640:
Lemmerich, Jost [1987]b Maß und Me
- Seite 641 und 642:
Maurer, Margarete [1986] ’Die Ver
- Seite 643 und 644:
Murray, George [1978] ’The Britis
- Seite 645 und 646:
Physics in a new era: an overview,
- Seite 647 und 648:
Richarz, Monika [1986] ’Juden in
- Seite 649 und 650:
Schneider, Christian [1998] ’Iden
- Seite 651 und 652:
[Studentenzahlen] Der Präsident de
- Seite 653 und 654:
Vogt, Annette [1997]b ’»In Ausna
- Seite 655:
Wise, M. Norton [1994] ’Pascual J