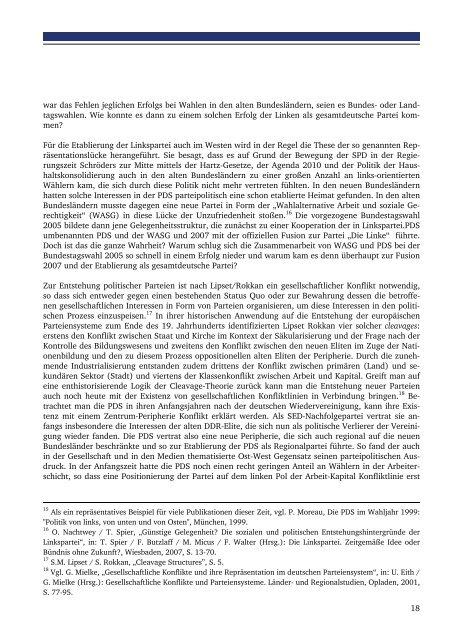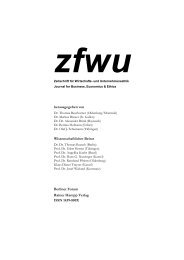Working Paper - Institut für Politikwissenschaft - Technische ...
Working Paper - Institut für Politikwissenschaft - Technische ...
Working Paper - Institut für Politikwissenschaft - Technische ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
war das Fehlen jeglichen Erfolgs bei Wahlen in den alten Bundesländern, seien es Bundes- oder Landtagswahlen.<br />
Wie konnte es dann zu einem solchen Erfolg der Linken als gesamtdeutsche Partei kommen?<br />
Für die Etablierung der Linkspartei auch im Westen wird in der Regel die These der so genannten Repräsentationslücke<br />
herangeführt. Sie besagt, dass es auf Grund der Bewegung der SPD in der Regierungszeit<br />
Schröders zur Mitte mittels der Hartz-Gesetze, der Agenda 2010 und der Politik der Haushaltskonsolidierung<br />
auch in den alten Bundesländern zu einer großen Anzahl an links-orientierten<br />
Wählern kam, die sich durch diese Politik nicht mehr vertreten fühlten. In den neuen Bundesländern<br />
hatten solche Interessen in der PDS parteipolitisch eine schon etablierte Heimat gefunden. In den alten<br />
Bundesländern musste dagegen eine neue Partei in Form der „Wahlalternative Arbeit und soziale Gerechtigkeit“<br />
(WASG) in diese Lücke der Unzufriedenheit stoßen. 16 Die vorgezogene Bundestagswahl<br />
2005 bildete dann jene Gelegenheitsstruktur, die zunächst zu einer Kooperation der in Linkspartei.PDS<br />
umbenannten PDS und der WASG und 2007 mit der offiziellen Fusion zur Partei „Die Linke“ führte.<br />
Doch ist das die ganze Wahrheit? Warum schlug sich die Zusammenarbeit von WASG und PDS bei der<br />
Bundestagswahl 2005 so schnell in einem Erfolg nieder und warum kam es denn überhaupt zur Fusion<br />
2007 und der Etablierung als gesamtdeutsche Partei?<br />
Zur Entstehung politischer Parteien ist nach Lipset/Rokkan ein gesellschaftlicher Konflikt notwendig,<br />
so dass sich entweder gegen einen bestehenden Status Quo oder zur Bewahrung dessen die betroffenen<br />
gesellschaftlichen Interessen in Form von Parteien organisieren, um diese Interessen in den politischen<br />
Prozess einzuspeisen. 17 In ihrer historischen Anwendung auf die Entstehung der europäischen<br />
Parteiensysteme zum Ende des 19. Jahrhunderts identifizierten Lipset Rokkan vier solcher cleavages:<br />
erstens den Konflikt zwischen Staat und Kirche im Kontext der Säkularisierung und der Frage nach der<br />
Kontrolle des Bildungswesens und zweitens den Konflikt zwischen den neuen Eliten im Zuge der Nationenbildung<br />
und den zu diesem Prozess oppositionellen alten Eliten der Peripherie. Durch die zunehmende<br />
Industrialisierung entstanden zudem drittens der Konflikt zwischen primären (Land) und sekundären<br />
Sektor (Stadt) und viertens der Klassenkonflikt zwischen Arbeit und Kapital. Greift man auf<br />
eine enthistorisierende Logik der Cleavage-Theorie zurück kann man die Entstehung neuer Parteien<br />
auch noch heute mit der Existenz von gesellschaftlichen Konfliktlinien in Verbindung bringen. 18 Betrachtet<br />
man die PDS in ihren Anfangsjahren nach der deutschen Wiedervereinigung, kann ihre Existenz<br />
mit einem Zentrum-Peripherie Konflikt erklärt werden. Als SED-Nachfolgepartei vertrat sie anfangs<br />
insbesondere die Interessen der alten DDR-Elite, die sich nun als politische Verlierer der Vereinigung<br />
wieder fanden. Die PDS vertrat also eine neue Peripherie, die sich auch regional auf die neuen<br />
Bundesländer beschränkte und so zur Etablierung der PDS als Regionalpartei führte. So fand der auch<br />
in der Gesellschaft und in den Medien thematisierte Ost-West Gegensatz seinen parteipolitischen Ausdruck.<br />
In der Anfangszeit hatte die PDS noch einen recht geringen Anteil an Wählern in der Arbeiterschicht,<br />
so dass eine Positionierung der Partei auf dem linken Pol der Arbeit-Kapital Konfliktlinie erst<br />
15<br />
Als ein repräsentatives Beispiel <strong>für</strong> viele Publikationen dieser Zeit, vgl. P. Moreau, Die PDS im Wahljahr 1999:<br />
"Politik von links, von unten und von Osten", München, 1999.<br />
16<br />
O. Nachtwey / T. Spier, „Günstige Gelegenheit? Die sozialen und politischen Entstehungshintergründe der<br />
Linkspartei“, in: T. Spier / F. Butzlaff / M. Micus / F. Walter (Hrsg.): Die Linkspartei. Zeitgemäße Idee oder<br />
Bündnis ohne Zukunft?, Wiesbaden, 2007, S. 13-70.<br />
17<br />
S.M. Lipset / S. Rokkan, „Cleavage Structures”, S. 5.<br />
18<br />
Vgl. G. Mielke, „Gesellschaftliche Konflikte und ihre Repräsentation im deutschen Parteiensystem“, in: U. Eith /<br />
G. Mielke (Hrsg.): Gesellschaftliche Konflikte und Parteiensysteme. Länder- und Regionalstudien, Opladen, 2001,<br />
S. 77-95.<br />
18