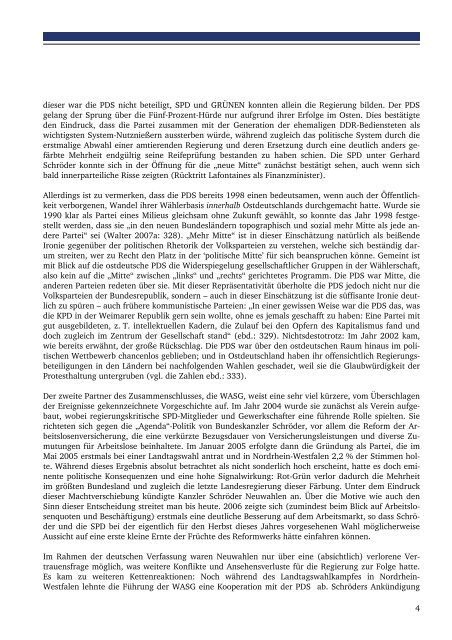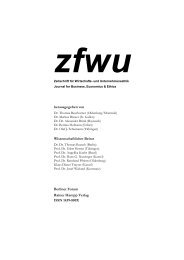Working Paper - Institut für Politikwissenschaft - Technische ...
Working Paper - Institut für Politikwissenschaft - Technische ...
Working Paper - Institut für Politikwissenschaft - Technische ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
dieser war die PDS nicht beteiligt, SPD und GRÜNEN konnten allein die Regierung bilden. Der PDS<br />
gelang der Sprung über die Fünf-Prozent-Hürde nur aufgrund ihrer Erfolge im Osten. Dies bestätigte<br />
den Eindruck, dass die Partei zusammen mit der Generation der ehemaligen DDR-Bediensteten als<br />
wichtigsten System-Nutznießern aussterben würde, während zugleich das politische System durch die<br />
erstmalige Abwahl einer amtierenden Regierung und deren Ersetzung durch eine deutlich anders gefärbte<br />
Mehrheit endgültig seine Reifeprüfung bestanden zu haben schien. Die SPD unter Gerhard<br />
Schröder konnte sich in der Öffnung <strong>für</strong> die „neue Mitte“ zunächst bestätigt sehen, auch wenn sich<br />
bald innerparteiliche Risse zeigten (Rücktritt Lafontaines als Finanzminister).<br />
Allerdings ist zu vermerken, dass die PDS bereits 1998 einen bedeutsamen, wenn auch der Öffentlichkeit<br />
verborgenen, Wandel ihrer Wählerbasis innerhalb Ostdeutschlands durchgemacht hatte. Wurde sie<br />
1990 klar als Partei eines Milieus gleichsam ohne Zukunft gewählt, so konnte das Jahr 1998 festgestellt<br />
werden, dass sie „in den neuen Bundesländern topographisch und sozial mehr Mitte als jede andere<br />
Partei“ sei (Walter 2007a: 328). „Mehr Mitte“ ist in dieser Einschätzung natürlich als beißende<br />
Ironie gegenüber der politischen Rhetorik der Volksparteien zu verstehen, welche sich beständig darum<br />
streiten, wer zu Recht den Platz in der ‘politische Mitte’ <strong>für</strong> sich beanspruchen könne. Gemeint ist<br />
mit Blick auf die ostdeutsche PDS die Widerspiegelung gesellschaftlicher Gruppen in der Wählerschaft,<br />
also kein auf die „Mitte“ zwischen „links“ und „rechts“ gerichtetes Programm. Die PDS war Mitte, die<br />
anderen Parteien redeten über sie. Mit dieser Repräsentativität überholte die PDS jedoch nicht nur die<br />
Volksparteien der Bundesrepublik, sondern – auch in dieser Einschätzung ist die süffisante Ironie deutlich<br />
zu spüren – auch frühere kommunistische Parteien: „In einer gewissen Weise war die PDS das, was<br />
die KPD in der Weimarer Republik gern sein wollte, ohne es jemals geschafft zu haben: Eine Partei mit<br />
gut ausgebildeten, z. T. intellektuellen Kadern, die Zulauf bei den Opfern des Kapitalismus fand und<br />
doch zugleich im Zentrum der Gesellschaft stand“ (ebd.: 329). Nichtsdestotrotz: Im Jahr 2002 kam,<br />
wie bereits erwähnt, der große Rückschlag. Die PDS war über den ostdeutschen Raum hinaus im politischen<br />
Wettbewerb chancenlos geblieben; und in Ostdeutschland haben ihr offensichtlich Regierungsbeteiligungen<br />
in den Ländern bei nachfolgenden Wahlen geschadet, weil sie die Glaubwürdigkeit der<br />
Protesthaltung untergruben (vgl. die Zahlen ebd.: 333).<br />
Der zweite Partner des Zusammenschlusses, die WASG, weist eine sehr viel kürzere, vom Überschlagen<br />
der Ereignisse gekennzeichnete Vorgeschichte auf. Im Jahr 2004 wurde sie zunächst als Verein aufgebaut,<br />
wobei regierungskritische SPD-Mitglieder und Gewerkschafter eine führende Rolle spielten. Sie<br />
richteten sich gegen die „Agenda“-Politik von Bundeskanzler Schröder, vor allem die Reform der Arbeitslosenversicherung,<br />
die eine verkürzte Bezugsdauer von Versicherungsleistungen und diverse Zumutungen<br />
<strong>für</strong> Arbeitslose beinhaltete. Im Januar 2005 erfolgte dann die Gründung als Partei, die im<br />
Mai 2005 erstmals bei einer Landtagswahl antrat und in Nordrhein-Westfalen 2,2 % der Stimmen holte.<br />
Während dieses Ergebnis absolut betrachtet als nicht sonderlich hoch erscheint, hatte es doch eminente<br />
politische Konsequenzen und eine hohe Signalwirkung: Rot-Grün verlor dadurch die Mehrheit<br />
im größten Bundesland und zugleich die letzte Landesregierung dieser Färbung. Unter dem Eindruck<br />
dieser Machtverschiebung kündigte Kanzler Schröder Neuwahlen an. Über die Motive wie auch den<br />
Sinn dieser Entscheidung streitet man bis heute. 2006 zeigte sich (zumindest beim Blick auf Arbeitslosenquoten<br />
und Beschäftigung) erstmals eine deutliche Besserung auf dem Arbeitsmarkt, so dass Schröder<br />
und die SPD bei der eigentlich <strong>für</strong> den Herbst dieses Jahres vorgesehenen Wahl möglicherweise<br />
Aussicht auf eine erste kleine Ernte der Früchte des Reformwerks hätte einfahren können.<br />
Im Rahmen der deutschen Verfassung waren Neuwahlen nur über eine (absichtlich) verlorene Vertrauensfrage<br />
möglich, was weitere Konflikte und Ansehensverluste <strong>für</strong> die Regierung zur Folge hatte.<br />
Es kam zu weiteren Kettenreaktionen: Noch während des Landtagswahlkampfes in Nordrhein-<br />
Westfalen lehnte die Führung der WASG eine Kooperation mit der PDS ab. Schröders Ankündigung<br />
4