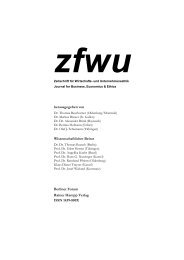Working Paper - Institut für Politikwissenschaft - Technische ...
Working Paper - Institut für Politikwissenschaft - Technische ...
Working Paper - Institut für Politikwissenschaft - Technische ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
über der Linken, scheint eine „linke“ Mehrheitskoalition aus SPD, Grüne und Linke nicht durchführbar.<br />
Daher wurde in Hessen als einzige Möglichkeit, Andrea Ypsilanti zur Ministerpräsidentin zu wählen,<br />
das in Sachsen-Anhalt erfolgreiche angewandte Tolerierungsmodell angestrebt. Denn weder <strong>für</strong> CDU<br />
und FDP noch <strong>für</strong> SPD und Grüne ergab sich eine parlamentarische Mehrheit. Als Problem erwies sich<br />
vor allem die Aussage der SPD-Spitzenkandidatin Ypsilanti vor den Wahlen im Januar 2008, in der sie<br />
betonte, nicht mit Hilfe der Linken die Macht ergreifen zu wollen. Damit ergaben sich in der Folge<br />
große innerparteiliche Differenzen über den einzuschlagenden Kurs. Nachdem die Diskussionen in<br />
Regionalkonferenzen schließlich in eine Zustimmung von 95% zu Gunsten des Tolerierungsmodells<br />
auf dem Landesparteitag am 02. November 2008 mündeten, überraschte das Scheitern der Wahl durch<br />
die Ankündigung von vier Abweichlern am 04. November, Frau Ypsilanti nicht wählen zu wollen. Dass<br />
sich unter diesen Abgeordneten der stellvertretende Landesvorsitze Walter befand, zeigt die Zerrissenheit<br />
der SPD in der Frage einer Zusammenarbeit mit der Linken. Das Scheitern mündete schließlich in<br />
vorgezogene Landtagswahlen, die <strong>für</strong> den 18. Januar 2009 geplant sind. Auch wenn der Kurs der SPD<br />
unklar ist, scheint die Möglichkeit einer Zusammenarbeit mit der Linken nach diesen Wahlen momentan<br />
eher als unwahrscheinlich, selbst wenn es erneut keine Mehrheit <strong>für</strong> CDU und FDP geben sollte.<br />
Insbesondere die Bundes-SPD wird sich <strong>für</strong> den Bundestagswahlkampf wünschen, dass es nicht wieder<br />
zu einer solchen Situation in Hessen wie schon 2008 kommt. Doch wie sieht es prinzipiell <strong>für</strong> eine<br />
mögliche Regierungsbeteiligung der Linken nach der Bundestagswahl 2009 aus? Von Seiten der SPD<br />
scheint der Kurs eindeutig: Die politische Führung der SPD um Müntefering und Steinmeier wird nicht<br />
zuletzt wegen des Debakels der hessischen SPD versuchen, einen Abgrenzungswahlkampf gegenüber<br />
der Linken zu führen, der eine Koalition oder Duldung nahezu ausschließt. Aber auch von Seiten der<br />
Linken selbst erscheint eine Kooperation als unwahrscheinliche Option. Als Beispiel mag die Äußerung<br />
von Harald Wolf, Bürgermeister in der SPD-PDS Regierung in Berlin, dienen:<br />
„Wenn wir 2009 in Regierungsverantwortung gehen müssten, hätten wir ein Problem. Wir haben als<br />
Partei eine sehr ungleichzeitige Entwicklung genommen, im Osten arbeiten wir seit 18 Jahren in den<br />
Parlamenten und genießen Akzeptanz. Die westlichen Landesverbände sind stark vom Widerstand gegen<br />
Rot-Grün und der Enttäuschung über die SPD geprägt. Das sind unterschiedliche Kulturen, eine<br />
gemeinsame Identität braucht Zeit. Und vor allem: Es gibt gegenwärtig keine gemeinsame politische<br />
Basis mit der SPD im Bund.“ 27<br />
2.4 Zur Zukunft des Parteiensystems – koalitionstheoretische Überlegungen<br />
Im letzten Teil meiner Analyse möchte ich aus koalitionstheoretischer Perspektive die spezielle Bedeutung<br />
der Partei Die Linke <strong>für</strong> kommende Regierungsbildungen, auch über die nächste Wahl 2009 hinaus,<br />
herausstellen. Dazu werde ich zunächst die beiden zentralen koalitionstheoretischen Richtungen<br />
skizzieren, die sich hinsichtlich der Handlungsmotivation der Parteien grundlegend unterscheiden.<br />
Prinzipiell lassen sich die office- von den policy-seeking Theorien unterscheiden. 28 In ersteren streben<br />
die Parteien allein wegen der zu erwarteten Vorteile einer Regierungsbeteiligung an die Macht. Dazu<br />
versuchen sie zunächst ihren Stimmenanteil zu maximieren, um daraus einen möglichst großen Anteil<br />
an Regierungsämtern zu gewinnen. Aus dieser Motivation heraus gibt es zwei klassische Ansätze, die<br />
zu leicht unterschiedlichen Vorhersagen in den Regierungskoalitionen kommen. 29 Laut minimum win-<br />
27 Interview mit Harald Wolf in der FAZ vom 22. Juli 2008.<br />
28 Als gelungene Einführung in die zentralen Konzepte kann dienen: W.C. Müller, „Koalitionstheorien“, in: L.<br />
Helms / U. Jun, Politische Theorie und Regierungslehre, Frankfurt a.M., 2004, 267-301.<br />
29 Vgl. W. Riker, The Theory of Political Coalitions, New Haven, 1962.<br />
22