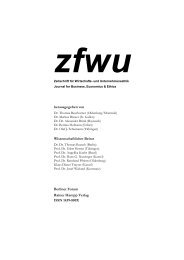Working Paper - Institut für Politikwissenschaft - Technische ...
Working Paper - Institut für Politikwissenschaft - Technische ...
Working Paper - Institut für Politikwissenschaft - Technische ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Für alle folgenden Überlegungen gilt, dass nur Mehrheitskoalitionen in Erwägung gezogen werden.<br />
Das reflektiert zunächst die Tatsache, dass es in Deutschland bislang ausschließlich Mehrheitsregierungen<br />
gab. Das liegt aber vor allem an der institutionellen Festlegung im Grundgesetz, dass der Bundeskanzler<br />
mit absoluter Mehrheit zu wählen ist.<br />
Wendet man auf das Szenario 1 nun den gängigen minimal winning Ansatz an, findet man drei Mehrheitskoalitionen,<br />
die aus zwei Parteien gebildet werden können. Es ist jeweils die CDU als stärkste Partei<br />
mit entweder der FDP, der SPD oder der Linken. Nimmt man das Argument des minimum winning<br />
Ansatzes zu Hilfe, dass die CDU ihre Macht nicht nur mit möglichst wenig Parteien teilen will, sondern<br />
auch das Machtgleichgewicht innerhalb der Koalition eine Rolle spielt, wäre die Koalition mit der SPD<br />
als weniger wahrscheinlich zu betrachten. Geht man also von einer reinen Ämterorientierung aus,<br />
bleiben CDU-FDP, CDU-Linke und weniger wahrscheinlich CDU-SPD als prognostizierte Regierungskoalition<br />
bestehen.<br />
Doch zeigt sich an Hand dieser Überlegungen sehr schnell, dass <strong>für</strong> die Bundesrepublik Deutschland<br />
reine office-seeking Modelle nur unzureichend die realen Motivationen der Parteien berücksichtigen.<br />
Eine Koalition der CDU mit der Linken ist undenkbar. Also spielen policy-Überlegungen eine zentrale<br />
Rolle, so dass auf Basis des minimal connected winning Ansatzes die Koalitionen CDU-FDP und CDU-<br />
SPD prognostiziert werden können. Deutlich wird in dieser Prognose die hervorgehobene Position der<br />
CDU als Medianpartei. Eine alternative Regierungsbildung unter der SPD ohne die CDU müsste dagegen<br />
eine in der Realität undenkbare Koalition umschließen, die sowohl die Linke als auch die FDP umfasst.<br />
Auch wenn in diesem Ansatz die ideologische Distanz zwischen zwei benachbarten Parteien keine<br />
Rolle spielt, kann auf Grund der inhaltlichen Nähe von CDU und FDP davon ausgegangen werden,<br />
dass aus policy-Überlegungen die Koalition aus diesen beiden Parteien verwirklicht werden würde. 33<br />
Verstärkt wird diese Prognose durch ein office-seeking Argument. Denn die CDU verfügt über mehr<br />
koalitionsinterne Macht, wenn sie mit der FDP als kleinem Partner und nicht mit der SPD in einer Großen<br />
Koalition regiert.<br />
Im Szenario 2 ändern sich die Mehrheitsverhältnisse nur minimal, was aber große Wirkung auf die<br />
Regierungsbildung hat. So gibt es nur noch zwei minimal winning Koalitionen: CDU-SPD und CDU-<br />
Linke, es reicht nicht mehr <strong>für</strong> CDU-FDP. Auch wenn es sich bei CDU-Linke um die optimale minimum<br />
winning Koalition (zusammen 51%) handelt, ist diese doch aus ideologischen Gründen völlig unrealistisch.<br />
Daher wenden wir den Blick auf die möglichen Mehrheitskoalitionen von ideologisch benachbarten<br />
Parteien. Hier finden wir die Koalition von CDU und SPD und die linke Dreierkoalition von SPD-<br />
Grüne-Linke. Deutlich wird, dass die SPD in diesem Szenario die CDU als Medianpartei abgelöst hat.<br />
An ihr liegt es nun, zwischen den beiden policy-orientierten Koalitionen auszuwählen. Nimmt man das<br />
office-Kriterium der Anzahl der Parteien hinzu, sollte die SPD <strong>für</strong> eine große Koalition votieren, nimmt<br />
man das Argument der Koalitions-internen Macht zu Hilfe, sollte sie sich <strong>für</strong> die Linkskoalition entscheiden,<br />
da sie hier den Kanzler und eine Mehrzahl der Minister stellen kann. Versucht man die ideologische<br />
Distanz als zusätzliches policy-Kriterium heranzuziehen, ist nur schwer ein Urteil zu treffen,<br />
da nicht klar ist, ob zwischen der SPD und der Linken oder zwischen SPD und CDU die größere Distanz<br />
liegt. In diesem Szenario reicht es dagegen nicht <strong>für</strong> eine so genannte Ampel-Koalition aus SPD-<br />
Grüne-FDP. Doch spricht die große ideologische Distanz unter policy-Aspekten gegen diese Koalition,<br />
selbst wenn sie rechnerisch möglich sein sollte.<br />
So wird an dieser Stelle das Dilemma der SPD und die besondere Bedeutung der Linken sichtbar: Zwar<br />
stellt die SPD den Median, sie kann aber mit einem schwächeren Ergebnis als die CDU nur als Junior-<br />
33<br />
Das entspricht dem closed minimal range Ansatz, bei dem jene Mehrheitskoalition prognostiziert wird, die die<br />
geringste ideologische Distanz aufweist, vgl. W.C. Müller, „Koalitionstheorien“, S. 274.<br />
24