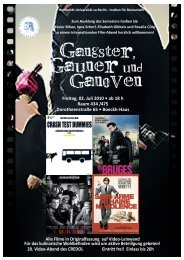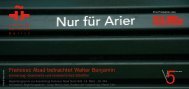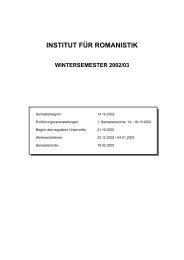Wintersemester 2011/12 - Institut für Romanistik - Humboldt ...
Wintersemester 2011/12 - Institut für Romanistik - Humboldt ...
Wintersemester 2011/12 - Institut für Romanistik - Humboldt ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Studierenden angepasst werden.<br />
5240456 Interpretación consecutiva unilateral alemán-español (spanisch)<br />
2 SWS 2 SP<br />
UE Do 08-10 wöch. DOR 65, 459 M. Prieto Alonso<br />
5240457 Conversación y expresión oral (spanisch)<br />
2 SWS 2 SP<br />
UE Mi 10-<strong>12</strong> wöch. DOR 65, 473 S. Bozal<br />
5240458 Arte en epañol (spanisch)<br />
2 SWS 2 SP<br />
UE Mo 10-<strong>12</strong> wöch. DOR 65, 475 S. Bozal<br />
5240459 Koloniale Prozesse und ihre Auswirkungen in den romanischen Literaturen seit<br />
1800<br />
2 SWS 2 SP<br />
VL Di 18-20 wöch. DOR 24, 1.608 K. Karimi<br />
Beginn: 25.10., 18.15 Uhr<br />
Der Kolonialismus ist keine Erfindung des 19. Jahrhunderts. Koloniale Prozesse beginnen bereits in der frühen Neuzeit. Aber in<br />
der Zeitspanne seit 1800 kommt es zu widersprüchlichen Entwicklungen: Während das spanische Kolonialimperium nach den<br />
Napoleonischen Kriegen zusammenbricht und Lateinamerika seine formale Unabhängigkeit erlangt, drängen imperiale europäische<br />
Mächte wie Großbritannien, Frankreich, Deutschland und selbst das kleine Belgien auf die Weltbühne. In Afrika und Asien entstehen<br />
neue Imperien, und selbst der alten Kolonialmacht Portugal gelingt es, seine umstrittenen territorialen Ansprüche auf dem<br />
schwarzen Kontinent zu bekräftigen. Doch der neue Kolonialismus steht ganz im Zeichen einer ungeheuren wirtschaftlichen<br />
Expansion der kolonialen Reiche, die in den von ihnen abhängigen Gebieten Absatzmärkte und Rohstoffquellen suchen.<br />
Anhand ausgewählter Beispiele wird sich die Veranstaltung vornehmlich einer Literatur annehmen, deren Rolle im Kolonialzeitalter<br />
vornehmlich darin besteht, die Herrschaft der Europäer zu legitimieren. Doch seit dem Beginn des 20. Jahrhunderts melden sich in<br />
zunehmendem Maß auch Autoren aus den Metropolen und schließlich auch aus deren Peripherien zu Wort, die der Literatur nicht<br />
nur die Rolle einer Anklägerin zuweisen. Dabei wird sich die Veranstaltung ebenso kolonialer Stereotypen und Bilder zuwenden,<br />
aber auch literarischer Strategien, diese in der Arbeit der Sprachkunst zu demaskieren und zu überwinden. Autoren wie André<br />
Gide, Aimé Césaire oder Frantz Fanon sind nur Teil eines literarischen Tableaus, das die Vorlesung ihren Teilnehmern zugänglich<br />
machen wird.<br />
Aufgabe dieser Vorlesung wird es sein, einen Überblick über koloniale und antikoloniale Literatur in Frankreich,<br />
Spanien, Italien und Portugal zu geben, so dass die Teilnehmer Impulse <strong>für</strong> ihre eigene Lektürearbeit erhalten. Eine<br />
ausführliche Bibliographie wird zu Beginn der Veranstaltung nachgereicht bzw. im Internet veröffentlicht.<br />
5240461 Einführung in die sardische Sprache und Kultur<br />
2 SWS 2 SP<br />
UE Mo 16-18 wöch. DOR 65, 445 C. Concu<br />
Wer bereits einmal auf Sardinien war, dem wird vielleicht aufgefallen sein, dass dort neben Italienisch eine weitere Sprache<br />
vorherrscht. Diese Sprache, das Sardische, sticht besonders durch das markante U an vielen Wortenden hervor.<br />
Dies hatte schon der große italienische Dichter Dante Alighieri, der Sardinien nicht wirklich kannte, bemerkt. In seinem Werk De<br />
Vulgari eloquentia aus dem Jahr 1305 schrieb er, dass das Sardische keine Sprache sei. Für Dante Alighieri schienen die Sarden<br />
beim Sprechen wie Affen, die versuchten das Lateinische zu imitieren.<br />
Doch ist das Sardische keineswegs eine Imitation des Lateinischen! Es ist vielmehr ein Exzellenzbeispiel da<strong>für</strong> wie das Lateinische<br />
die romanischen Sprachen formte, da Sardisch verhältnismäßig viele phonetische und grammatikalische Elemente des Lateinischen<br />
aufweist.<br />
Seit 1997 ist Sardisch als Minderheitensprache anerkannt.<br />
Die sardische Sprache besteht aus zwei Hauptvarianten: Logudoresisch und Campidanesisch .<br />
Logudoresisch ist vorherrschende Sprachvariante des nördlichen Teils Sardiniens und wird von circa 400.000 Menschen<br />
gesprochen. Campidanesisch sprechen circa 900.000 Menschen im Süden Sardiniens. Mit der Limba Sarda Comuna verabschiedete<br />
die Region Sardinien 2006 eine Schriftsprache, die diese beiden Hauptvarianten des Sardischen berücksichtigt und eint.<br />
5240462 Einführung in wissenschaftliche Arbeitstechniken <strong>für</strong> Romanisten (Beginn:<br />
3.11.11)<br />
2 SWS 2 SP<br />
TU Do 16-18 wöch. DOR 65, 445 K. Frohmann<br />
Das Tutorium „Einführung in wissenschaftliche Arbeitstechniken <strong>für</strong> Romanisten“ soll Studierenden der romanistischen Fächer<br />
(Studieneingangsphase) den Einstieg in ein selbst zu organisierendes, interessant und effektiv zu gestaltendes Studium erleichtern.<br />
Der Fokus liegt dabei auf der Anleitung zum wissenschaftlichen Arbeiten an einem romanistischen Gegenstand in der Sprach- und<br />
Literaturwissenschaft. Dabei sollen praktische Übungen im Vordergrund stehen.<br />
Folgende Themen und Verfahren werden u.a. besprochen:<br />
• Das gute Referat / die gute Hausarbeit<br />
• Methodische Arbeitsschritte (Lesen, Exzerpieren, Recherchieren, Bibliographieren, Zitieren)<br />
• Suche und Auswertung von Sekundärliteratur; Bibliotheksführungen<br />
Seite 7 von 51<br />
<strong>Wintersemester</strong> <strong>2011</strong>/<strong>12</strong> gedruckt am 30.03.20<strong>12</strong> 20:15:<strong>12</strong>