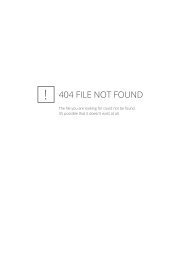2 Das Beratungsangebot als Grundlage der explorativen Studie - WZB
2 Das Beratungsangebot als Grundlage der explorativen Studie - WZB
2 Das Beratungsangebot als Grundlage der explorativen Studie - WZB
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
„warum arbeitslosen Menschen, die auch <strong>als</strong> Bürgerarbeiter staatlich finanziert werden,<br />
nicht gleich eine reguläre Erwerbstätigkeit angeboten werden sollte, für die öffentliche<br />
und private Unternehmen einen Zuschuss von <strong>der</strong> Arbeitsverwaltung erhalten<br />
(wobei auch Qualifizierungsmaßnahmen ‚on-the-job‘ angestrebt werden sollten).<br />
Eine solche gezielte ‚Lohn-Subvention‘ würde bei <strong>der</strong> Schaffung zusätzlicher<br />
Arbeitsplätze ja durchaus mehr Innovationen zulassen <strong>als</strong> auf dem ‚zweiten‘ und<br />
‚dritten‘ Arbeitsmarkt heute üblich ist“. Die Vorschläge <strong>der</strong> Kommission könnten<br />
für gut gebildete Ehrenamtliche attraktiv sein, „einschließlich <strong>der</strong> Arbeitslosen mit<br />
Hochschulabschluss, die bereits jetzt zur Hälfte ehrenamtlich aktiv sind – im Gegensatz<br />
zu nur 20 Prozent <strong>der</strong> Arbeitslosen ohne Schulabschluss. Für schlecht qualifizierte<br />
Arbeitslose könnte Bürgerarbeit dagegen ein neues Dilemma darstellen: Ihnen<br />
bleibt Erwerbsarbeit weiterhin verschlossen und sie finden möglicherweise auch<br />
keinen Gemeinwohl-Unternehmer, <strong>der</strong> an ihren Fähigkeiten Interesse hätte. Diese<br />
Gruppe wäre <strong>als</strong>o doppelt stigmatisiert – während <strong>der</strong> an<strong>der</strong>e Teil <strong>der</strong> Arbeitslosen<br />
einfachste Tätigkeiten <strong>als</strong> Bürgerarbeit ausüben würde, die aber schlechter bezahlt<br />
wären <strong>als</strong> am normalen Arbeitsmarkt. In diesem Fall müsste man ehrlicherweise von<br />
‚Arbeitspflicht‘ sprechen“ (Wagner 1998).<br />
Bei <strong>der</strong> Vision <strong>der</strong> Kommission findet Krupp (1998), dass „die Funktion einer freiwilligen<br />
Form <strong>der</strong> ja ohnehin gegebenen gemeinwohlorientierten Arbeit von Sozialhilfeempfängern<br />
(...) unklar bleibt“. „Schließlich ist zu berücksichtigen, dass an an<strong>der</strong>er<br />
Stelle des Berichts eine Sozialhilfesenkung gefor<strong>der</strong>t wird, um die Anreize zur<br />
Erwerbsarbeit wie<strong>der</strong> zu verstärken. Damit wird eben doch deutlich, dass Bürgerarbeit<br />
kein Ersatz für Erwerbsarbeit sein kann und <strong>als</strong> Ersatz für soziale Angebote nur<br />
missbraucht würde.“ Krupps Zusammenfassung: „Mit einer Mischung aus Einkommen<br />
auf Sozialhilfeniveau und freiwilligem Engagement kann man aber die<br />
heute mehr denn ja gefragten sozialen Dienste nicht ersetzen.“<br />
In Berlin veröffentlichte die Senatsverwaltung für Arbeit, Berufliche Bildung und<br />
Frauen (1998) eine „Streitschrift wi<strong>der</strong> die Kommission für Zukunftsfragen <strong>der</strong><br />
Freistaaten Bayern und Sachsen“, die auf „die Sackgassen <strong>der</strong> Zukunftskommission“<br />
hinwies. Einer <strong>der</strong> vielen Aspekte ihrer Kritik war die Befürchtung, dass Bürgerarbeit<br />
zur Verdrängung von Frauen aus dem Arbeitsmarkt dienen könnte.<br />
Priller und Zimmer (1997) erscheinen Ansätze und Konzepte durchaus überlegenswert,<br />
die den dritten Sektor <strong>als</strong> Alternative zum herkömmlichen Arbeitsmarkt betrachten,<br />
ihm aber dabei keine perspektivlose „Parkplatz- und Abschiebefunktion“<br />
zuweisen. Allerdings sei es mit solchen Konzepten nicht zu garantieren, dass das<br />
bisherige Lohnniveau aufrechterhalten werden könne. Maßnahmen, die auf eine<br />
zwangsweise Verpflichtung <strong>der</strong> Bürger zu gesellschaftlicher Arbeit im dritten Sektor<br />
hinauslaufen, seien skeptisch zu beurteilen. Mit einer Großoffensive „Arbeit statt<br />
Sozialhilfe“ würden – rein rechnerisch betrachtet – die 1,5 Millionen Personen, die<br />
Sozialhilfe beziehen, den Umfang des dritten Sektors mehr <strong>als</strong> verdoppeln. Ein solcher<br />
plötzlicher Anstieg wäre für die Organisationen schwer zu bewältigen. Der<br />
Prozess wäre mit umfassenden Investitionen in Schulung und Ausbildung flankiert.<br />
Abgesehen davon wäre ein <strong>der</strong>artiges Verfahren nicht mit <strong>der</strong> Philosophie und dem<br />
Selbstverständnis des dritten Sektors in Einklang zu bringen. Es wäre eine genuin<br />
- 2 -