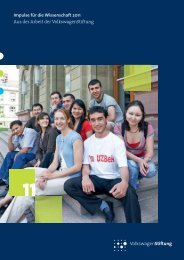Zu den Perspektiven des wissenschaftlichen Nachwuchses
Zu den Perspektiven des wissenschaftlichen Nachwuchses
Zu den Perspektiven des wissenschaftlichen Nachwuchses
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Laufbahn normalerweise ganz anders, nämlich durch Anstellung als assistant. In<br />
ähnlicher Art etwa, wie das bei uns an <strong>den</strong> großen Instituten der naturwissenschaftli-<br />
chen und medizinischen Fakultäten vor sich zu gehen pflegt, wo die förmliche Habili-<br />
tation als Privatdozent nur von einem Bruchteil der Assistenten und oft erst spät erstrebt<br />
wird. Der Gegensatz bedeutet praktisch: dass bei uns die Laufbahn eines<br />
Mannes der Wissenschaft im Ganzen auf plutokratischen Voraussetzungen aufgebaut<br />
ist. Denn es ist außeror<strong>den</strong>tlich gewagt für einen jungen Gelehrten, der keinerlei<br />
Vermögen hat, überhaupt <strong>den</strong> Bedingungen der akademischen Laufbahn sich auszusetzen.<br />
Er muss es min<strong>des</strong>tens eine Anzahl Jahre aushalten können, ohne irgendwie<br />
zu wissen, ob er nachher die Chancen hat, einzurücken in eine Stellung, die<br />
für <strong>den</strong> Unterhalt ausreicht.“ Weber sagte zugleich voraus, dass das amerikanische<br />
Modell sich im weiteren Verlauf <strong>des</strong> 20. Jahrhunderts überall durchsetzen werde.<br />
Seit Max Webers Analyse hat sich in Deutschland – nicht zuletzt aufgrund der gro-<br />
ßen Expansionswelle in <strong>den</strong> 1960er- und 1970er-Jahren – überaus viel getan. Mittlerweile<br />
ist die Zahl der Professuren auf über 40.000 angestiegen und auch die wis-<br />
senschaftlichen Mitarbeiterstellen belaufen sich auf rund 150.000 (im Jahre 2000 waren<br />
es noch 100.000)<br />
. Aber zwei andere Zahlen zeigen uns, dass das Problem der privat finanzierten <strong>wissenschaftlichen</strong><br />
Betätigung in Deutschland noch längst nicht von der Bildfläche ver-<br />
schwun<strong>den</strong> ist: Laut Aussagen <strong>des</strong> HRK-Präsidiums befin<strong>den</strong> sich derzeit mehr als<br />
200.000 Doktorand(innen) in der Phase <strong>des</strong> Promovierens und außerdem ist die Zahl<br />
der Lehrbeauftragten (von <strong>den</strong>en viele gänzlich unbezahlt bleiben) seit 2005 von<br />
11.349 auf 16.828 (2010) gestiegen. Darüber hinaus zeigt ein Blick auf die Förder-<br />
angebote und vor allem die Förderzeiträume sehr rasch, dass große Diskrepanzen<br />
zwischen <strong>den</strong> prognostizierten Zielen und <strong>den</strong> harten Realitäten bestehen. So liegt<br />
zum Beispiel die durchschnittliche Förderdauer für Promoven<strong>den</strong> bei 2 – 3 Jahren,<br />
die durchschnittliche Promotionsdauer hingegen bei 4,6 Jahren. Wem dies bei Weitem<br />
zu lang erscheint, der werfe einen Blick in die USA: Dort beträgt die durchschnittliche<br />
Promotionszeit 7,7 Jahre (vgl. NSF 2008 Survey of Earned Doctorates).<br />
3