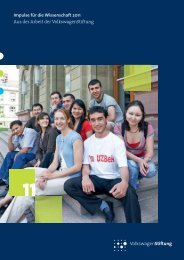Zu den Perspektiven des wissenschaftlichen Nachwuchses
Zu den Perspektiven des wissenschaftlichen Nachwuchses
Zu den Perspektiven des wissenschaftlichen Nachwuchses
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
und Dilemmata betrachten. Mir scheint ferner, dass wir uns beispielsweise mit Blick<br />
auf die Promotionsphase noch immer im Spannungsfeld solcher, zumeist falscher<br />
Dichotomien, bewegen. Lassen Sie mich nur drei davon kurz beleuchten: Transparenz<br />
versus Autonomie; Individualität versus Teamarbeit; dritte Phase der Ausbildung<br />
oder eigenständige Forschung. Im ersten Fall steht auf der einen Seite die Forderung<br />
nach mehr Transparenz, d. h. nach offenen, klar strukturierten Aufnahmeverfahren,<br />
Promotionsvereinbarungen und „Thesis Advisory Committees“, auf der anderen Seite<br />
steht die Erwartung der Professorinnen und Professoren, bei der Auswahl und Betreuung<br />
ihrer Doktorandinnen und Doktoran<strong>den</strong> freie Hand zu haben. Die Erwartung,<br />
dass die Doktorandin und Doktoran<strong>den</strong> mit ihrer Dissertation eine eigenständige wissenschaftliche<br />
Arbeit vorlegen sollen, wird von manchen in dem Sinne falsch verstan<strong>den</strong>,<br />
dass diese Arbeit in der Abgeschie<strong>den</strong>heit einer Studierstube ohne regelmäßigen<br />
Austausch mit der Betreuerin oder dem Betreuer entstehen muss, von an-<br />
deren wird die Forderung nach mehr Teamarbeit gar so interpretiert, dass die Leistung<br />
der Doktorandinnen oder <strong>des</strong> Doktoran<strong>den</strong> in der Teamleistung aufgeht und<br />
somit nicht individuell erkennbar gewürdigt wer<strong>den</strong> kann. Vor dem Hintergrund der<br />
Bologna-Reformen ist zudem ein wissenschaftspolitischer Streit darüber entbrannt,<br />
ob es sich bei der Promotion in erster Linie um eine Fortsetzung <strong>des</strong> Studiums in der<br />
sogenannten „Dritten Phase“ oder um selbstbestimmte Forschung handelt. Diese<br />
falsch verstan<strong>den</strong>en Dichotomien gilt es so schnell wie möglich aufzulösen; <strong>den</strong>n die<br />
Promotionsphase bildet in jedem Fall die Grundlage für späteres wissenschaftliches<br />
und berufliches Wirken. Hier wer<strong>den</strong> schließlich die Weichen gestellt, die in die Wissenschaft<br />
oder aus ihr heraus führen. Ausschlaggebend für die Entscheidung für o-<br />
der gegen eine Karriere in der Wissenschaft sind natürlich auch die <strong>Perspektiven</strong>, die<br />
sich für Promovierende nach Abschluss ihrer Dissertation ergeben.<br />
Um aus diesen Dichotomien und Dilemmata herauszukommen, brauchen wir dringend<br />
eine veränderte Farb- und Gefühlsskala. Um diese zu entwickeln, könnte es<br />
nützlich sein, sich die konzeptionellen Vorarbeiten der Carnegie Foundation for the<br />
Advancement of Teaching anzuschauen, die in zwei Bän<strong>den</strong> mit <strong>den</strong> jeweiligen Titeln<br />
„Envisioning the Future of Doctoral Education: Preparing Stewards of the Discipline –<br />
Carnegie Essays on the Doctorate“ (2006) und „Information of Scholars: Rethinking<br />
Doctoral Education for the Twenty-First Century“ (2008) publiziert wur<strong>den</strong>.<br />
5