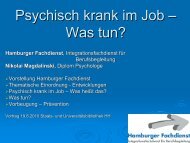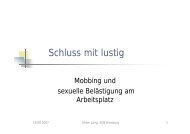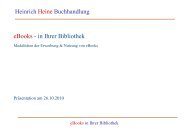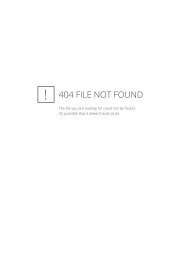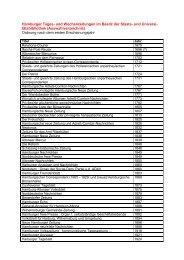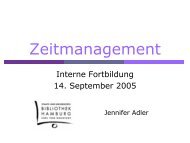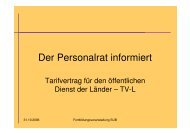Von Rittern, Bürgern und von Gottes Wort - Staats- und ...
Von Rittern, Bürgern und von Gottes Wort - Staats- und ...
Von Rittern, Bürgern und von Gottes Wort - Staats- und ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
10<br />
Herkules-Aufgaben, die durch Rückführung der Bestände<br />
der Handschriftenabteilung <strong>und</strong> den Restauratoren<br />
entstanden sind, alles andere als motivierend. Entscheidend<br />
war dennoch, daß die SUB nun wieder im<br />
Besitz eines Großteils ihrer historischen Denkmäler war,<br />
deren Bedeutung nicht hoch genug eingeschätzt werden<br />
kann.<br />
Die für unsere Ausstellung bedeutende germanistischen<br />
Handschriften waren unter den Berliner Deposita<br />
nicht vertreten, sie tauchten später in den Sendungen auf,<br />
die aus Moskau, Armenien <strong>und</strong> Georgien an Hamburg<br />
zurückgegeben wurden. 2 Sie boten auch besonders schöne<br />
Überraschungen. Bei der Sichtung dieser wiedergef<strong>und</strong>enen<br />
Schätze wuchs sogleich die Idee, der Hamburger<br />
Öffentlichkeit <strong>und</strong> vor allem der neuen Germanistengeneration<br />
an der hiesigen Universität diese 50 Jahre lang<br />
verborgen gebliebenen Exemplare in ihrem schönen<br />
Sammlungskontext vorzustellen. Überdies lassen sich an<br />
diesen Exponaten sowohl ein guter Ausschnitt aus der<br />
literarischen Produktion des 15. Jahrh<strong>und</strong>erts, der Gattungsreichtum<br />
der Epoche <strong>und</strong> die Vielfalt der Überlieferungen<br />
volkssprachiger Texte zeigen, als auch beliebte<br />
Lesestoffe jener Zeit einem interessierten Publikum näherbringen.<br />
Sollte es außerdem gelingen, durch die Präsentation<br />
dieser Kostbarkeiten auch auf die Notwendigkeit der zur<br />
Zeit stark vernachlässigten handschriftenk<strong>und</strong>lichen<br />
Studien für eine neuphilologische Ausbildung mit Nachdruck<br />
hinzuweisen, wäre die Wirkung der geplanten<br />
Ausstellung als besonderer Erfolg zu verbuchen.<br />
Die Hamburger<br />
germanistischen Handschriften<br />
Volkssprachige Handschriften, die im Mittelpunkt dieser<br />
Ausstellung stehen, lassen sich in verschiedenen Abteilungen<br />
der systematisch aufgestellten Hamburger<br />
Sammlung finden. In den nach wissenschaftlichen Disziplinen<br />
aufgestellten Gruppen befindet sich neben griechischen<br />
<strong>und</strong> lateinischen Handschriften auch eine bedeutende<br />
Zahl deutscher Überlieferungen vielerlei Inhalts.<br />
Diese bis auf unsere Tage gültige Sytematik ist als<br />
Werk des damaligen Bibliothekars, Friedrich Martin<br />
Pitiscus (1721–1794), in den Jahren 1784–1791 entstanden.<br />
Er hat die ganze Ansammlung <strong>von</strong> Stiftungen <strong>und</strong> Schenkungen<br />
ungeordneter Bücher <strong>und</strong> Handschriften, die die<br />
damalige Hamburger Stadtbibliothek während ihrer<br />
knapp 300jährigen Existenz erworben hatte, zunächst<br />
nach Überlieferungsart geschieden, untersucht <strong>und</strong> die<br />
Manuskripte in den nach ihm benannten handschriftli-<br />
chen Verzeichnissen, den sogenannten Pitiscus Katalogen,<br />
erfaßt. Sein Ordnungsprinzip entsprach dem zeitgenössischen<br />
Fächerkanon, <strong>und</strong> so schuf er aufgr<strong>und</strong><br />
inhaltlicher Kriterien die entsprechenden Handschriftengruppen.<br />
3<br />
Durch diese Art der Klassifizierung gelangten etliche<br />
germanistischen Handschriften unter die theologischen,<br />
historischen oder philosophischen Codices. 4<br />
Sein Kriterienkatalog versagte jedoch z.B. bei der Beurteilung<br />
jener volkssprachigen Texte, die nicht eindeutig<br />
als Werke theologischen, philologischen oder naturk<strong>und</strong>lichen<br />
Inhalts zu erkennen waren <strong>und</strong> für den Altphilologen<br />
bzw. den Historiker wissenschaftlich nicht<br />
geläufig oder gar wertlos erschienen. Diese wurden fortan<br />
als unsignierte Handschriften behandelt.<br />
Anfang des 19. Jahrh<strong>und</strong>erts hat der Bibliothekar<br />
Christian Petersen (1802–1872) 5 eine erneute Umorganisation<br />
des Bestandes vorgenommen: zunächst hat er die<br />
sogenannten unsignierten Handschriften, die bei der<br />
Systematisierung <strong>von</strong> Pitiscus durchgefallen waren, näher<br />
untersucht <strong>und</strong> solche mit volkssprachigen Texten<br />
unter dem Begriff Litteratur der neueren Völker zusammengefaßt.<br />
Der jeweiligen Sprache entsprechend wurden<br />
die Signaturengruppen codices italici, codices hispanici,<br />
<strong>und</strong> codices germanici eingerichtet. 6<br />
Ohne Inhalt <strong>und</strong> Sprache zum Ordnungsprinzip zu<br />
machen, wählte er zudem aus der gesamten systematisch<br />
geordneten Sammlung eine Gruppe ihm als besonders<br />
kostbar erscheinender Codices aus, stellte sie gesondert<br />
in den »Ehrenschrank«, den Schrein, <strong>und</strong> gab ihnen die<br />
Signatur codices in scrinio. Diese Praxis wurde <strong>von</strong> späteren<br />
Bibliothekaren fortgesetzt, <strong>und</strong> so entwickelte sich<br />
der Inhalt des Schreins zu einer Kollektion, in der neben<br />
den tatsächlich größten Kostbarkeiten der Bibliothek<br />
leider auch Geschenke beliebiger prominenter Amtsträger<br />
pflichtschuldigst aufgestellt wurden. Nach 1945 fanden<br />
auch die wenigen Neuerwerbungen ihren Standort<br />
unter den Handschriften in scrinio.<br />
Bei der Auswahl der Prachtstücke für den »Ehrenschrank«<br />
fand Petersen später folgerichtig auch einige<br />
historische <strong>und</strong> theologische Handschriften, die nach<br />
seiner Auffassung eher zu den germanistischen gestellt<br />
werden sollten, wie z.B. Kat.-Nr. 25 <strong>und</strong> 46.<br />
Seine besondere Aufmerksamkeit widmete Petersen<br />
aber den Handschriften, die er als zur Sammlung Uffenbachs<br />
gehörig identifizieren <strong>und</strong> in dessen Katalog <strong>von</strong><br />
1747 nachweisen konnte. Seine Erkenntnisse hielt er in<br />
einem handschriftlichen Verzeichnis (Petersen, Verz.) der<br />
germanistischen Handschriften fest, das nicht nur nützliche<br />
Informationen über den jeweiligen Text <strong>und</strong> seine