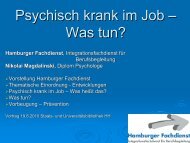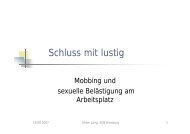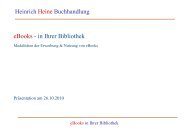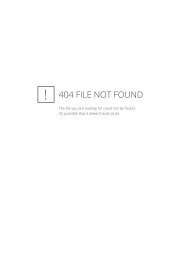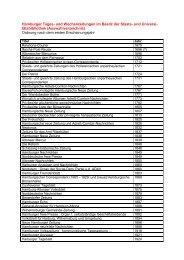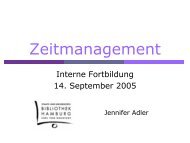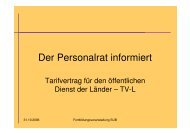Von Rittern, Bürgern und von Gottes Wort - Staats- und ...
Von Rittern, Bürgern und von Gottes Wort - Staats- und ...
Von Rittern, Bürgern und von Gottes Wort - Staats- und ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
9<br />
36<br />
Mittelniederdeutsches Lektionar, Sommerteil<br />
Diözese Halberstadt oder Magdeburg – 1390<br />
Hamburg, SUB: cod. 95b in scrin.<br />
Provenienz: Johannes Geffcken 47<br />
Pergamenthandschrift — 140 Bll. — 22 x 15 — 29 Zeilen — Tintenlinierung — Textura, 1 Hand — neue Bleistiftfoliierung —<br />
rubriziert — rote <strong>und</strong> blaue zweizeilige Lombarden — alter dunkelbrauner Ledereinband über Holzdeckeln, 1962 restauriert,<br />
zwei Schließen <strong>und</strong> Lederrücken ergänzt.<br />
Das Lektionar repräsentiert einen liturgischen Buchtyp, der<br />
im Mittelalter eine ungleich größere Verbreitung fand als<br />
vollständige Bibeln, sowohl in lateinischer als auch in deutscher<br />
Sprache. 48 Lektionare enthalten Sammlungen biblischer<br />
Textabschnitte in der Ordnung des Kirchenjahres, welche<br />
im Rahmen des <strong>Gottes</strong>dienstes als Episteln <strong>und</strong> Tagesevangelien<br />
verlesen werden. 49 Diese Textabschnitte (Lektionen<br />
oder Perikopen genannt) sind in drei Zyklen angeordnet:<br />
Das Temporale liefert die Lektionen für die Sonn- <strong>und</strong><br />
Wochentage, das Sanktorale diejenigen für die Heiligenfeste<br />
<strong>und</strong> das Commune Sanctorum Lektionen für verschiedene<br />
Anlässe wie gemeinsame Heiligenmessen (Fest eines heiligen<br />
Märtyrers, Fest eines heiligen Kirchenlehrers etc.) oder<br />
für Votivmessen (Vom Heiligen Geist, Um Schutz gegen<br />
die Heiden, Bei der Weihe eines Bischofs etc.). 50 Nicht<br />
immer bietet eine einzelne Handschrift den vollen Jahreszyklus.<br />
Üblich ist die Unterteilung in zwei Jahreshälften,<br />
den Sommerteil (mit dem Osterfestkreis) <strong>und</strong> den Winterteil<br />
(mit dem Weihnachtsfestkreis). 51<br />
Der deutsche Text wurde nicht innerhalb der Liturgie<br />
verwendet, die das gesamte Mittelalter hindurch in lateinischer<br />
Sprache abgehalten wurde, sondern diente lesek<strong>und</strong>igen<br />
Laien, zu denen vor allem Frauen zu zählen sind,<br />
zur erbaulichen Vor- <strong>und</strong> Nachbereitung der <strong>Gottes</strong>dienste,<br />
zur gemeinsamen klösterlichen Tischlesung <strong>und</strong> zur<br />
privaten Andacht <strong>und</strong> Erbauung. Auch Kleriker nutzten<br />
deutsche Perikopen zur Vorbereitung <strong>von</strong> Predigten, an<br />
deren Anfang zumeist eine deutsche Paraphrase des Tagesevangeliums<br />
stand.<br />
Das ausgestellte Exemplar überliefert Episteln <strong>und</strong><br />
Evangelientexte des Sommerteils. Folgende Überschrift<br />
(s. recto-Seite) bezeichnet den Inhalt der Handschrift: In<br />
nomine domini Amen. Hir beginnen de epistolen vnd<br />
ewangelien <strong>von</strong> dem somerdeile also man se leset dorch dat halue<br />
iar nach einander beide <strong>von</strong> der tyt vnd van den hiligen. Es<br />
folgt die erste Lesung zum Ostersonntag (1 Kor 5,7-8): An<br />
dem beginne van dem osterdage Epistola Pauli ad Chorintheos.<br />
Brudere veget üt den alden suoren deich uppe dat gy sit ein<br />
nuwe besprengunge alse gy sit des derf brodes wan to vnsen<br />
osteren is Christus geoffert etc. Der Hamburger Codex gehört<br />
zu einer Gruppe <strong>von</strong> vornehmlich ripuarischen <strong>und</strong><br />
moselfränkischen Handschriften, über deren Textgeschichte<br />
Hartmut Beckers nach Jan Dechamps zusammenfassend<br />
bemerkt: »Die Episteln stammen in direkter Linie <strong>von</strong> der<br />
ältesten bekannten niederländischen Epistelübersetzung ab<br />
[…]; bei den Evangelienperikopen handelt es sich demgegenüber<br />
um einen Mischtext, der einerseits auf einer alten<br />
deutschen Evangelienübersetzung, andererseits auf einer<br />
Verdeutschung der LS-Redaktion des […] niederländischdeutschen<br />
Lebens Jesu fußt.« 52<br />
Der Codex ist in regelmäßiger Textura auf stark nachgedunkeltem<br />
Pergament minderer Qualität geschrieben; die<br />
Blätter weisen vielfach Löcher <strong>und</strong> Unebenheiten auf, einige<br />
Risse wurden genäht. Eine größere Initiale wurde herausgeschnitten.<br />
Eine alte Blattzählung findet sich nur für<br />
das Sanktorale (beginnend mit I auf fol. 98r bis fol. 138r).<br />
Vorangestellt ist dem Lektionar auf einer separaten Lage<br />
ein Kalender, welcher das gesamte Jahr in 53 Wochen gliedert.<br />
Eine übergeordnete Monatsgliederung fehlt. Jede Seite<br />
ist in drei Spalten zu je 31 Zeilen eingeteilt (s. Abbildung).<br />
Die einzelnen Wochentage sind wie stets durch Buchstaben<br />
markiert (rotes A für den Sonntag). Der Kalender bietet die<br />
Heiligenfeste nach ihrer Reihenfolge im Ablauf des »weltlichen«<br />
Jahres. Er beginnt mit dem Fest »Beschneidung des<br />
Herrn« (1. Januar) <strong>und</strong> endet mit dem Fest des heiligen Silvester<br />
am 31. Dezember. 53 Nicht alle Heiligenfeste haben<br />
den gleichen Status. Ihr Rang spiegelt sich in der Liturgie<br />
des jeweiligen Tages, in der Anzahl der Lesungen (bis zu<br />
neun bei hochrangigen Festen) sowie dem jeweils verwendeten<br />
Meßformular. 54<br />
Im Hamburger Codex sind besonders hochrangige<br />
Heiligenfeste in roter Schrift notiert (vgl. auf der abgebildeten<br />
Seite St. Martin, St. Nikolaus, St. Katharina <strong>von</strong><br />
Alexandrien, die Elisabeth <strong>von</strong> Thüringen sowie den hl.<br />
Franz <strong>von</strong> Assisi, die alle dem Winterteil angehören). Das<br />
Lektionar umfaßte ursprünglich zwei Bände, deren erster,<br />
welcher den Winterteil überlieferte, verloren ist. Für die<br />
Aufteilung in zwei Bände spricht auch ein Besitzervermerk,<br />
der über mehrere Seiten mit brauner Lacktinte am oberen<br />
Blattrand der recto-Seiten notiert wurde: ik. bidde. dat. disse<br />
/ twe. ewan[gelien] buoke. bie. / der. cluosse. to. oschers / leue.<br />
bie s[an]c[t]e step[han]. / liuen. vnde. alle. de. boke / de. dar.<br />
sint. getyde / boke. vnde vilgen. buoke. / vnd alle de. buoke.<br />
Am Ende der Handschrift (fol. 138vb) findet sich das