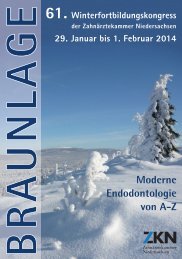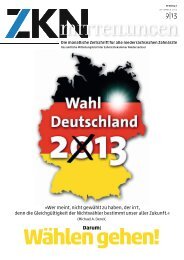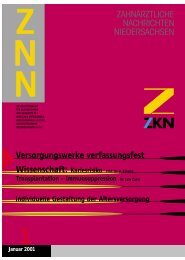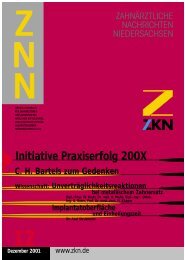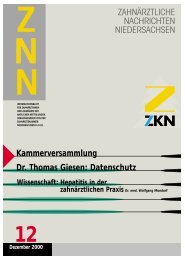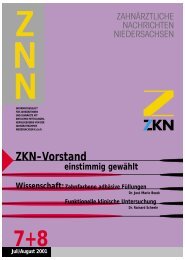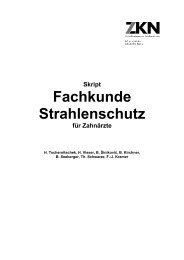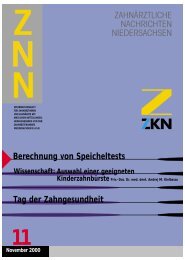Blindtext Blindtext Blindtext Blindtext Blindtext Blindtext Blindtext
Blindtext Blindtext Blindtext Blindtext Blindtext Blindtext Blindtext
Blindtext Blindtext Blindtext Blindtext Blindtext Blindtext Blindtext
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
18<br />
erhöht ist. Eine ähnlich starke Risikoerhöhung lag lediglich<br />
bei den viel bekannteren Risikofaktoren Rauchen und erhöhte<br />
Cholesterinwerte vor. Das Risiko, bei fortgeschrittenem<br />
Knochenverlust einen Schlaganfall zu erleiden, war gar um<br />
das 2.8-fache erhöht. Bei der Berechnung dieser Risikoerhöhung<br />
wurden sämtliche ansonsten bekannten Risikofaktoren<br />
Abb. 5. 34-jähriger Patient<br />
mit agressiver marginaler Parodontitis<br />
herausgerechnet. Leider müssen wir nach wie vor davon ausgehen,<br />
dass nur wenigen Internisten oder Kardiologen diese<br />
Zusammenhänge bewusst sind. Eine parodontale Sanierung<br />
könnte wahrscheinlich bei vielen von Herz-/Kreislauferkrankungen<br />
bedrohten oder bereits betroffenen Patienten zu<br />
einer deutlichen Risikoreduzierung führen. Eine dementsprechende<br />
Information und Kooperation der behandelnden Ärzte<br />
und Zahnärzte wäre daher auf jeden Fall wünschenswert<br />
und läge insbesondere im Interesse der betroffenen Patienten.<br />
Die genauen Mechanismen, die hinter dem Zusammenhang<br />
parodontaler Erkrankungen mit Herz-/Kreislauferkrankungen<br />
stecken, sind noch nicht bis ins Detail geklärt. Ein<br />
Erklärungsmodell (Abbildung 7) besagt, dass die systemisch<br />
verfügbaren Lipopolysaccharide zu Reaktionen am Endothel<br />
und der glatten Muskulatur der Blutgefäße sowie an Monozyten<br />
und Thrombozyten führen. Dies wiederum begünstigt<br />
die Entwicklung atherosklerotischer Läsionen und thrombemolischer<br />
Ereignisse (Marcus et al 1993; Beck et al. 1996).<br />
Parodontitis und weitere Allgemeinerkrankungen<br />
Interessanterweise scheint es nicht nur so zu sein, dass ein<br />
Diabetes mellitus das Risiko erhöht, an einer marginalen Parodontitis<br />
zu erkranken, sondern umgekehrt ist bei schweren<br />
Parodontopathien das Risiko für eine schwierige und damit<br />
schlechte glykämische Kontrolle eines insulin-unabhängigem<br />
Diabetes mellitus deutlich größer (Taylor et al. 1996). Dies<br />
kann bedeuten, dass ein (genetisch prädisponierter) Patient<br />
Abb. 6. Orthopantomogramm des Patienten aus Abb. 5<br />
ZAHNÄRZTLICHE<br />
NACHRICHTEN<br />
NIEDERSACHSEN 5/03<br />
aufgrund eines schlecht eingestellten Diabetes eine marginale<br />
Parodontitis entwickelt und dann aufgrund seiner Parodontitis<br />
wiederum schwerer einzustellen ist. Dieses einfache<br />
Beispiel verdeutlicht erneut, wie wichtig in solchen Fällen<br />
eine gute Zusammenarbeit zwischen behandelndem Zahnarzt<br />
und Internisten ist. Seit einigen Jahren verdichten sich<br />
die Anzeichen dafür, dass fortgeschrittene Parodontalerkrankungen<br />
bei Schwangeren das Risiko für eine Frühgeburt oder<br />
ein Neugeborenes mit reduziertem Geburtsgewicht deutlich<br />
erhöhen (Boyd et al. 1994). Es gibt Vermutungen, dass ein<br />
signifikanter Prozentsatz der Frühgeburten in den USA auf<br />
die parodontale Erkrankung der Mutter zurückzuführen ist<br />
(Page, persönliche Kommunikation). Was empfehlen wir also<br />
einer schwangeren Patientin, die sich mit einer fortgeschrittenen<br />
Parodontitis in unserer Praxis vorstellt? Lassen wir die<br />
Patientin unbehandelt, obwohl wir über die oben genannten<br />
Risiken Bescheid wissen? Oder führen wir ein subgingivales<br />
Scaling durch und verursachen dadurch eine erhebliche Bakteriämie?<br />
Möglicherweise ist das subgingivale Scaling unter<br />
Abdeckung mit Amoxicillin nach dem ersten Trimenon das<br />
Vorgehen mit den geringsten Risiken. Studien gibt es hierzu<br />
jedoch keine. Keine der drei Vorgehensweisen ist ohne Risiken,<br />
was die Entscheidungsfindung für Behandler und Patientin<br />
erschwert.<br />
Genetische Einflüsse<br />
• Gene der immunologischen<br />
und entzündlichen<br />
Anwort<br />
Prädisposition<br />
Atherosklerose<br />
• Entwicklung atherosklerotischer<br />
Läsionen<br />
• thromboembolische<br />
Ereignisse<br />
• akute Phase Reaktion<br />
Reaktionsweise der<br />
Monozyten u. Lymphozyten<br />
Phänotyp der hyperinflammatorischen<br />
Monozyten<br />
LPS<br />
Exposition<br />
Parodontale<br />
Erkrankung<br />
Umwelteinflüsse<br />
♦ Ernährung<br />
(Triglyceride)<br />
♦ Stress<br />
♦ Rauchen<br />
Zusammenfassung<br />
Es scheint, als ob die Liste der Erkrankungen, die durch<br />
schwere Parodontalerkrankungen negativ beeinflusst werden<br />
können, stetig länger wird. Die Konsequenz für uns Zahnärzte<br />
sollte daher sein, die Parodontalerkrankungen noch konsequenter<br />
zu diagnostizieren und zu therapieren. Dabei sollten<br />
wir immer an die möglichen beidseitigen Wechselwirkungen<br />
zwischen den Parodontopathien und den Allgemeinerkrankungen<br />
denken und daher gegebenenfalls Humanmediziner<br />
in unsere diagnostischen und therapeutischen Überlegungen<br />
mit einbeziehen.<br />
Mit freundlicher Genehmigung aus<br />
„Zahnärzteblatt Baden-Württemberg, 3/2003“<br />
Parodontalpathogene<br />
Bakterien<br />
PGE 2, IL-1β<br />
TNFα, TαB<br />
Gefäßreaktion<br />
• Endothel<br />
• glatte Muskulatur<br />
• Monozyten<br />
• Thrombozyten<br />
(Arbeitshypothese nach Beck et al., 1996)<br />
Abb. 7. Reaktionsweise der Monozyten und Lymphozyten<br />
Dr. Dirk Vasel