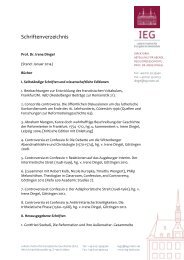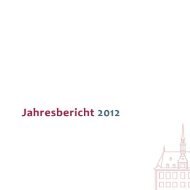Jahresbericht 2011 (PDF) - Institut für Europäische Geschichte Mainz
Jahresbericht 2011 (PDF) - Institut für Europäische Geschichte Mainz
Jahresbericht 2011 (PDF) - Institut für Europäische Geschichte Mainz
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
FORSCHUNGSTÄTIGKEIT<br />
bereiche einsetzte, die Glauben und Leben,<br />
Gesellschaft und Politik in Europa veränderte<br />
und damit zugleich Grundlagen des modernen<br />
Europa schuf. Zu den Wirkungen dieser Transformation,<br />
die sich vor allem in Auseinandersetzung<br />
und Kontroverse abspielte, gehört in<br />
einer <strong>für</strong> Europa kennzeichnenden Weise die<br />
Ausbildung von Konfessionen mit einander ausschließendem<br />
Wahrheitsanspruch, aber auch<br />
das Entstehen von religiösen und gesellschaftlichen<br />
Gruppen, die sich der konfessionellen<br />
und politischen Integration entzogen und so<br />
eine hohe Mobilität entwickeln konnten. Die<br />
Fragestellung des Forschungsbereichs richtet<br />
sich auf die auslösenden Faktoren, die Abläufe,<br />
Ergebnisse und Wirkungen solcher Wandlungsprozesse,<br />
die in exemplarischer Fokussierung<br />
untersucht werden: als kommunikativ vermittelte<br />
Vorgänge, die der Forschungsbereich unter<br />
zwei Schwerpunkten bündelt.<br />
Streitkultur<br />
Dieses Modul hat die Entstehung und Konsolidierung<br />
konfessioneller Identitäten zum<br />
Gegenstand, vermittelt durch die vor allem in<br />
der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts geführten<br />
theologischen Kontroversen und deren<br />
umfassende kommunikative Relevanz. Hier<br />
wurden nicht nur eine nachhaltige Transformation<br />
lehr- und bekenntnismäßiger Grundlagen,<br />
sondern auch eine weitgreifende Differenzierung<br />
sowohl auf geistesgeschichtlicher Ebene<br />
als auch in den Bereichen von Politik und Gesellschaft<br />
in Gang gesetzt.<br />
Das Projekt Kontroversliteratur und »Streitkultur«<br />
in der nachinterimistischen Zeit arbeitet<br />
erstmals die großen, nach dem Augsburger<br />
Interim (1548) einsetzenden innerprotestantischen<br />
Kontroversen systematisch auf (Irene<br />
Dingel mit Kęstutis Daugirdas, Jan-Martin Lies<br />
und Hans Otto Schneider). Das Vorhaben wird<br />
durch die Union der deutschen Akademien<br />
finanziert. Zwei Bände der Edition Controversia<br />
et Confessio sind mittlerweile erschienen,<br />
die Arbeiten an zwei weiteren Bänden sind<br />
weit fortgeschritten, darunter ein Sonderband<br />
zu »Auseinandersetzungen um tritheistische<br />
Positionen der Antitrinitarier in den 1560er Jahren«.<br />
Aus dem Forschungszusammenhang gingen<br />
zahlreiche Vorträge und Aufsätze hervor.<br />
Daran schließt sich die von der Evangelischen<br />
Kirche in Deutschland geförderte Neuedition<br />
der Konkordienformel von 1577 als religiös und<br />
politisch relevantes Konsensdokument im Rahmen<br />
der Edition der Bekenntnisschriften der<br />
evangelisch-lutherischen Kirche (BSELK) an<br />
(Irene Dingel mit Marion Bechtold-Mayer).<br />
Das Projekt Lutherische Theologie und Protestantismus<br />
in Polen, 1548–1650 (Henning P. Jürgens)<br />
fragt nach den Verbindungen der Polen<br />
mit den deutschen Universitäten und nach der<br />
Beteiligung Polens und Litauens an den theologischen<br />
Debatten im Gefolge des Interims.<br />
Dabei stehen die Themen des Transfers und der<br />
öffentlichen Kommunikation im Mittelpunkt;<br />
ein geographischer Schwerpunkt lag auf dem<br />
Königlichen Preußen.<br />
Ein Internationaler Studientag »Neue Forschungen<br />
zu Matthias Flacius Illyricus« am 07.<br />
Juni <strong>2011</strong> widmete sich einem der wichtigsten<br />
Exponenten der protestantischen Streitkultur<br />
und lutherischen Exilanten unter historischen<br />
wie theologiegeschichtlichen Fragestellungen<br />
(s.S. 24f.).<br />
Religion und Mobilität<br />
Dieses Modul steht mit jenem zur »Streitkultur«<br />
in engem Zusammenhang. Es zielt darauf,<br />
einerseits die durch Auseinandersetzungen<br />
in Gang gesetzte »Konfessionsmigration« zu<br />
erfassen, fragt andererseits aber auch danach,<br />
inwiefern nicht religiös motivierte Mobilität<br />
(z.B. von Kaufleuten u.a.) Rückwirkungen auf<br />
die Entstehung religiöser Konflikte begünstigt<br />
und zur Entwicklung von Streitkulturen geführt<br />
hat. Im DFG-geförderten Projekt Erzwungenes<br />
und selbstgewähltes Exil – die Kultivierung des<br />
Exilantentums und seine Auswirkungen auf Theologie<br />
und Gesellschaft (Irene Dingel mit Carsten<br />
Brall und Vera von der Osten-Sacken) werden<br />
solche streitkulturellen Phänomene aufgearbeitet,<br />
die in Mobilität und Exil mündeten: Das<br />
lutherische Exil im Heiligen Römischen Reich<br />
sowie das Netzwerk der von Gnesiolutheranern<br />
geprägten Antwerpener Gemeinde samt der<br />
Wechselwirkungen von konfessioneller Theologie<br />
und Migration. In dem Projekt entstehen<br />
eine Habilitationsschrift und eine Dissertation<br />
sowie eine Datenbank mit Biographien lutherischer<br />
Exilanten.<br />
Das Projekt Religion, Mobilität und interkulturelle<br />
Kommunikation – das frühneuzeitliche Spanien<br />
und das protestantische Europa (Thomas<br />
Weller) untersucht die soziale Praxis und die<br />
9