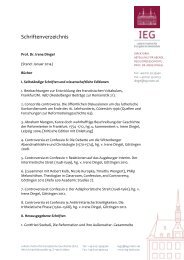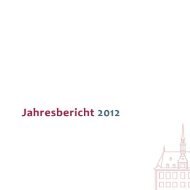Jahresbericht 2011 (PDF) - Institut für Europäische Geschichte Mainz
Jahresbericht 2011 (PDF) - Institut für Europäische Geschichte Mainz
Jahresbericht 2011 (PDF) - Institut für Europäische Geschichte Mainz
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
FORSCHUNGSTÄTIGKEIT<br />
Dabei entstand in Kooperation mit einem an<br />
der TU Eindhoven durchgeführten Partnerprojekt<br />
ein digitales Kartenwerk zur Entwicklung<br />
europäischer Verkehrs- und Kommunikationsnetze<br />
(). Ein zweiter<br />
Schwerpunkt wurde <strong>2011</strong> beim Thema »Rekonstruktion<br />
von Verkehrsströmen« gesetzt.<br />
In Zusammenarbeit mit dem Deutschen Schiffahrtsmuseum<br />
Bremerhaven (Leibniz-<strong>Institut</strong>)<br />
konnte ein Datenhandbuch zur Entwicklung<br />
der deutschen Seeschifffahrt im 19. und 20.<br />
Jahrhundert erarbeitet und publiziert werden.<br />
Im Zusammenhang mit der Initiative »<strong>Mainz</strong> –<br />
Stadt der Wissenschaft <strong>2011</strong>« wurde ein webgestütztes<br />
Informationssystem zur Entwicklung<br />
und Bedeutung der Rheinschifffahrt im<br />
europäischen Kontext konzipiert und als Online-Auftritt<br />
(),<br />
wie auch als »historischer Leinpfad« im Rahmen<br />
des Projekts zeit.fenster: Vergangenheit hat Zukunft<br />
des Römisch-Germanischen Zentralmuseums<br />
(RGZM, Leibniz-<strong>Institut</strong>) im <strong>Mainz</strong>er<br />
Stadtbild präsentiert (s.S. 29f.). Mit dem an der<br />
Harvard Universität beheimateten Center for<br />
Geographic Analysis wurden ca. 100 Datensätze<br />
zur historisch-räumlichen Entwicklung Deutschlands<br />
und Mitteleuropas im 19. Jahrhundert in<br />
die Harvard Geospatial Library eingestellt, von<br />
wo sie nun weltweit im open access-Verfahren<br />
abrufbar sind.<br />
Organisation der Religion im Raum<br />
des frühneuzeitlichen Territorialstaats –<br />
das konsistoriale Kirchenleitungsmodell<br />
in der europäischen Diskussion<br />
(ca. 1550–1620)<br />
Das konfessionsvergleichende Habilitationsprojekt<br />
von Johannes Wischmeyer befasst sich<br />
mit der deutschen und europäischen Diskussion<br />
über Kirchenleitungsmodelle in der ersten<br />
Phase des »Konfessionellen Zeitalters« (1550–<br />
1618). Dabei steht die <strong>Institut</strong>ion des Konsistoriums<br />
bzw. des Kirchenrats im Mittelpunkt. Das<br />
Interesse der Untersuchung gilt in erster Linie<br />
den theologischen und kirchenrechtlichen Diskussionen<br />
im Zusammenhang der Einführung<br />
zentraler Instanzen zur Ausübung des landesherrlichen<br />
Kirchenregiments, außerdem den<br />
interkonfessionellen Transfer- und Adaptionsprozessen.<br />
Teile des Projekts wurden auf Fachtagungen<br />
vorgestellt, weitere Publikationen<br />
wurden vorbereitet.<br />
11<br />
Bildungsräume im 19. Jahrhundert<br />
Dieser von Johannes Wischmeyer betreute<br />
Forschungsschwerpunkt bündelt verschiedene<br />
Projekte, deren gemeinsames Thema raumbezogene<br />
Aspekte der Bildungs- und Wissenschaftsgeschichte<br />
im langen 19. Jahrhundert<br />
– in deutscher, europäischer und globaler<br />
Perspektive – sind. Im Mittelpunkt der Aktivitäten<br />
stand <strong>2011</strong> die internationale Tagung<br />
zum Thema »Transnationale Dimensionen wissenschaftlicher<br />
Theologie. Nationale Wissenschaftsstile<br />
und internationale Kommunikation<br />
im 19. und 20. Jahrhundert« (s.S. 21). Außerdem<br />
wurden verschiedene Publikationen, da runter<br />
zwei Sammelbände, vorbereitet.<br />
Forschungswerkstatt<br />
Wertewandel und<br />
Geschichtsbewusstsein<br />
Im Rahmen der vom IEG betriebenen Forschungen<br />
zu den religiösen und geistigen Traditionen<br />
und Ausprägungen Europas konzentriert sich<br />
die Forschungswerkstatt auf Wandlungsprozesse<br />
in Geschichtsbewusstsein und Wertvorstellungen<br />
unterschiedlicher religiöser, sozialer,<br />
nationaler oder intellektueller Gruppen. Ziel ist<br />
es einerseits, Ausdrucksformen des Geschichtsbewusstseins<br />
und des historischen Selbstverständnisses<br />
im neuzeitlichen Europa auf die<br />
sie prägenden und von ihnen vermittelten<br />
Wertvorstellungen hin zu untersuchen. Andererseits<br />
wird nach der Entstehung spezi fischer<br />
Werthaltungen, nach ihren Transformationen<br />
und den da<strong>für</strong> verantwortlichen Faktoren<br />
sowie nach ihren Funktionen im historischen<br />
Denken einer bestimmten Gruppe oder Epoche<br />
gefragt. Dabei wird die wechselseitige Bedingtheit<br />
der Phänomene Wertewandel und<br />
Geschichtsbewusstsein deutlich. Indem die<br />
For schungsbausteine einen breiten geographischen<br />
Rahmen anlegen und entweder vergleichend<br />
oder transnational konzipiert sind,<br />
analysieren sie den Wertewandel in einem größeren<br />
Kontext, der Transfer- und Transformationsprozesse<br />
erkennen lässt und internationale<br />
oder interreligiöse Parallelen oder Divergenzen<br />
deutlich macht.<br />
Die Forschungswerkstatt setzt sich aus verschiedenen<br />
Forschungsbausteinen sowie übergreifenden<br />
Kolloquien und Workshops zusam-