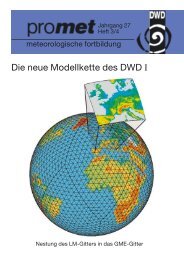Mitteilungen DMG 02 / 2008 - Deutsche Meteorologische ...
Mitteilungen DMG 02 / 2008 - Deutsche Meteorologische ...
Mitteilungen DMG 02 / 2008 - Deutsche Meteorologische ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Fortbildungsveranstaltungen der Zweigvereine<br />
Workshop des Zweigvereins Leipzig:<br />
konvektive Wettersystem und deren Auswirkungen<br />
Mit der Weiterbildungsveranstaltung zu konvektiven<br />
Wettersystemen am 6. März dieses Jahres startete der<br />
<strong>DMG</strong> ZV Leipzig in das Veranstaltungsprogramm für<br />
<strong>2008</strong>. Auf Grund der Anziehungskraft dieses Themas,<br />
nicht nur unter Studenten, benötigten wir den kleinen<br />
Hörsaal der Fakultät für Physik der Universität Leipzig.<br />
Da gerade auch Frühlingsferien waren, war die Veranstaltung<br />
gut besucht. Neben Referenten aus dem eigenen<br />
Institut (Dipl.-Met. Janek Zimmer) folgten auch<br />
externe Redner der Einladung nach Leipzig (u.a. Dr.<br />
Bernold Feuerstein aus Heidelberg). Neben Wärmegewittern,<br />
Superzellen und Böenwalzen ging es in den<br />
Vorträgen auch um Tornados und deren „kleine Geschwister“,<br />
die Staubteufel. Die Modellierung konvektiver<br />
Wettersysteme mit den Wettermodellen des DWD<br />
war gleichfalls Gegenstand und Diskussionsgrundlage.<br />
Im Folgenden sind die 5 Referate des Workshops kurz<br />
zusammengefasst aufgeführt.<br />
Simulation konvektiver Niederschläge mit numerischen<br />
Wettervorhersagemodellen<br />
(Janek Zimmer, Institut für Meteorologie, Leipzig)<br />
Die Fähigkeit der Erfassung konvektiver Zellen durch<br />
ein numerisches Wettervorhersagemodell hängt von<br />
mehreren wichtigen Faktoren ab. Neben der korrekten<br />
Repräsentierung der physikalischen Grundgleichungen<br />
im Modell sowie geeigneten Anfangs- und Randwerten<br />
für den Modellantrieb spielt der horizontale Abstand<br />
benachbarter Gitterzellen im Modell eine entscheidende<br />
Rolle, da kleinräumige konvektive Gebilde nur<br />
dann zufrieden stellend aufgelöst werden können, wenn<br />
sie sich über mehrere Gitterzellen erstrecken. Das beim<br />
DWD operationell eingesetzte nicht-hydrostatische<br />
Modell COSMO-DE (früher LMK) mit 2.8 km Gittermaschenweite<br />
wurde in der vorliegenden Arbeit für<br />
eine Modellstudie über intensive konvektive Niederschlagszellen<br />
genutzt.<br />
Beim Vergleich von beobachteten Radarstrukturen<br />
und Modellsimulationsergebnissen für den Schwergewittertag<br />
vom 16.06.2006 in Sachsen und Thüringen<br />
zeigt sich, dass die nachbetrachtende Modellvorhersage<br />
mit dem hoch aufgelösten COSMO-DE ein gutes<br />
Abbild der eingetretenen Situation erzeugen kann.<br />
Dies gilt insbesondere für die zufrieden stellende Erfassung<br />
der Superzelleneigenschaften der nachmittäglichen<br />
Gewitterzellen in Bezug auf Ausdehnung,<br />
Zuggeschwindigkeit und auch – mit Abstrichen – der<br />
Position des Auftretens. Allerdings wird der beobachtete<br />
Starkniederschlag im Zuge der Zellen vom Modell<br />
deutlich unterschätzt.<br />
wir<br />
Anhand einer idealisierten Modellsimulation einer<br />
stark instabil geschichteten, feucht-warmen Strömung<br />
kann die Entwicklung einer einzelnen, durch eine<br />
Störung im Anfangsfeld hervorgerufenen Konvektionszelle<br />
zu einem großen mesoskaligen konvektiven<br />
System (MCS) verfolgt werden. Mithilfe idealisierter<br />
Eingangsbedingungen können verschiedenartige Einflüsse<br />
auf die konvektiven Prozesse untersucht werden,<br />
zu denen neben den atmosphärischen Ausgangsbedingungen<br />
auch die numerische Behandlung zählt.<br />
Tornados und Superzellen in Deutschland – ein<br />
geschichtlicher Abriss<br />
(Dr. Bernold Feuerstein, ESSL Deutschland)<br />
Tornados sind in Deutschland ein zwar für einen gegebenen<br />
Ort sehr seltenes, insgesamt aber nicht außerordentliches<br />
Wetterphänomen – werden doch jährlich<br />
einige Dutzend dieser kleinräumigen, an hochreichende<br />
Feuchtkonvektion gebundenen Luftwirbel<br />
beobachtet. Die deutsche Tornadoforschung, welche<br />
schon in den 1920/30er Jahren verbunden mit den Namen<br />
Alfred Wegener und Johannes Peter Letzmann<br />
Pionierarbeit leistete, hat nach geringerem Interesse in<br />
den Nachkriegs-Jahrzehnten seit den 1990er Jahren einen<br />
neuen Aufschwung erfahren. Hierzu hat das 1997<br />
von Nikolai Dotzek gegründete Netzwerk TorDACH<br />
zur Erforschung lokaler Unwetter in Deutschland (D),<br />
Österreich (A) und der Schweiz (CH) erheblich beigetragen<br />
[1] und es ist nach einem guten Jahrzehnt<br />
intensiver Recherchearbeit lohnenswert, einen Blick<br />
auf den heutigen Stand der Tornadoklimatologie in<br />
Deutschland zu werfen. Abb. 1 zeigt die Tornadofallzahlen<br />
pro Jahrzehnt seit 1800, worin sich deutlich<br />
Abb. 1: Zeitliche Entwicklung der bekannten Tornadofälle in Deutschland<br />
seit 1800.<br />
<strong>Mitteilungen</strong> <strong>02</strong>/<strong>2008</strong><br />
25